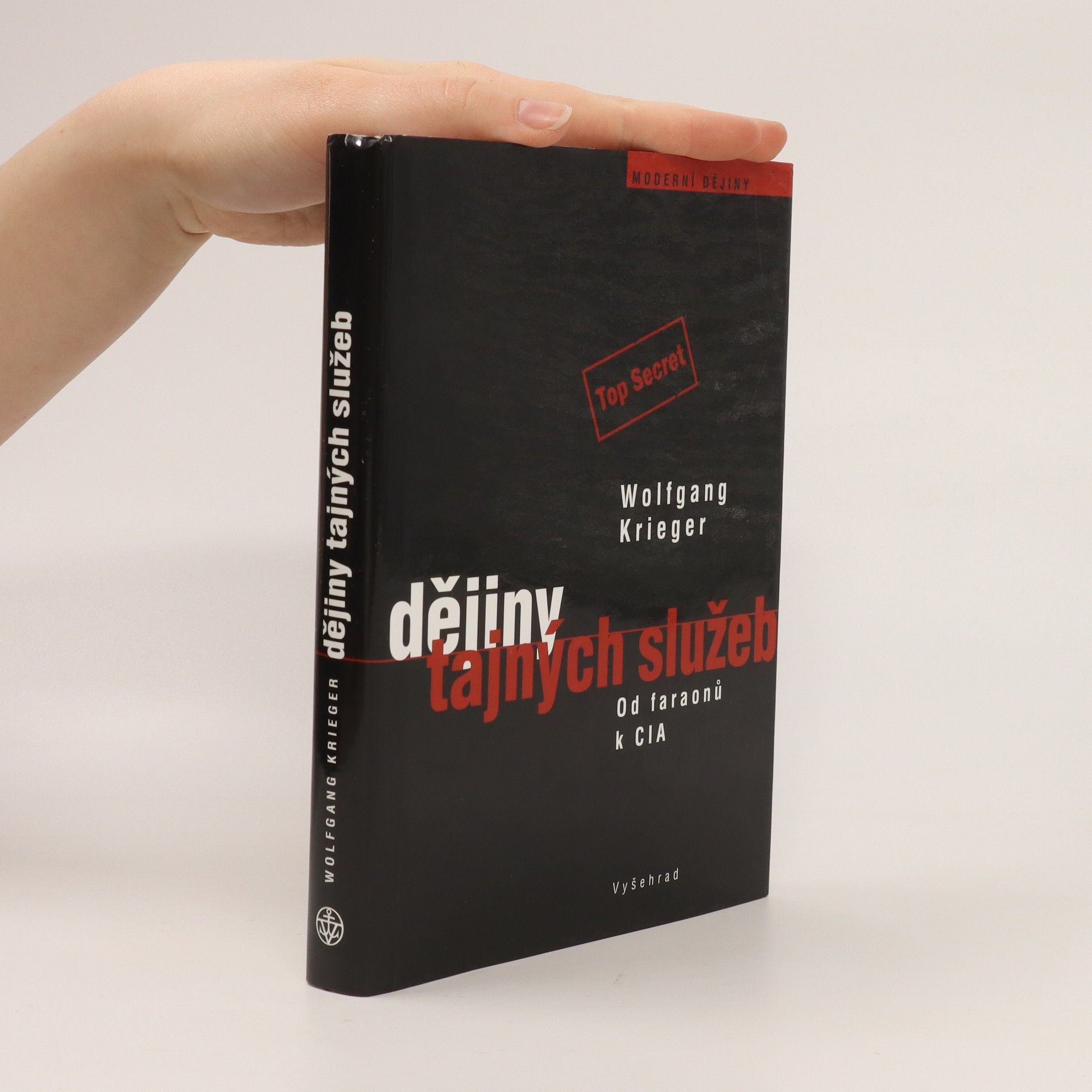Im Kalten Krieg wurden die besiegten Deutschen schnell zu Verbündeten der Westmächte im Geheimdienstbereich. Dieses Buch beleuchtet erstmals die geheime Zusammenarbeit zwischen westdeutschen und ausländischen Geheimdiensten, basierend auf BND-Archivunterlagen und Kanzleramtsakten. Es ist Teil der Veröffentlichungen zur Geschichte des BND.
Wolfgang Krieger Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

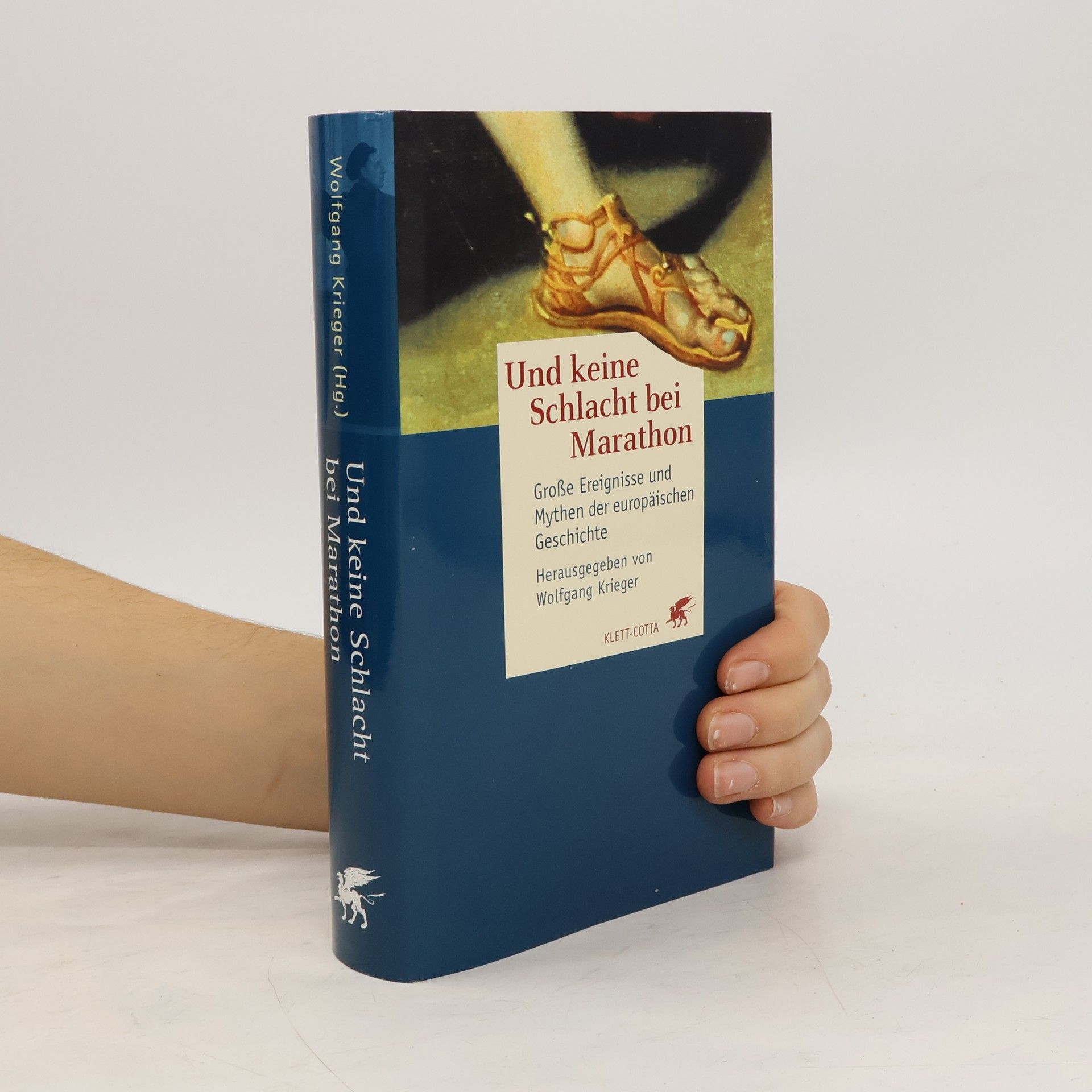


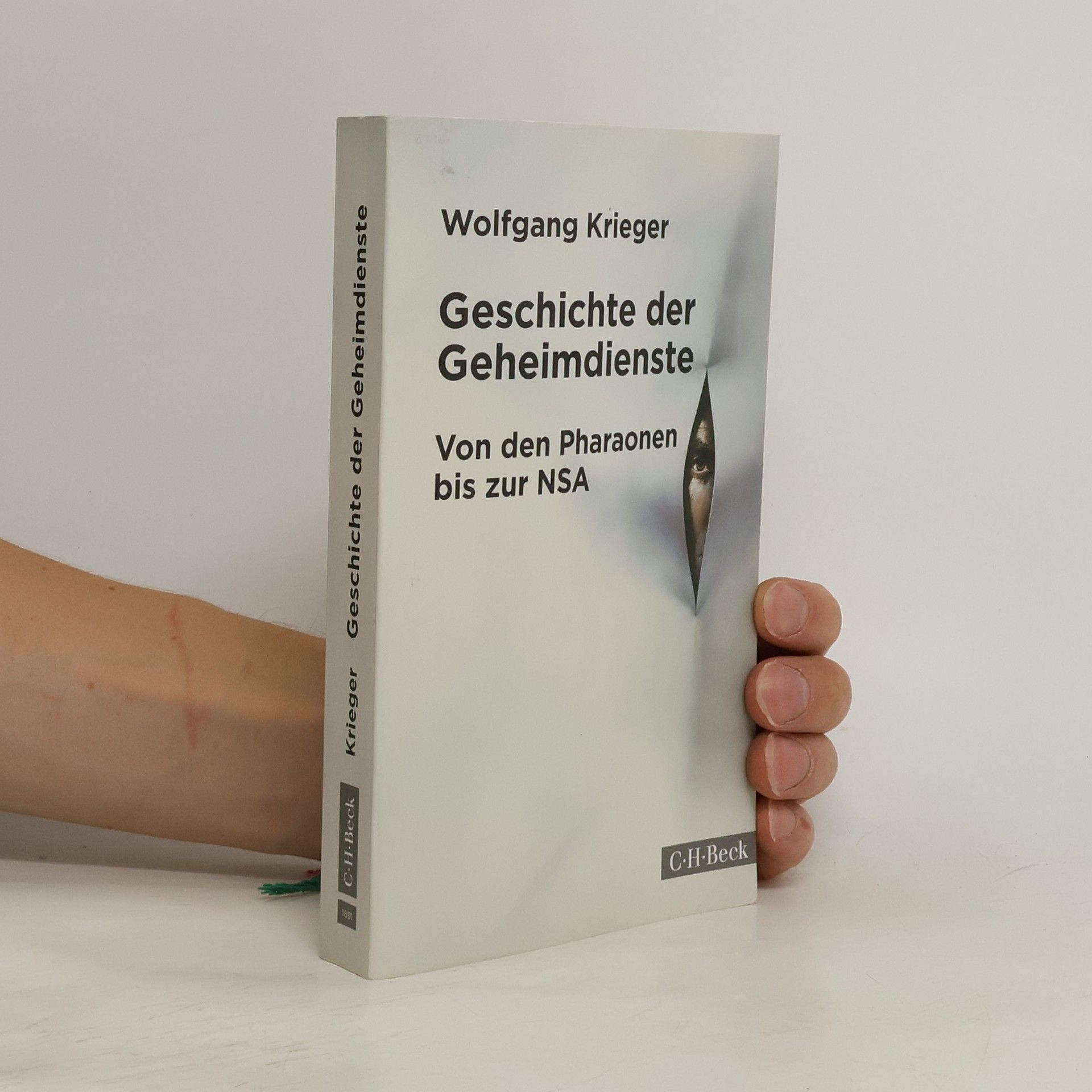


Die deutschen Geheimdienste
Vom Wiener Kongress bis zum Cyber War
Auf dem neuesten Stand der Forschung erzählt Wolfgang Krieger die Geschichte deutscher Geheimdienste seit dem 19. Jahrhundert. Er erläutert die unterschiedlichen Ausrichtungen der Dienste – beispielsweise des Sicherheitsdienstes (SD) im Dritten Reich oder des Bundesnachrichtendienstes (BND) in der Bundesrepublik – und erhellt deren Verhältnis zu anderen staatlichen Institutionen. Darüber hinaus ordnet er die Organisationen in den internationalen Rahmen ein und beschreibt aktuelle Herausforderungen der Geheimdienstarbeit. Sachkenntnis und unaufgeregter Ton zeichnen den Band aus, in dem auch die unterschiedlichen moralisch-rechtlichen Perspektiven auf geheimdienstliche Aktivitäten nie aus dem Blick geraten.
Touha vyzvědět úmysly svých potenciálních nepřátel uvnitř státu i za jeho hranicemi je už od dob antiky vlastní všem vládcům – diktátorům stejně jako demokratům, monarchům nejinak než prezidentům. Tajné služby, agenti, šifrovací techniky a kontrašpionáž nejsou vynálezem novověku, ale jsou zde odnepaměti. Ve svém strhujícím a hluboce fundovaném přehledu Wolgang Krieger ukazuje výzvědné techniky a tajné agenty jako organickou součást tří tisíciletí lidských dějin a dokládá postupný vývoj tajných služeb. I známé historické události se v tomto pohledu mohou ukázat v novém světle. Autor barvitě líčí, jakou roli v konkrétních případech tajné služby sehrály, a mistrně rozplétá složité předivu vztahů v této šedé zóně pohybující se často na hranicích ilegality.
Geschichte der Geheimdienste
Von den Pharaonen bis zur NSA
Edward Snowdens Enthüllungen haben die öffentliche Wahrnehmung der Geheimdienste verändert. Das Internet ist ihr neues Schlachtfeld und hat damit endgültig seine Unschuld verloren. Vor diesem Hintergrund erfährt die Welt der Agenten und Spione wieder einmal gesteigertes Interesse. Mit Wolfgang Krieger legt ein international renommierter Fachmann für diese Thematik eine ebenso differenzierte wie spannende Darstellung der Geschichte der Geheimdienste durch drei Jahrtausende vor.
Wie wurde aus einem Strandscharmützel bei Marathon die große Entscheidungsschlacht zwischen Persern und Griechen? Welche Folgen hatte die Überquerung des Rubicon für die Geschichte Roms tatsächlich? Warum glauben wir noch heute irrtümlich, Martin Luther habe seine berühmten 95 Thesen an das Portal der Wittenberger Schloßkirche genagelt? Renommierte Historiker beleuchten auch die weniger bekannten Hintergründe bekannter Ereignisse, die so in neuem Licht erscheinen. Sie zeigen, wie große Ereignisse der Geschichte zu Geschichtsmythen stilisiert wurden, um sie später in den Dienst politischer, ideologischer und kirchenpolitischer Zwecke zu stellen.
Geheimdienste in der Weltgeschichte
- 380 Seiten
- 14 Lesestunden
Der Wille der Mächtigen, sich durch das Ausspähen und bisweilen auch das Ausschalten ihrer Gegner strategische Vorteile zu verschaffen, ist Jahrtausende alt. Die Geschichte der Geheimdienste reicht bis in die Antike zurück und hinterließ ihre Spuren auf allen Kontinenten. Anhand von mehr als 20 fesselnden Beispielen führt dieses Buch Ziele und Methoden der Spione und Agenten vor Augen – vom Geheimdienst Alexanders des Großen über die verborgene Diplomatie der Päpste bis hin zum mutmaßlichen Versagen der Geheimdienste bei den Anschlägen am 11. September 2001.