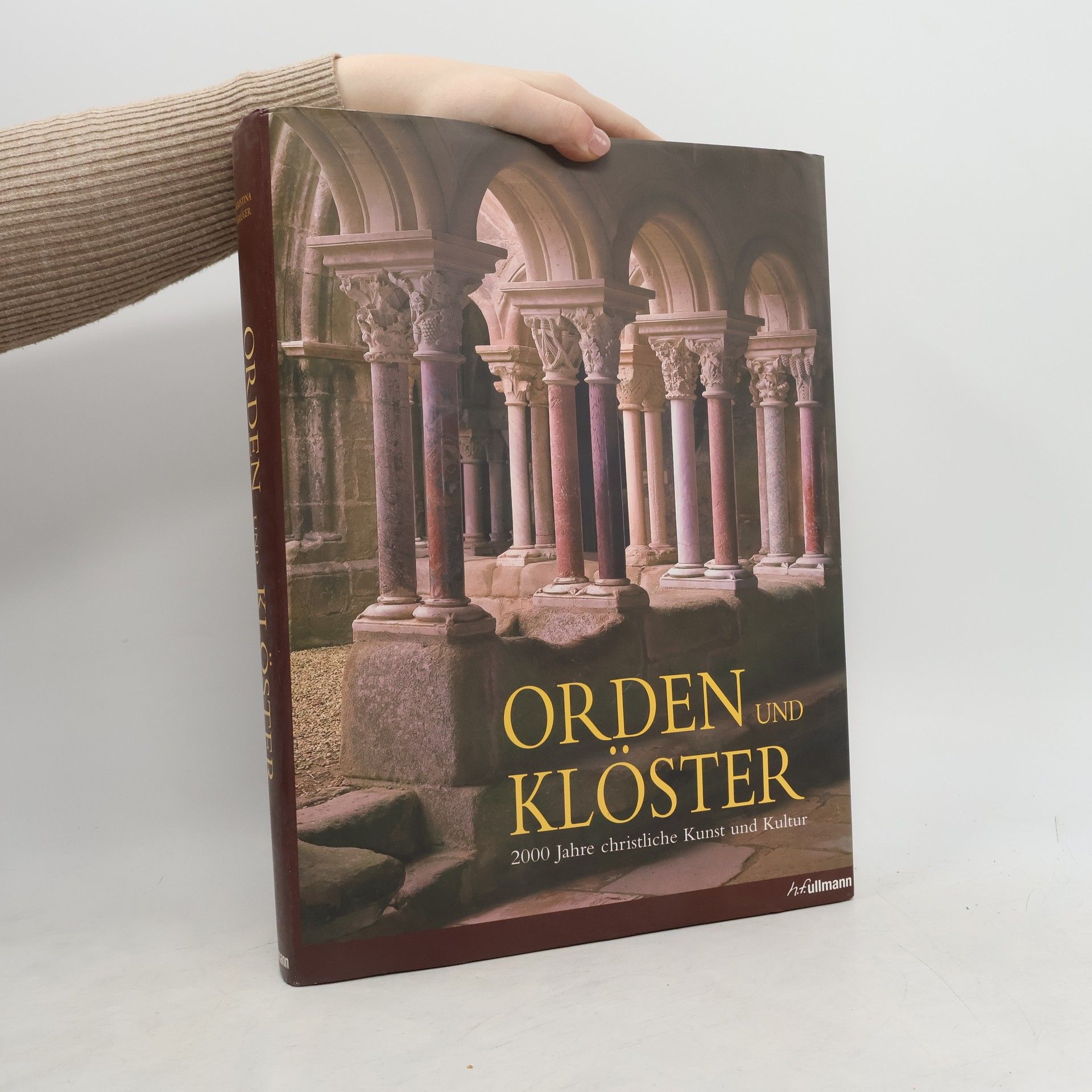Lapbooks: Geometrie - 1.-4. Klasse
Praktische Hinweise und Gestaltungsvorlagen rund um das Thema Geometrie
Schneiden, Falten, Gestalten und Präsentieren: die motivierende Alternative zum klassischen Arbeitsblatt - jetzt auch zum Thema Geometrie! Klappkarten, Taschen und Faltbücher: Mit diesen Entdeckermappen halten Ihre Grundschulkinder Lernergebnisse auf motivierende und kreative Weise durch Basteln, Schreiben und Malen fest. Jedes Lapbook ist individuell, keines sieht aus wie das andere. Daher ist die Präsentation abwechslungsreich und spannend und Ihre Kinder haben Freude, ihr Produkt zu zeigen. Ihre Schülerinnen und Schüler können selbstständig entscheiden, wie sie mit den erarbeiteten Informationen umgehen. Sie gestalten ihr Lapbook nach eigenen Vorstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Daher bieten Lapbooks zahlreiche Möglichkeiten zur Differenzierung. Es gibt einfache Vorlagen, die nur ausgeschnitten werden müssen, andere können mit vielen eigenen Inhalten gefüllt werden. Die hier angebotenen Materialien sind in der 1. bis 4. Klasse einsetzbar. Infokarten, Rückmeldebogen und Laufzettel runden das Angebot ab.