Richard Schaefflers Transzendentale Theologie will, wie das schon Rahner versucht hat, in einer säkularisierten Welt, die alles Reden von Gott unter Sinnlosigkeitsverdacht stellt, angeben, wovon die Rede ist, wenn von Gott gesprochen wird: Nicht die Spitze der Seinspyramide oder der Werte-Skala ist der primäre Ort, an dem Gott gesucht werden kann, sondern jeder Gegenstand der Erfahrung und sein Anspruch an unser Anschauen und Denken kann zur Gestalt werden, in der Gott dem Menschen begegnet. Erfahrung ist für Schaeffler ein Dialog, der mit der Weltwirklichkeit nur deshalb geführt werden kann, weil er den Anspruch des Wirklichen als Gegenwartsgestalt einer freien göttlichen Anrede entziffert.
Richard Schaeffler Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
20. Dezember 1926 – 24. Februar 2019

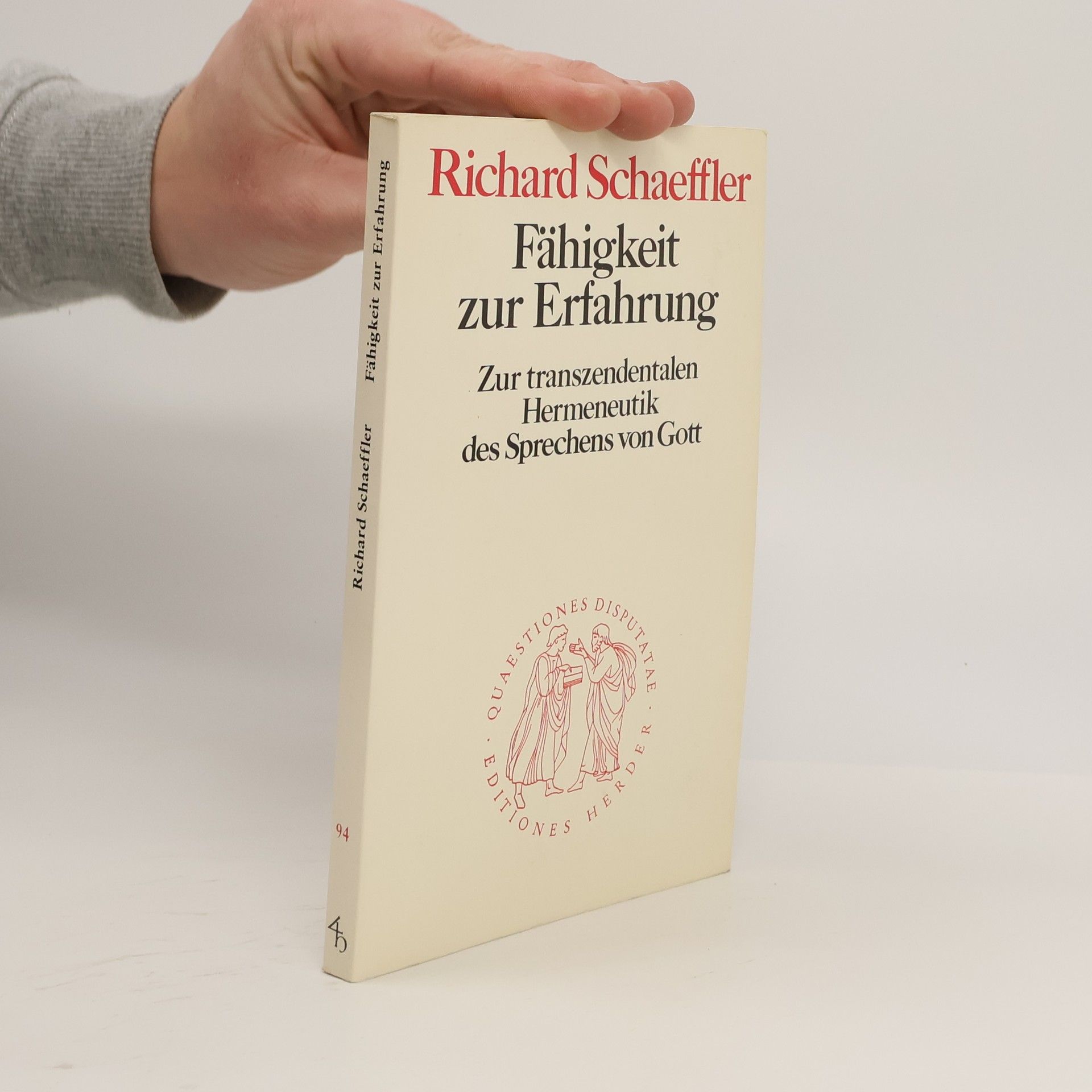

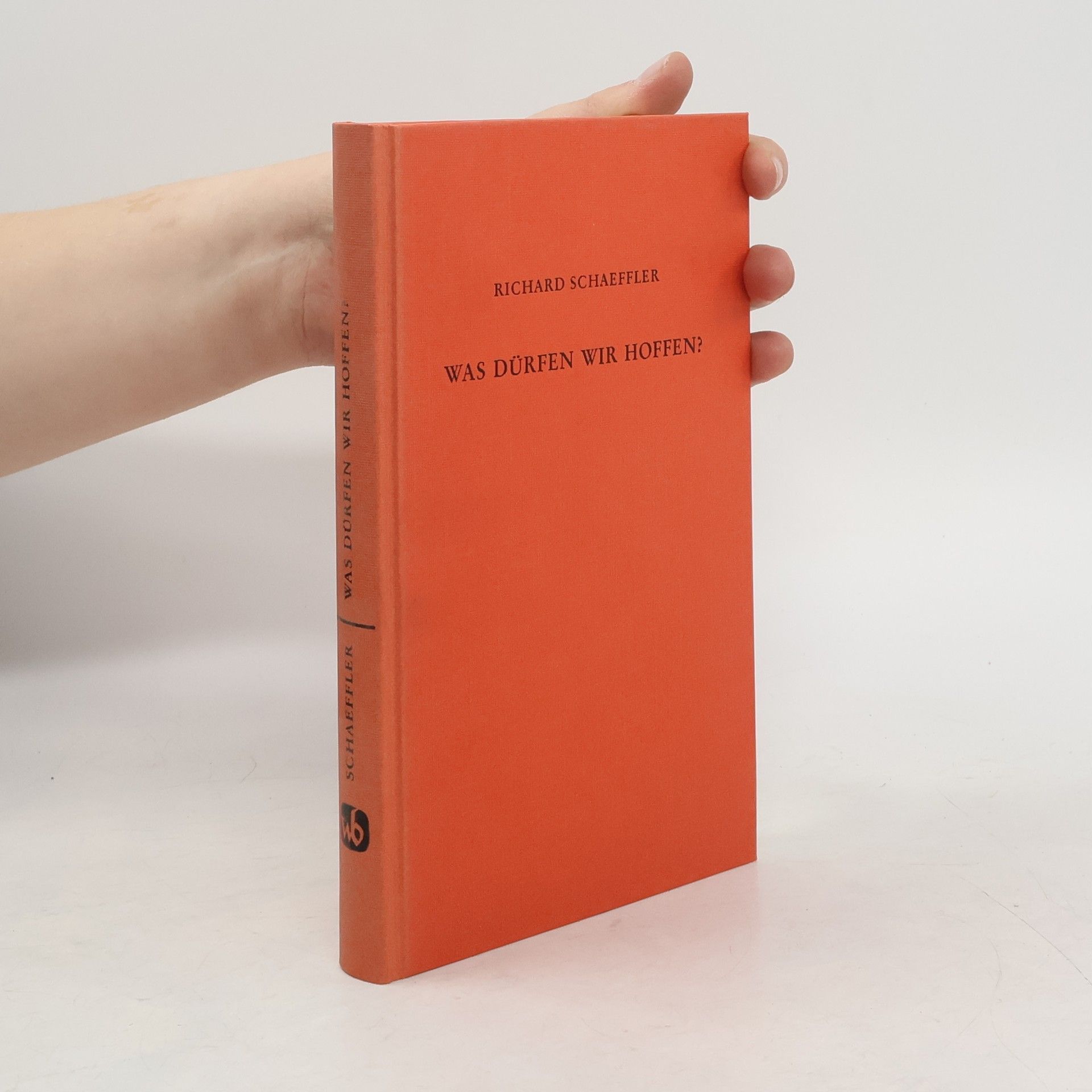
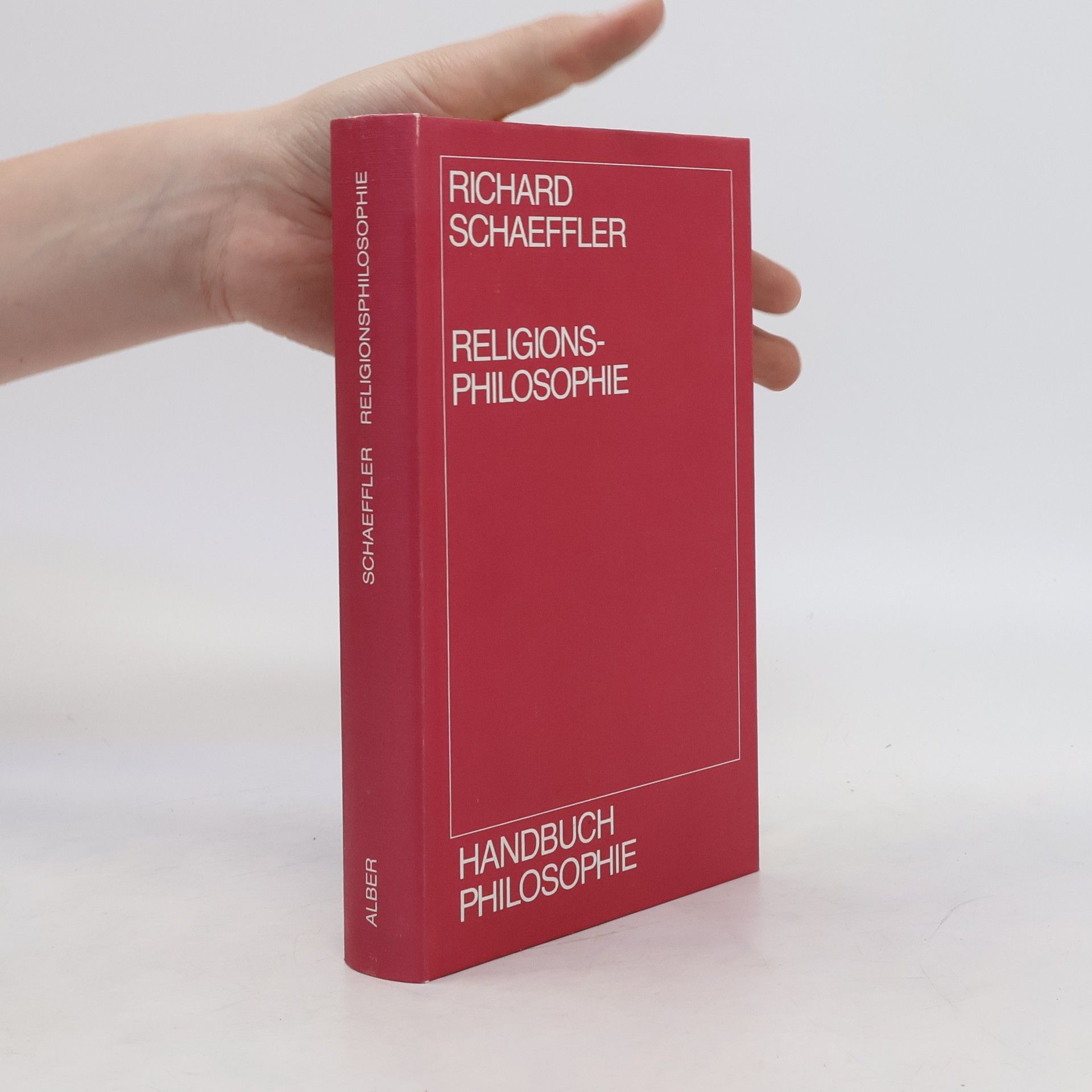

Studien zur Religionstheologie - 2: Christlicher Glaube in der Begegnung mit dem Islam
- 616 Seiten
- 22 Lesestunden
Religionsphilosophie
- 278 Seiten
- 10 Lesestunden
German
Quaestiones Disputatae - 94: Fähigkeit zur Erfahrung
Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens von Gott
- 126 Seiten
- 5 Lesestunden
Was dürfen wir hoffen?
- 333 Seiten
- 12 Lesestunden