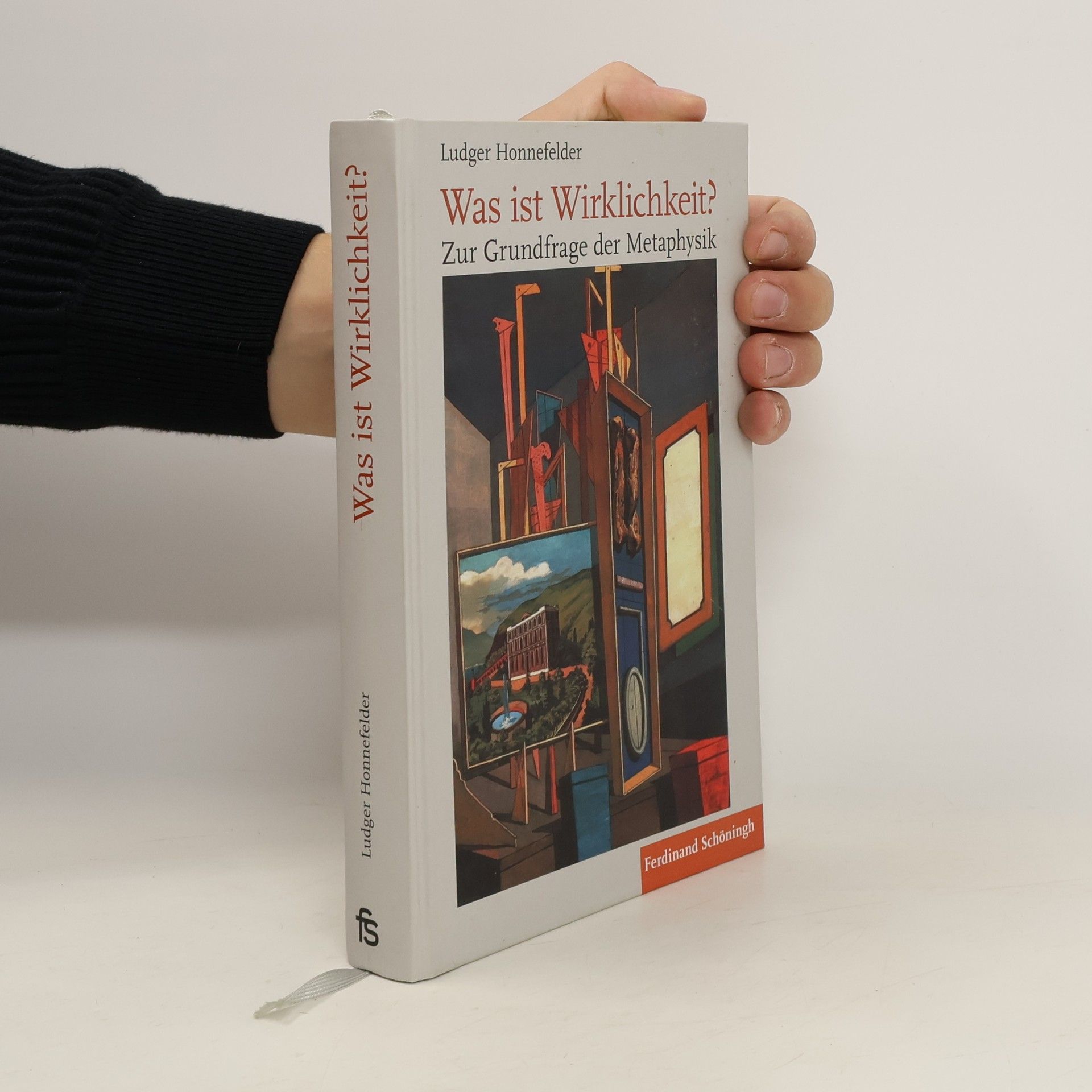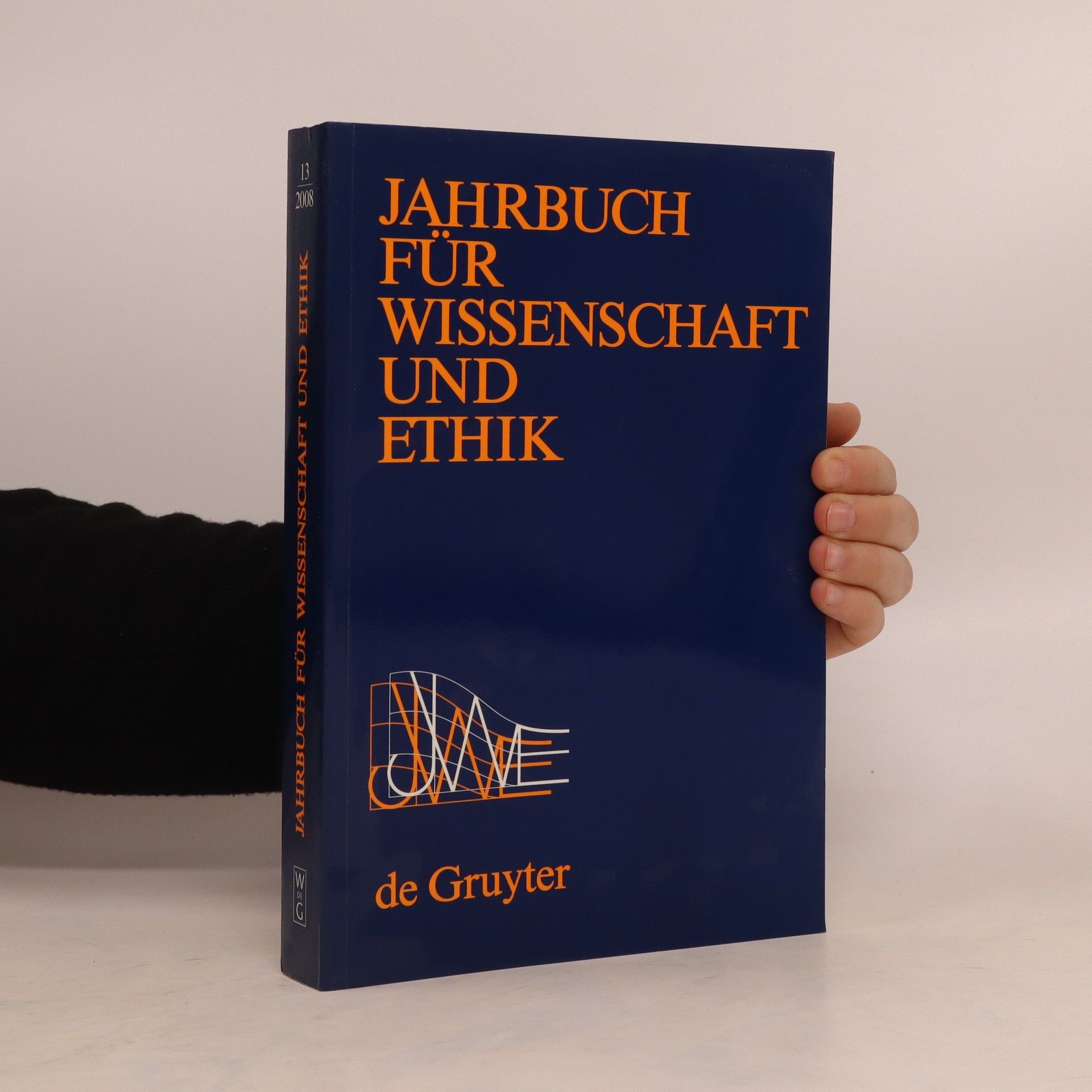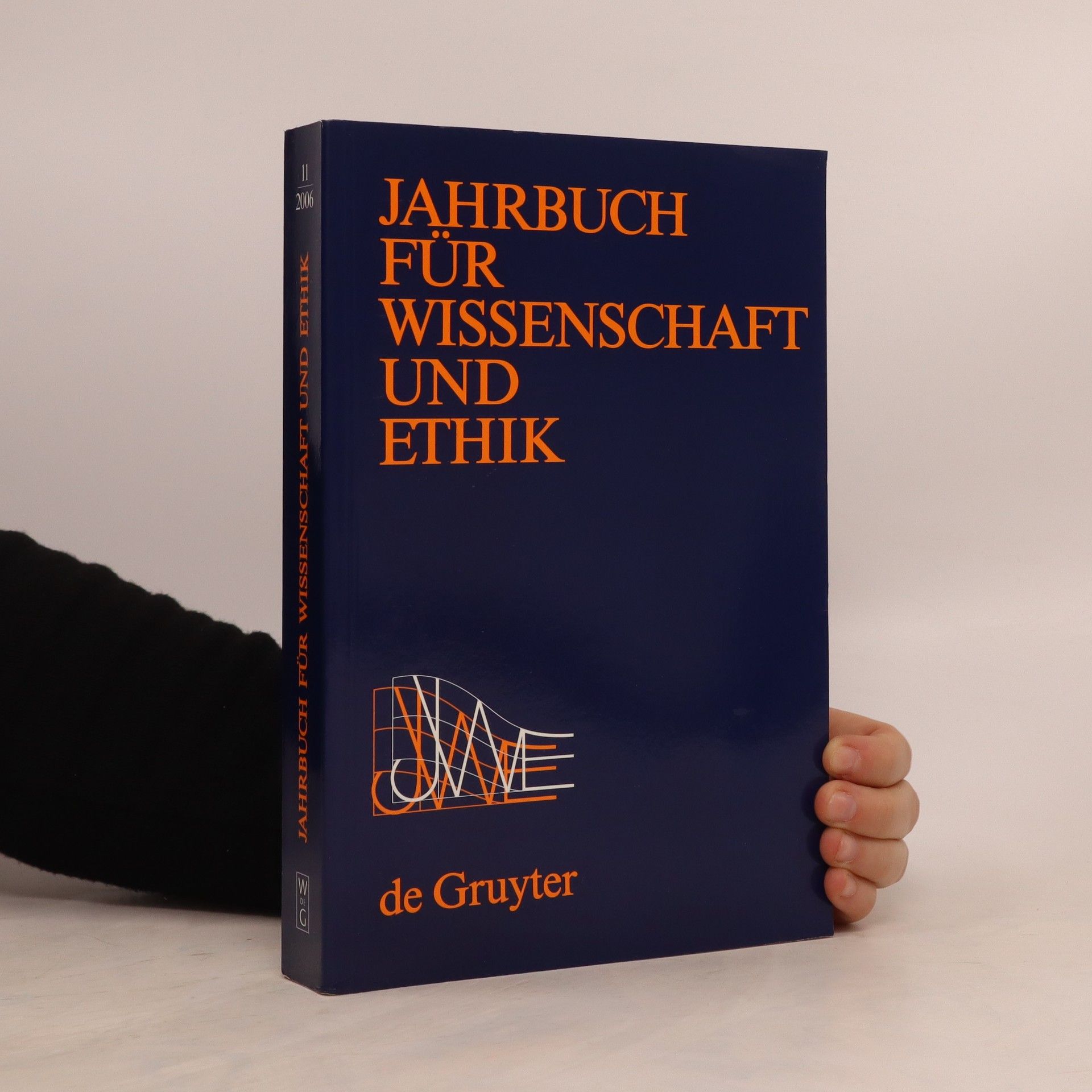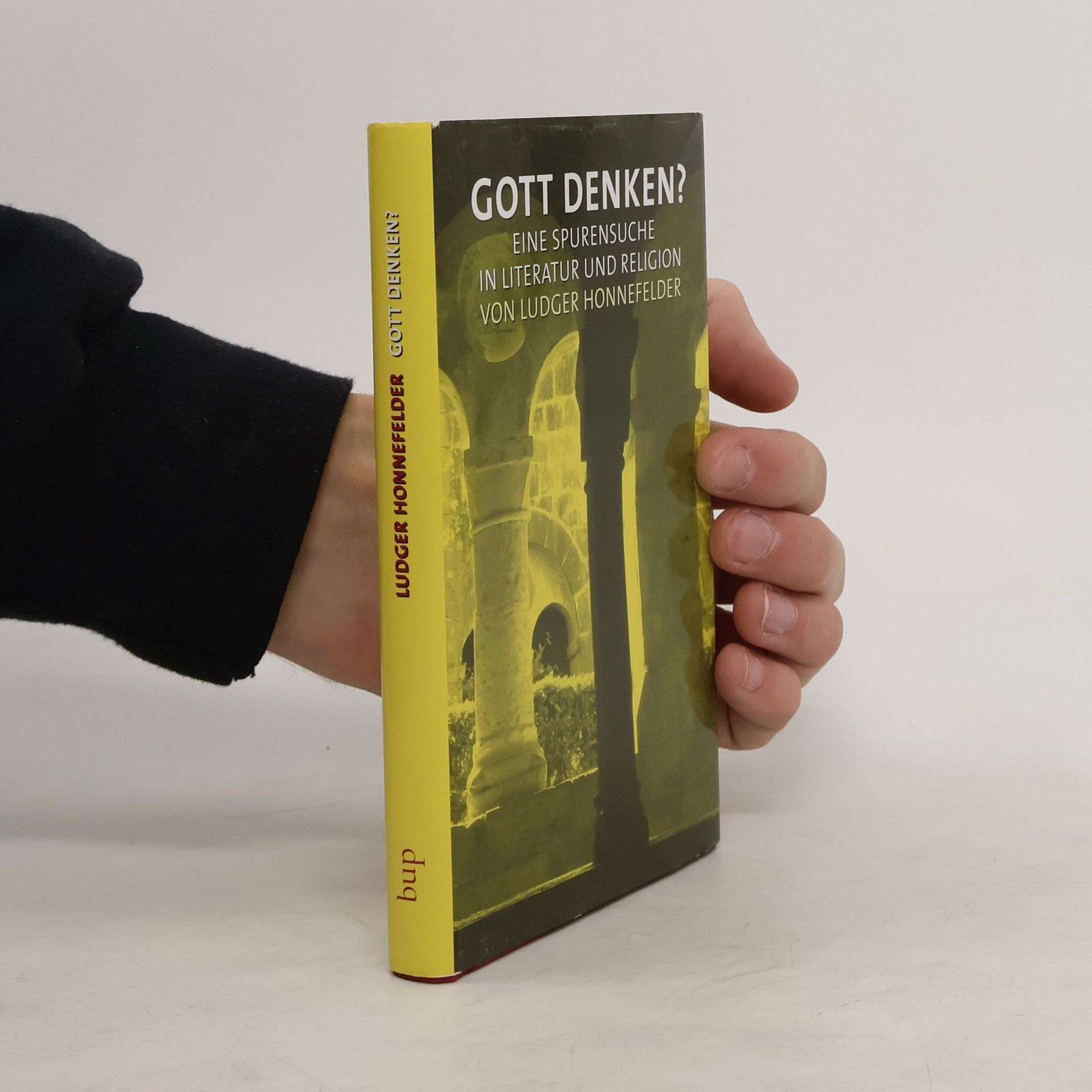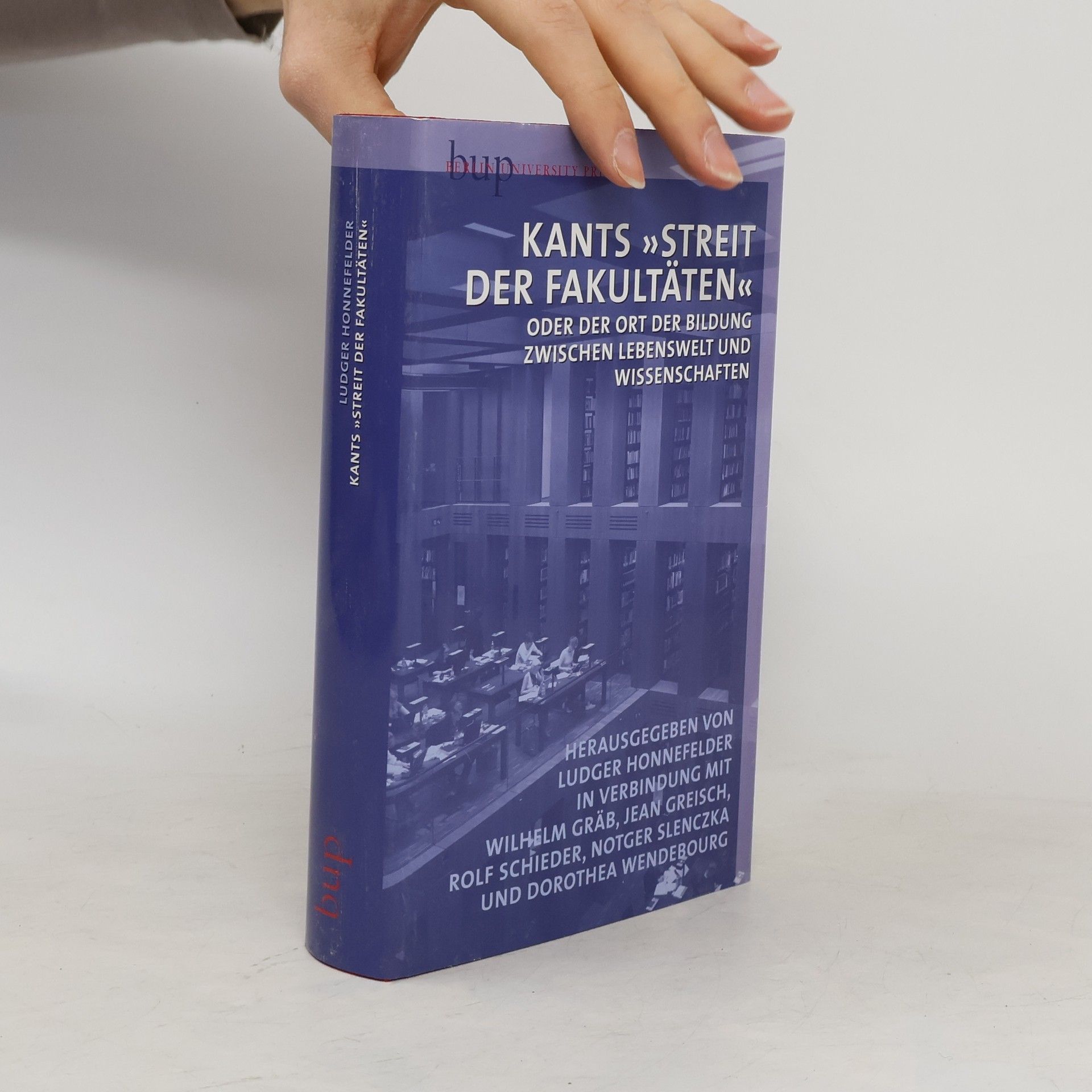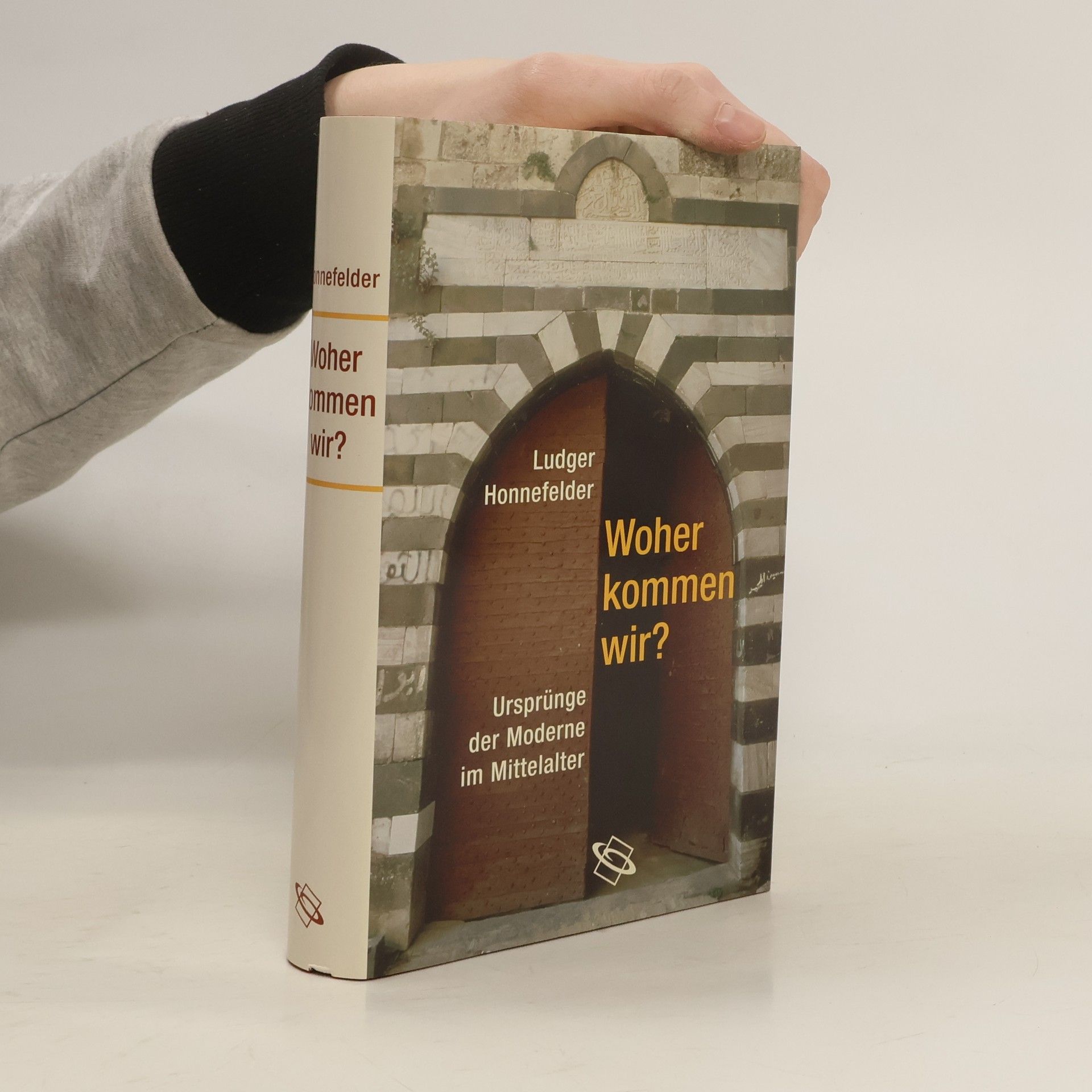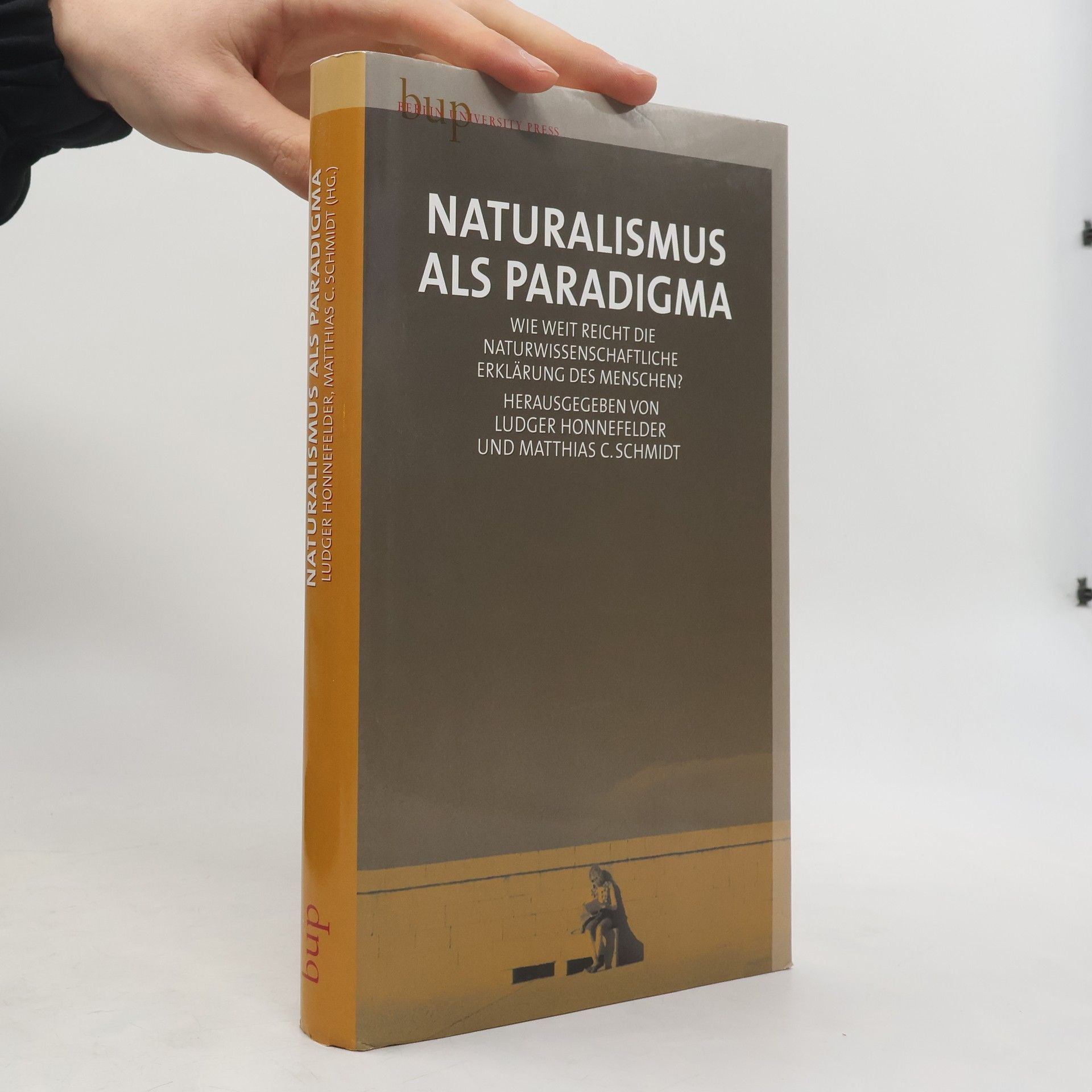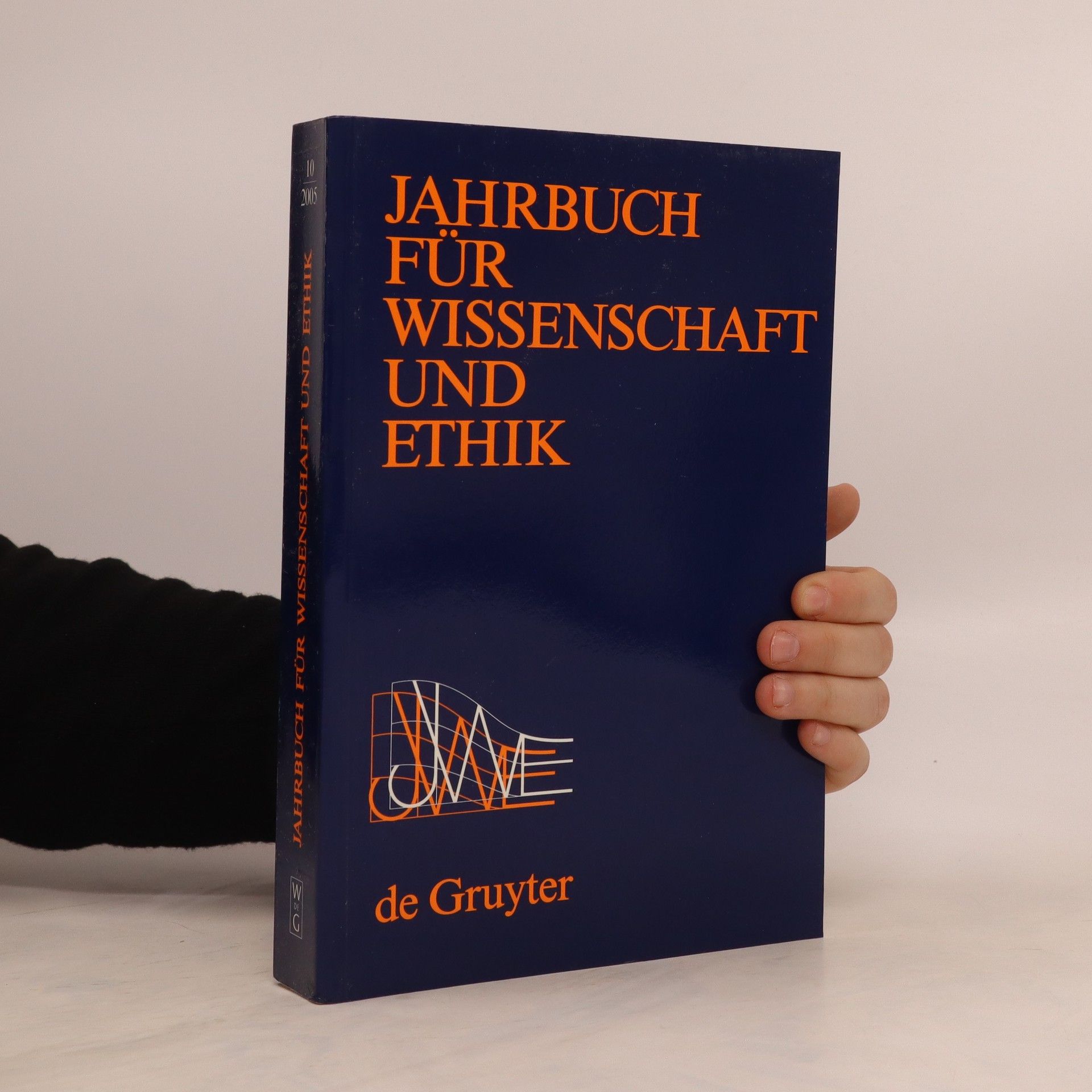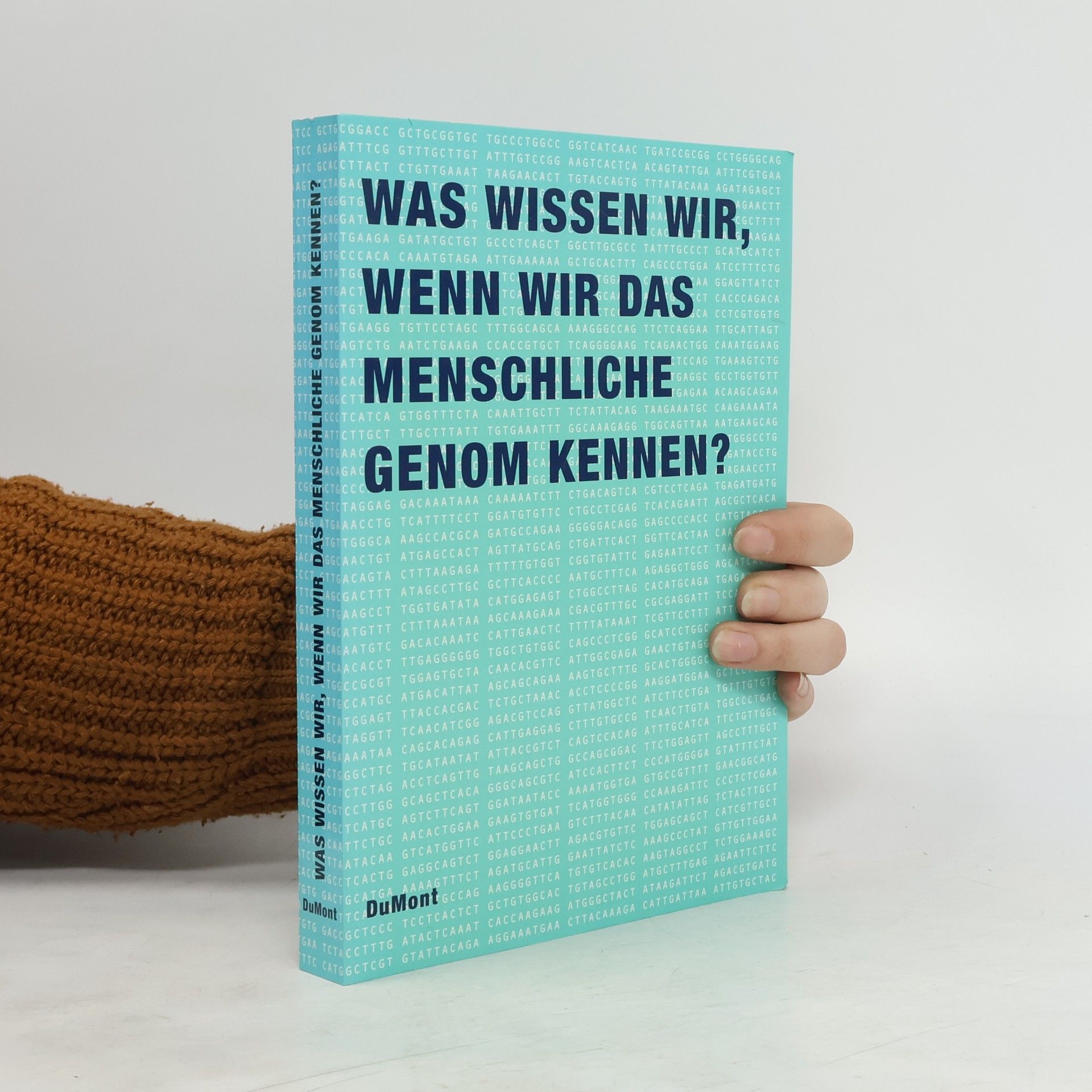Was ist Wirklichkeit?
Zur Grundfrage der Metaphysik
Ist unsere Welt ein Konstrukt oder Wirklichkeit? Was aber heißt überhaupt »Wirklichkeit«? Die Debatte über Realität und Realismus bewegt die Philosophie seit Beginn ihres Fragens. Ludger Honnefelder ist der Frage nach der Realität unter Einbeziehung ihrer Entwicklung in der Geschichte der Philosophie nachgegangen. Der jüngste Streit um den »Neuen Realismus« hat einen Vorgänger in den philosophischen Debatten des 13. und 14. Jahrhunderts. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen die Fragen, in welchem Sinn wir von Realität sprechen, was wir unter Existenz verstehen und wie sich dieses Verständnis darstellt, wenn wir von einer Kontingenz der Welt ausgehen. Im Licht der neueren sprachanalytischen Metaphysik zeigt sich die Brisanz dieses »zweiten Anfangs der Metaphysik«, wie wir ihm bei Autoren wie Albert dem Großen, Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus begegnen. Ihre Lösungen werfen – wie die Beiträge des Bandes zeigen – neues Licht auf die Gegenwartsdebatte.