Geburt des Ethos aus dem Pathos
Wege einer responsiven Phänomenologie
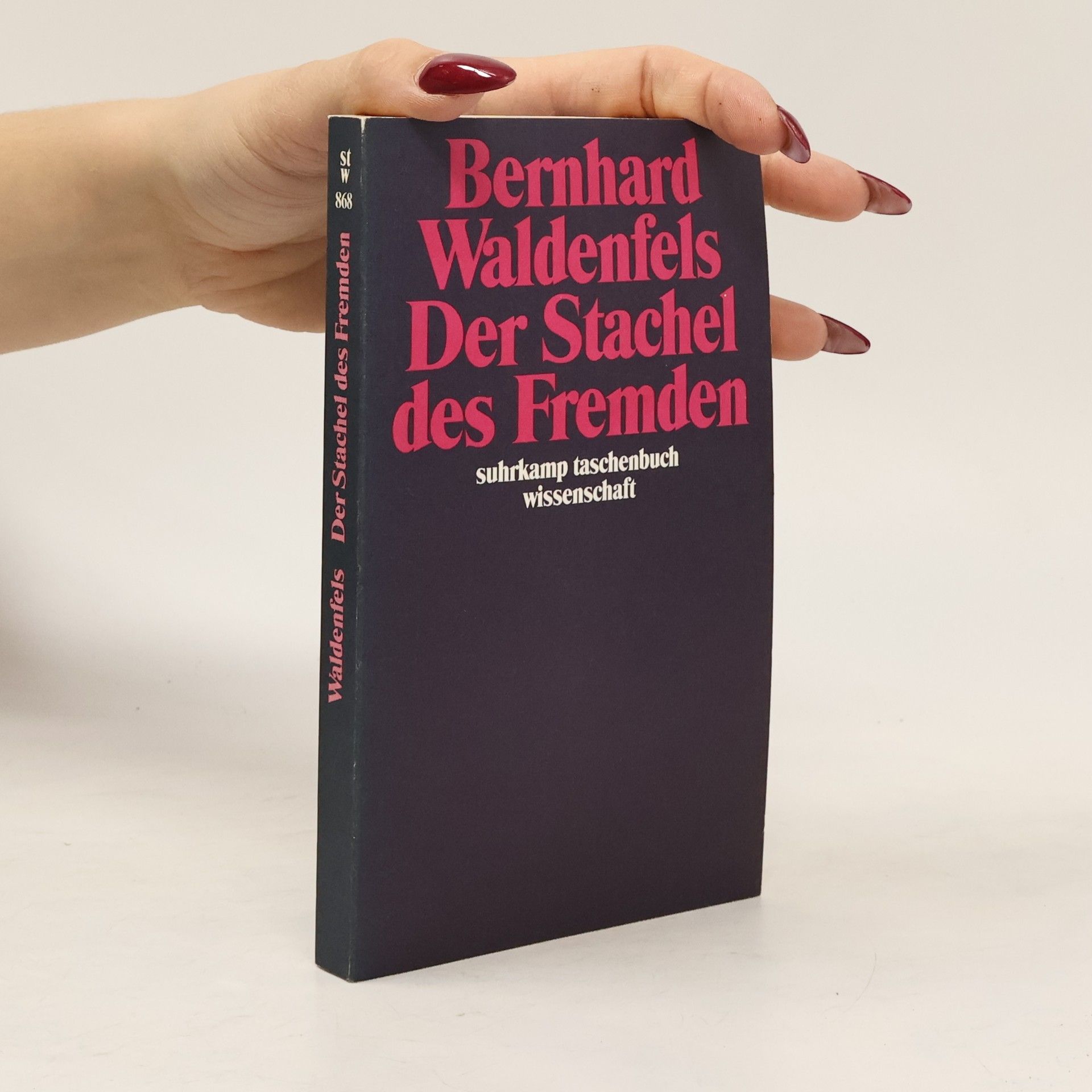

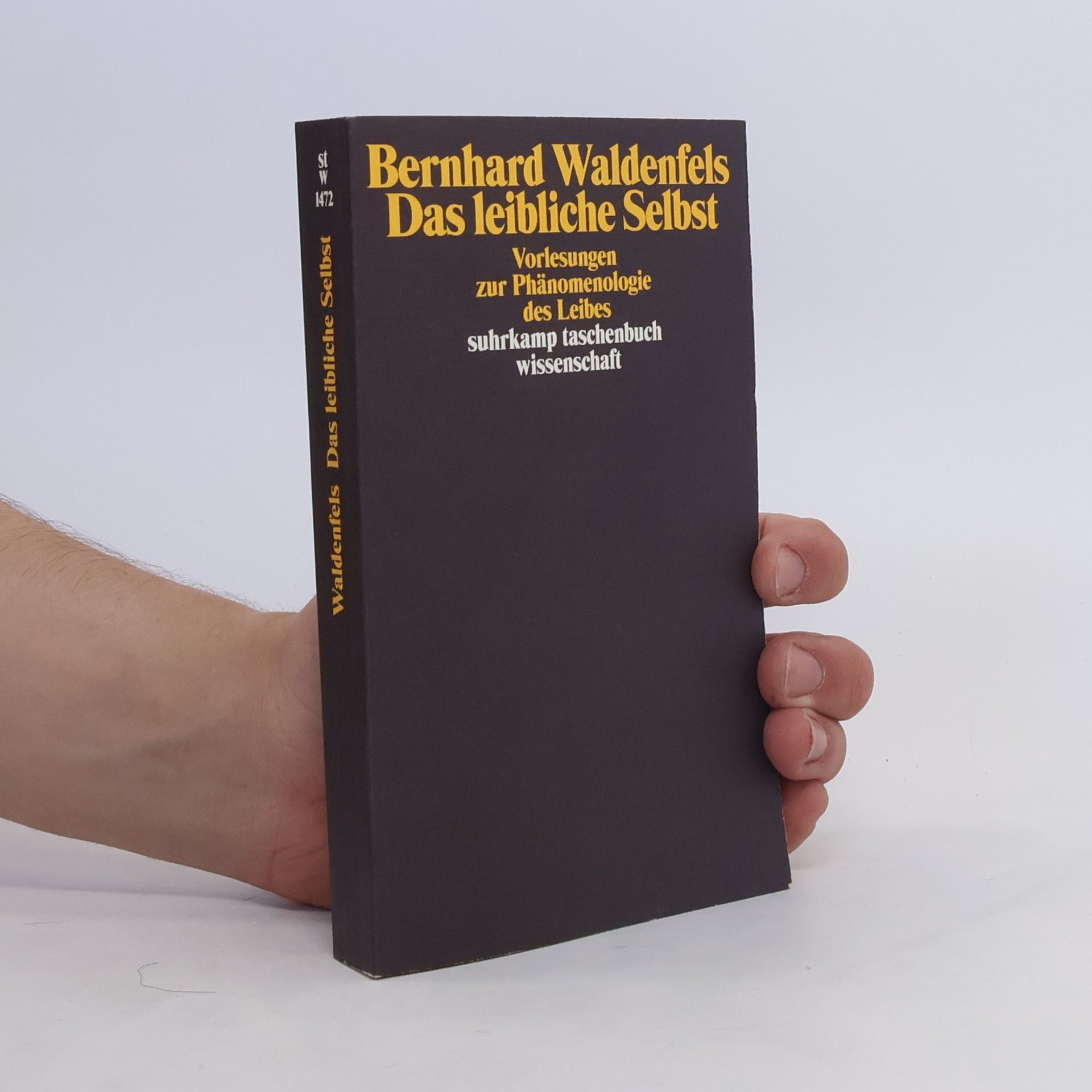
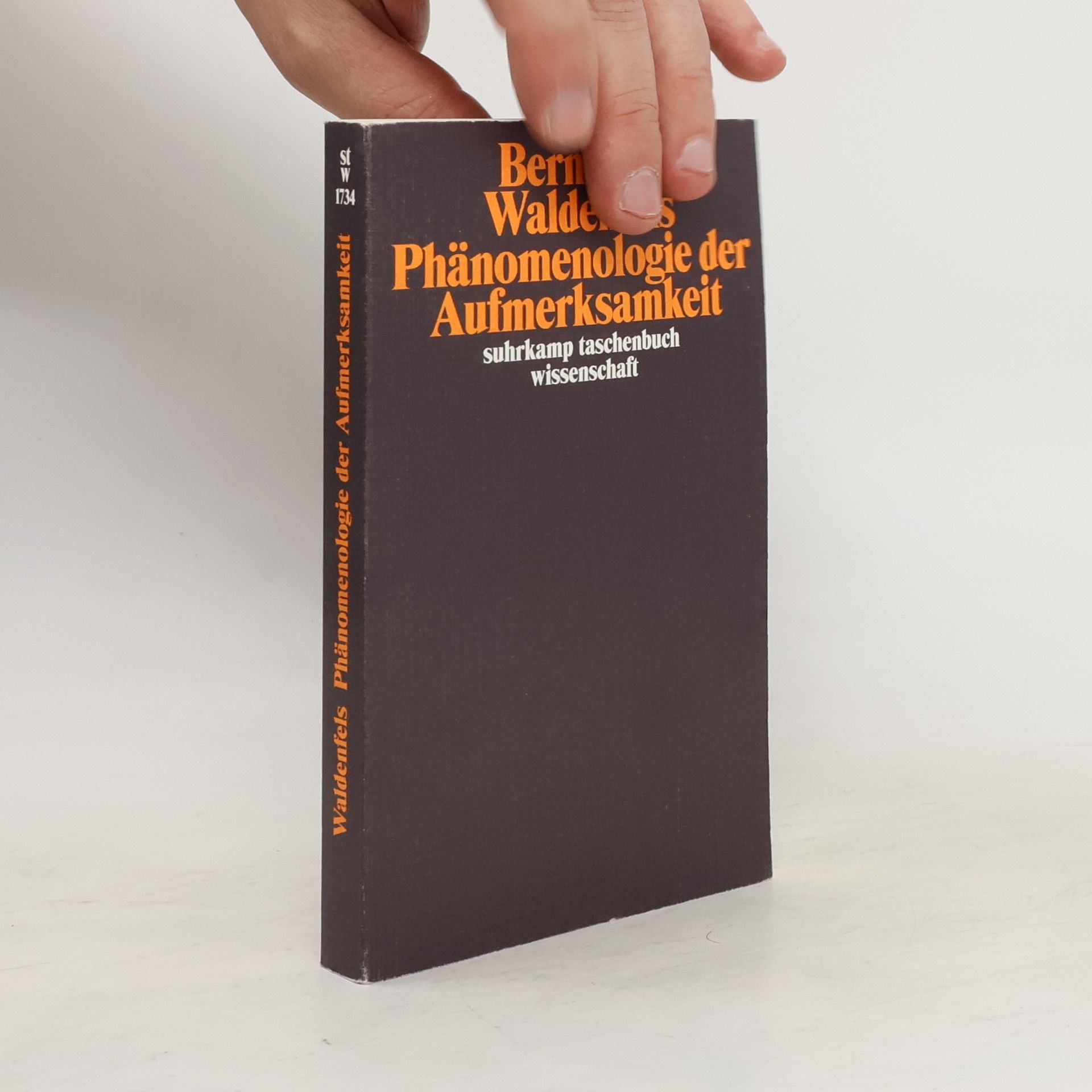


Wege einer responsiven Phänomenologie
Herausforderungen der Phänomenologie
Das Reisetagebuch bietet einen einzigartigen Einblick in die phänomenologische Bewegung durch weltweite Forschungs- und Lehrkontakte. Es verbindet interkulturelle Aspekte aus Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Religion und beleuchtet das Alltagsleben in verschiedenen Städten. Bekannte Denker wie Boulez und Derrida sowie literarische Größen wie Joyce und Kafka werden in ihrem städtischen Kontext betrachtet. Die Erkundungen führen durch bedeutende Orte der Geschichte, von den Straßen des schwarzen Harlems bis zu Gedenkstätten in Auschwitz und Kiew, und reflektieren die Ränder Europas in Städten wie Istanbul und Jerusalem.
Centrálnymi témami fenomenológie cudzieho sú podľa Bernharda Waldenfelsa poriadok, pátos, odpoveď, telo, pozornosť a interkulturalita. Ako výnimočné sa vynára cudzie vo forme narúšania, odklonov a nadbytkov vzhľadom na hranice poriadkov. Tým sa kladie otázka, ako sa dostaneme k cudziemu bez toho, aby sme ho zbavili jeho ostňa. Z toho vychádza responzívny charakter fenomenológie, ktorý vychádza za intencie a pravidlá v udalostiach a nárokoch. Odpovedajúce Ja sa predstavuje ako telesné Ja, ktoré nikdy nie je celkom pri sebe samom. Cudzie začína vo vlastnom dome. Začína už pri pozornosti, keď nás niečo zaujme. A nekončí napokon pri interkulturalite, ktorá je výzvou aj pre filozofiu. Globálne myslenie sa pritom nedá ani očakávať, a ani želať. Pokus prekročiť hranice bez toho, aby sme ich odstránili, patrí k dobrodružstvám cudzieho medzi kultúrami. Fenomenológia cudzieho má svojich predchodcov v autoroch ako M. Bachtin, S. Freud a H. Maus, ale aj I. Calvino, F. Kafka, R. Musil a P. Valéry.
Zwischen Logos und Pathos
Pathisches, das uns widerfährt, erfordert Antworten, duldet aber kein endgültiges Schlusswort. Platonische Dialoge sind Zwischenreden, deren Ränder, Brüche und Abgründe sich in keiner Lehre resümieren lassen, wie Bernhard Waldenfels in seinem Platon-Buch zeigt. Dass die leibhaftige Praxis der Rede ihren Gehalt übersteigt, zeigt sich in den Motiven der sokratischen Geburtshilfe, der Polyphonie der Rede, der Verführung durch Worte, der Käuflichkeit der Lehre, der Triebkraft des Eros, der Heilung durch Besprechung, den Einbrüchen der Gewalt, der Gastlichkeit und den Tieren als Spiegel- und Zerrbilder des Menschen. Das Fremde ist ein Widerhall der sokratischen Atopie.
Hyperbolische Erfahrungen sind Steigerungsformen, in denen das, was sich zeigt, über sich selbst hinausgeht. Hyperphänomene überqueren Schwellen des Fremden, ohne sie zu überwinden. Sie tauchen in vielerlei Gestalt auf. Als Unendliches, Unmögliches, Unsichtbares oder Unvergessliches sprengen sie den Rahmen der Erfahrung. In der offenen Form von Gabe, Stellvertretung, Vertrauen und Gastlichkeit knüpfen sie soziale Fäden, die der normativen Regelung entgleiten und in den Exzessen der Gewalt zu zerreißen drohen. In der Fremdheit des Religiösen erreicht die Transzendenz ein eigenes, aber auch strittiges Gewicht. Methodisch verlangt die Hyperbolik nach einer indirekten Beschreibung, die aufzeigt, was sich dem direkten Zugriff entzieht. Sie bewegt sich an den Rändern der Phänomenologie.
Wo bin ich und wann lebe ich? Wer so fragt, fühlt sich nicht völlig am Platz. Orts- und Zeitverschiebungen bedeuten, daß Eigenort und Eigenzeit von Fremdheit gewissermaßen umschattet sind. Es besteht eine Spannung zwischen den Orten und Zeiten, in denen wir uns leiblich befinden, und den Raum- und Zeitstrukturen, in die sich unsere Erfahrungen einordnen. Diese Spannung durchzieht den alltäglichen Wechsel von Erwartung und Erinnerung, von Überraschung und Gewöhnung, von sozialer Nähe und Ferne. Sie prägt den Kontrast von Weltläufigkeit und Ortsansässigkeit, die Orientierung anhand von Karte, Uhr und Kalender sowie den Einfluß von Körperzeit und Körperraum. Eine Weise, sie erscheinen zu lassen, sind die Orts- und Zeitexperimente der Bühnenkunst. Die Zeit entdecken wir im Raum, aber die Wiederkehr des Raumes gibt auch der Zeit ein neues Gepräge.
Die Aufzeichnungen, die den Denkweg des Autors über 25 Jahre hin begleiten, enthalten Splitter aus der Werkstatt, Gespräche mit Philosophen der Gegenwart und Reaktionen auf Zeitereignisse. Der Text schillert zwischen Denktagebuch, Skizzenbuch, Lesebuch, Merkheft, Aufmerkbuch und stiller Korrespondenz. Den Kern bilden Gedanken, deren Konturen sich erst herausbilden. Es spannen sich Fäden von der „Ordnung im Zwielicht“ (1987) über das „Antwortregister“ (1994) und die „Bruchlinien der Erfahrung“ (2002) bis zu den „Schattenrisse der Moral“ (2006). Ringsum öffnen sich Felder der Kunst, der Wissenschaften, der Politik oder der Religion, die den Nährboden abgeben für philosophische Ideen. Es häufen sich Augenblickseinfälle, in denen lang Gesuchtes, aber auch Abgelegenes, Peripheres, Störendes überraschend zutage tritt. Den Einfällen haftet vielfach ein lokales Kolorit an. Gedanken, die in die Quere kommen, haben nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihren Ort. Schließlich mischen sich die Stimmen von Gefährten und Kontrahenten ein.
Beherzigt man Nietzsches Mahnung, die Moral selbst als Problem zu fassen, so wird der Blick frei für Voraussetzungen, Wirkkräfte und Abgründe der Moral, die nicht selbst moralisch sind. Um den blinden Fleck der Moral zu erkunden, bedarf es einer ethischen epoché. Besondere Angriffsflächen bietet die Standardform einer Gesetzesmoral, der die Rechtfertigung über alles geht, bis ihr die Motivationskraft abhanden kommt. Ihre Aporien und Paradoxien treten unverblümt zutage, wenn man Schlüsselthemen wie Freiheit, Rechtsgleichheit, Macht und Gewalt heranzieht. Diesseits und jenseits der Moral zeigen sich ethische Überschüsse in Form von Tugendmustern, Motivationen, Leidenschaften oder Gesten des Gebens mitsamt einer religiösen Aura. Es begegnen uns fremde Ansprüche, die weder einem allgemeinen Sollen noch einem individuellen Wünschen gehorchen. Also nicht nochmals Aristoteles gegen Kant, sondern eine eigene Form von responsiver Ethik. Bernhard Waldenfels ist Professor emer. für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
Eine Phänomenologie der Aufmerksamkeit gibt sich weder mit subjektiven Akten noch mit anonymen Mechanismen zufrieden. Sie bewegt sich zwischen Auffallen und Aufmerken in einem Schwerefeld, das die »Gewichte der Dinge« verändert. Wir sind daran beteiligt, aber nicht als autonome Subjekte. Dazu gehören räumliche Szenerien und zeitliche Verzögerungen. Etwas kommt auf uns zu, bevor wir darauf zugehen. Hinzu kommt ein Arsenal aus Techniken, Medien und sozialen Praktiken, das eine ökonomie und Politik der Aufmerksamkeit hervorbringt. Die Verankerung dieser Zwischeninstanzen im Leib, der als Leibkörper auch neurologische Prozesse und das Wirken des Unbewußten einschließt, widersetzt sich der Hypostasierung von Körperkonstrukten, Netzwerken und Machtpraktiken. Aufmerksamkeitskonflikte verweisen auf ein Ethos, das uns mit Unerwartbarem konfrontiert und in einer Beachtung gipfelt, die wir anderen schulden, ob wir es wollen oder nicht.