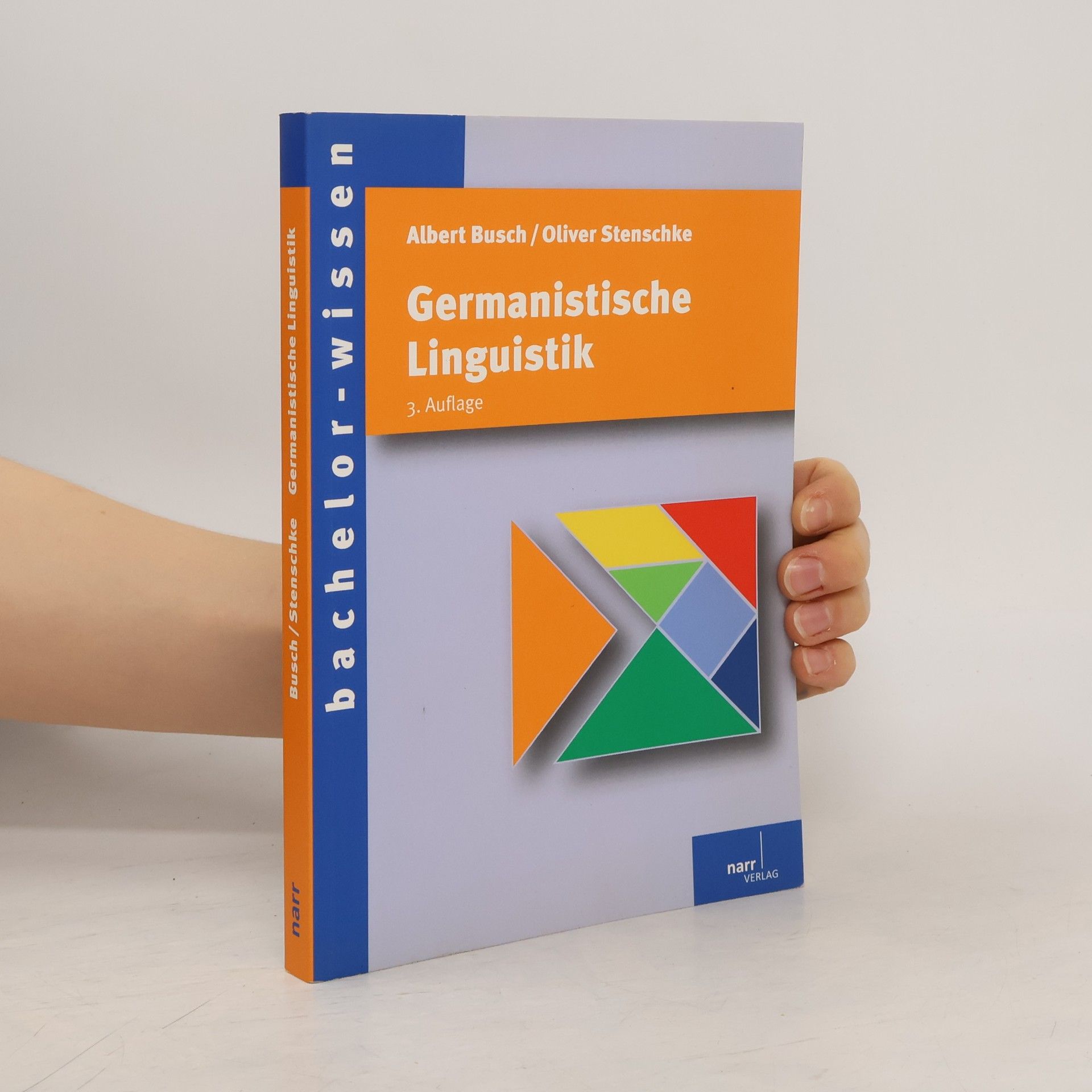Die bewährte Einführung in die germanistische Linguistik ist speziell auf die Bedürfnisse der modularisierten Studiengänge zugeschnitten. Sie ist in 14 Einheiten gegliedert, die sich an einem typischen Semesterplan orientieren und somit direkt für Lehrveranstaltungen im Rahmen eines „Basismoduls Germanistik“ bzw. „Germanistische Linguistik“ verwendet werden können. Sie beziehen sich auf die übergeordneten Themenbereiche „Sprache als System“ und „Sprache im Gebrauch“. Die einzelnen Einheiten dienen zum einen der Vermittlung von Basiswissen, zum anderen dem Erwerb der Kompetenz, dieses Wissen selbständig anzuwenden. Sie sind daher gegliedert in einen wissensvermittelnden Teil mit klar abgesetzten Definitionen und einen Übungsteil. Zu beidem gibt es auf der begleitenden Homepage www. bachelor-wissen. de ergänzende Angebote, mit denen die erworbenen Kompetenzen vertieft werden können. Für die 3. Auflage wurde insbesondere das Kapitel zur Pragmatik gründlich überarbeitet.
Albert Busch Bücher