Ein König wird beseitigt
- 544 Seiten
- 20 Lesestunden
Rare Book
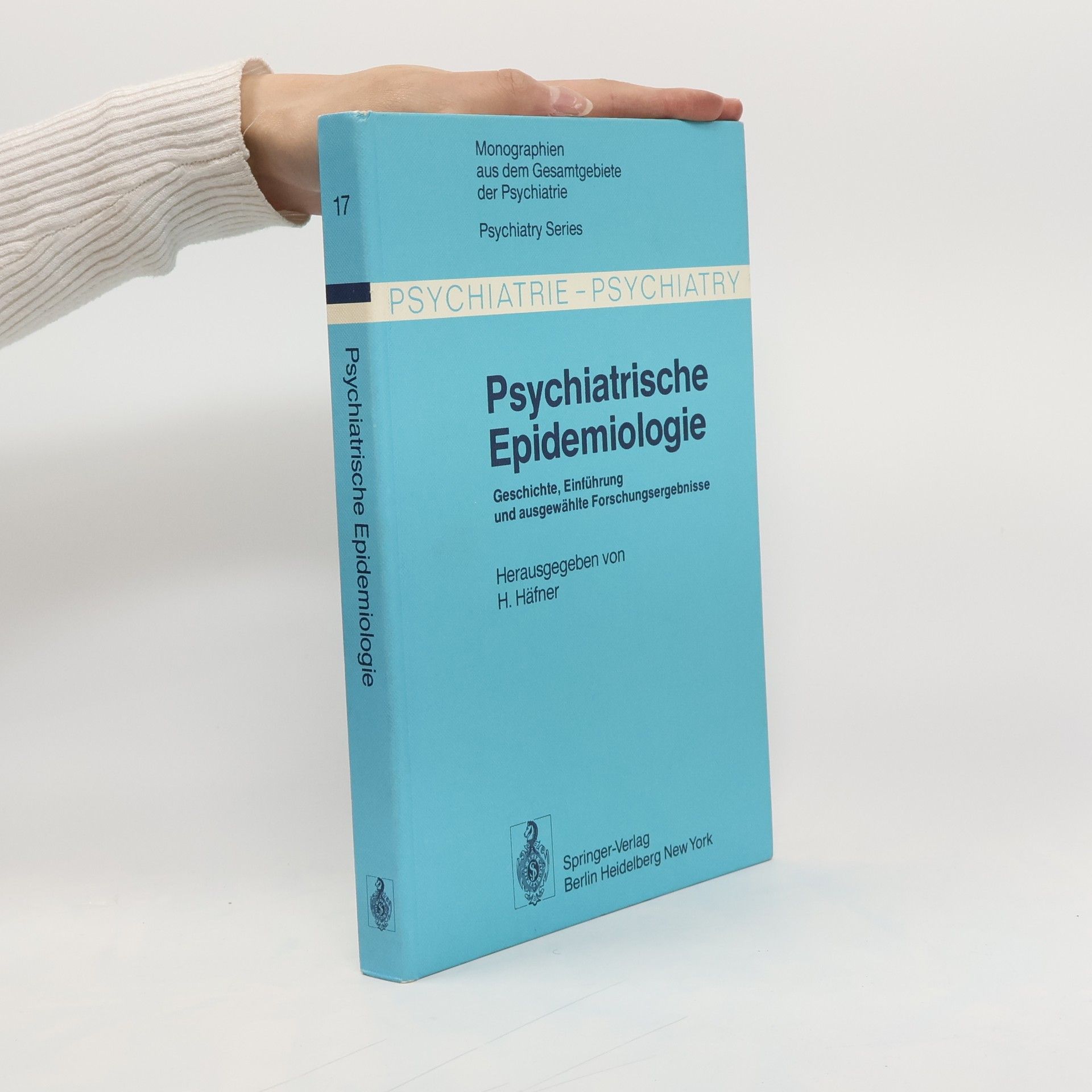
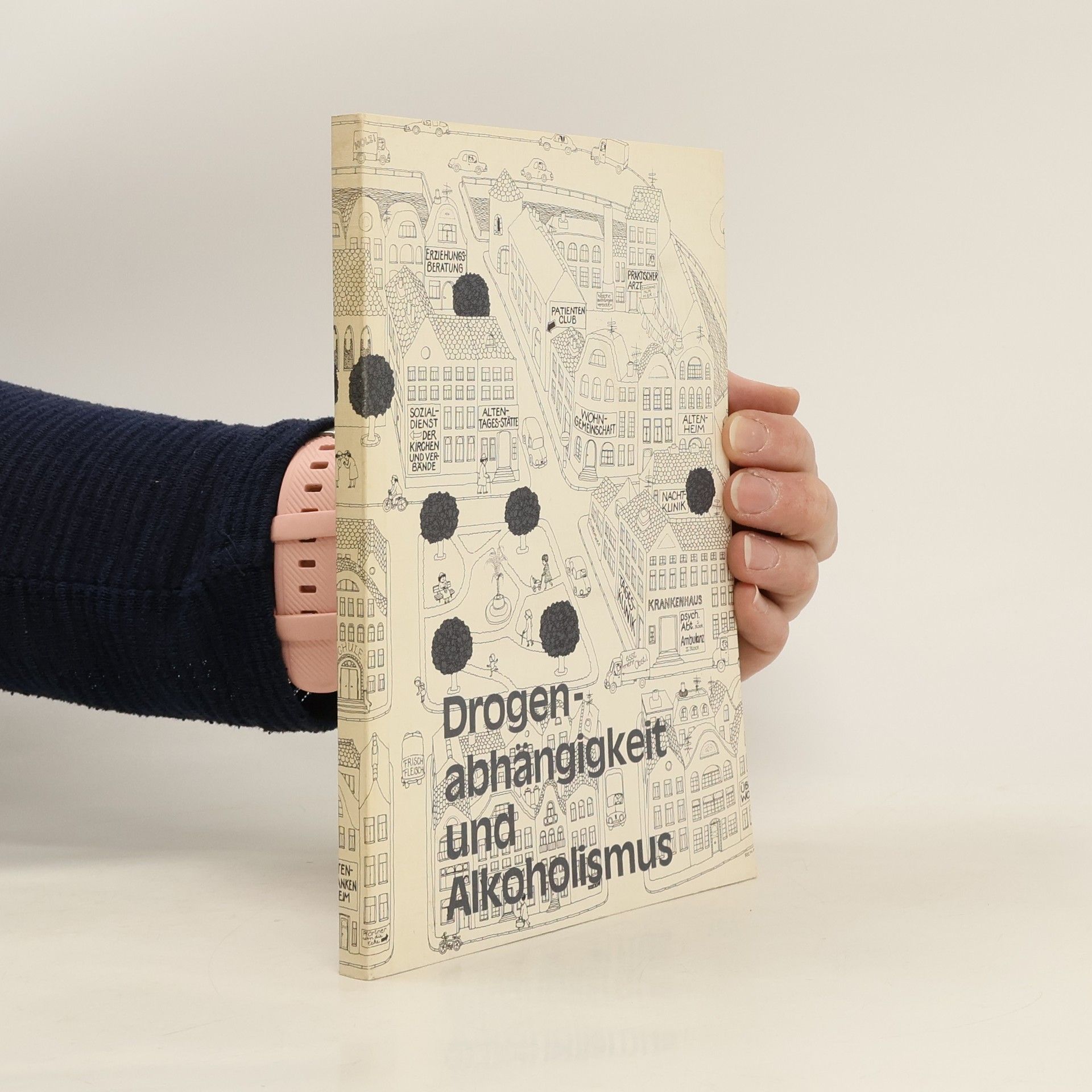



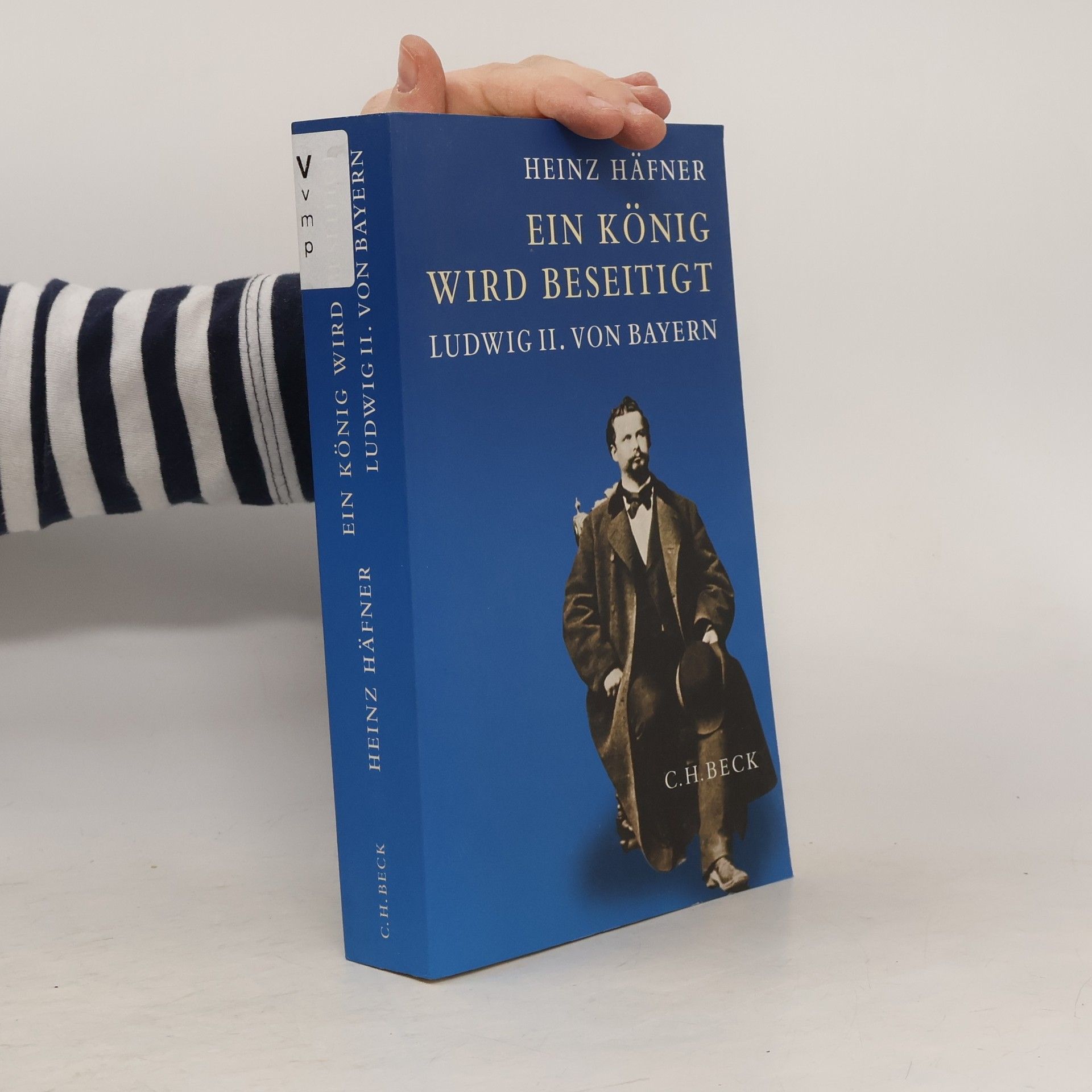
Rare Book
Book by Häfner, Heinz
Das vorliegende Nachschlagewerk bietet einen umfassenden Überblick über die Bereiche Sprachbetrachtung/Grammatik, Orthografie und Interpunktion. Es ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Wortlehre (Morphologie), 2. Satzlehre (Syntax I), 3. Sätze (Syntax II), 4. Rechtschreibung (Orthografie), 5. Zeichensetzung (Interpunktion).OrthoGramm ist aus der Schulpraxis entstanden und entspricht in Systematik und Terminologie der neueren Schulgrammatik. Das Lehrmittel ist aktuell und fokussiert auf das Wesentliche; die wichtigsten Regeln sind übersichtlich dargestellt und mit einprägsamen Beispielen ergänzt. Dies ermöglicht selbstständiges Arbeiten und hilft, komplexe Sachverhalte zu verstehen.OrthoGramm ist auf die Sekundarstufe II und die Erwachsenenbildung ausgerichtet.
Zum Buch Anders als man in vielen Büchern noch heute lesen kann, zerstören schizophrene Erkrankungen den Kern der Persönlichkeit nicht, und sie schreiten auch nicht unaufhaltsam zu einer totalen Demenz fort. Sie weisen jedoch ein hohes Maß an Verschiedenheit und Vielgestaltigkeit ihrer mitunter lebenslangen Verläufe auf. Die Inhalte der scheinbar irrealen Erlebniswelt in der Psychose spiegeln Ängste und Verzweiflung, Hoffnungen und Freuden des Kranken wider. Dieses Buch gibt das aktuelle Wissen über die als Schizophrenie bezeichneten Erkrankungen und vermittelt einen Einstieg in das Verstehen krankhaften Erlebens. Es zeigt Wege und Formen der Behandlung, deren Wirksamkeit und Risiken auf und enthält viele Hinweise zur Bewältigung der eigenen Krankheit und zu einem hilfreichen Umgang mit einem erkrankten Angehörigen oder Patienten.
Geschichte, Einführung und ausgewählte Forschungsergebnisse
Das Interesse an Psychiatrie und epidemiologischen Fragestellungen hat zugenommen, nachdem die psychiatrische Epidemiologie in den deutschsprachigen Ländern über Jahrzehnte in Vergessenheit geraten war. Gründe hierfür waren therapeutische Resignation, Immobilismus im Versorgungssystem und die gescheiterte Hoffnung auf einheitliche Krankheitsursachen. Die Wiederentdeckung der Umweltvariabilität endogener Psychosen und die Beschäftigung mit multifaktoriellen Modellen der Krankheitsentstehung haben neue Fragestellungen eröffnet. Untersuchungen zur Verteilung psychischer Krankheiten und den Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung sowie zu Faktoren, die auf Entstehung, Auslösung, Verlauf und Folgen von Krankheiten Einfluss nehmen, gewinnen zunehmend an Bedeutung für die klinische Psychiatrie sowie für Versorgungsplanung und Gesundheitspolitik. Der vorliegende Sammelband dokumentiert die Entwicklung dieses Fachgebiets in der deutschsprachigen Psychiatrie, stark beeinflusst von anglo-amerikanischen und skandinavischen Vorarbeiten. Zudem präsentiert er erste größere Ergebnisse aus zwei Einrichtungen, die sich auf psychiatrisch-epidemiologische Forschung konzentrieren: dem Sonderforschungsbereich 116 an der Universität Heidelberg und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.
This volume presents the contributions to the third symposium on the "Search for the Causes of Schizophrenia". It opens up new perspectives for schizophrenia Part I focuses on the precursors, onset and early course of schizophrenia, while part II deals with the complex relationship between brain functions assessed by brain imaging and neuropathology and specific psychopathology of schizophrenia at the level of morphological, functional and regional brain abnormalities. Part III presents the associations between brain functions, receptors and schizophrenia at the level of biochemical analyses together with their molecular basis at the level of 31p spectroscopic resonance study of the brain phospholipid metabolism and with PET studies of receptor ligands and regional changes in metabolism.