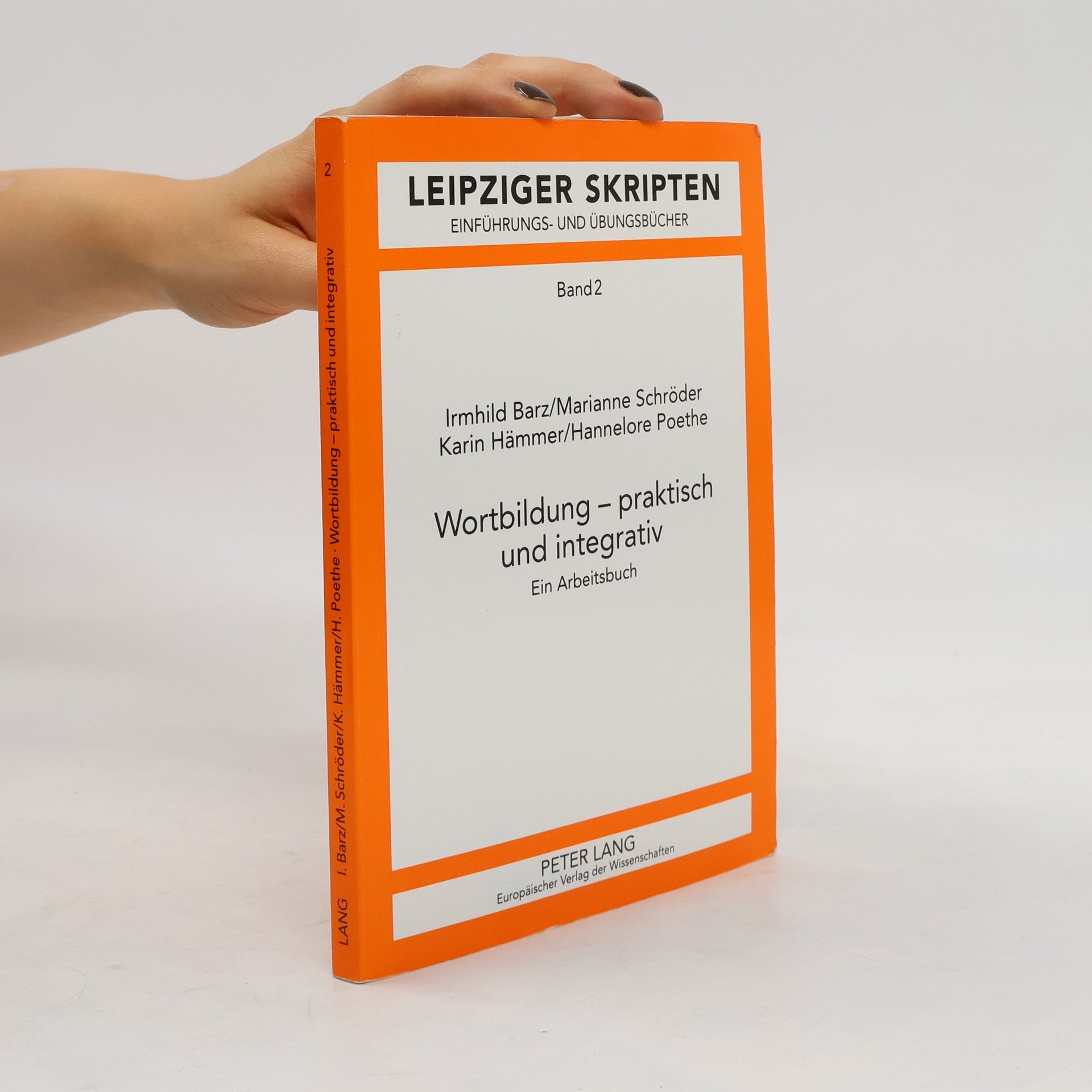Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
- 504 Seiten
- 18 Lesestunden
In einer grundlegenden Überarbeitung der 3. Auflage von 2007 bietet das Werk unter Einbeziehung der neuesten Forschungsliteratur eine aktualisierte Gesamtdarstellung der Wortbildung der deutschen Sprache des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Herausgearbeitet werden die Grundzüge der Wortbildung des Substantivs, Adjektivs, Verbs und Adverbs, wobei sowohl die strukturell-morphologischen als auch die semantischen Parameter der Bildungsmodelle in analytischer und synthetischer Sicht behandelt werden. Im Vordergrund steht das Prinzip synchroner Beschreibung, ggf. ergänzt um sprachhistorische Erklärungen. Neu aufgenommen wurden Kapitel zur Stellung der Wortbildung in der Grammatik sowie zum Verhältnis zwischen Wortbildung und Lexikon. Einige Grundfragen wurden neu entschieden, z. B. die Gliederung der Wortbildungsarten, der wortbildungsmorphologische Status der Verbzusätze und die Gruppierung wortbildungsmorphologischer Paradigmen. Morphosyntaktische Bezüge der Wortbildungsmodelle bekommen ein stärkeres Gewicht. Erweitert wurden das Textkapitel sowie die Darstellung der Fremdwort- und der Kurzwortbildung. Zeitgemäße Beispiele aus journalistischen und belletristischen Quellen sowie aus elektronisch verfügbaren Korpora wurden ergänzt. Ein Sach- und ein Formenregister, beide verbessert, erleichtern die Orientierung im Text.