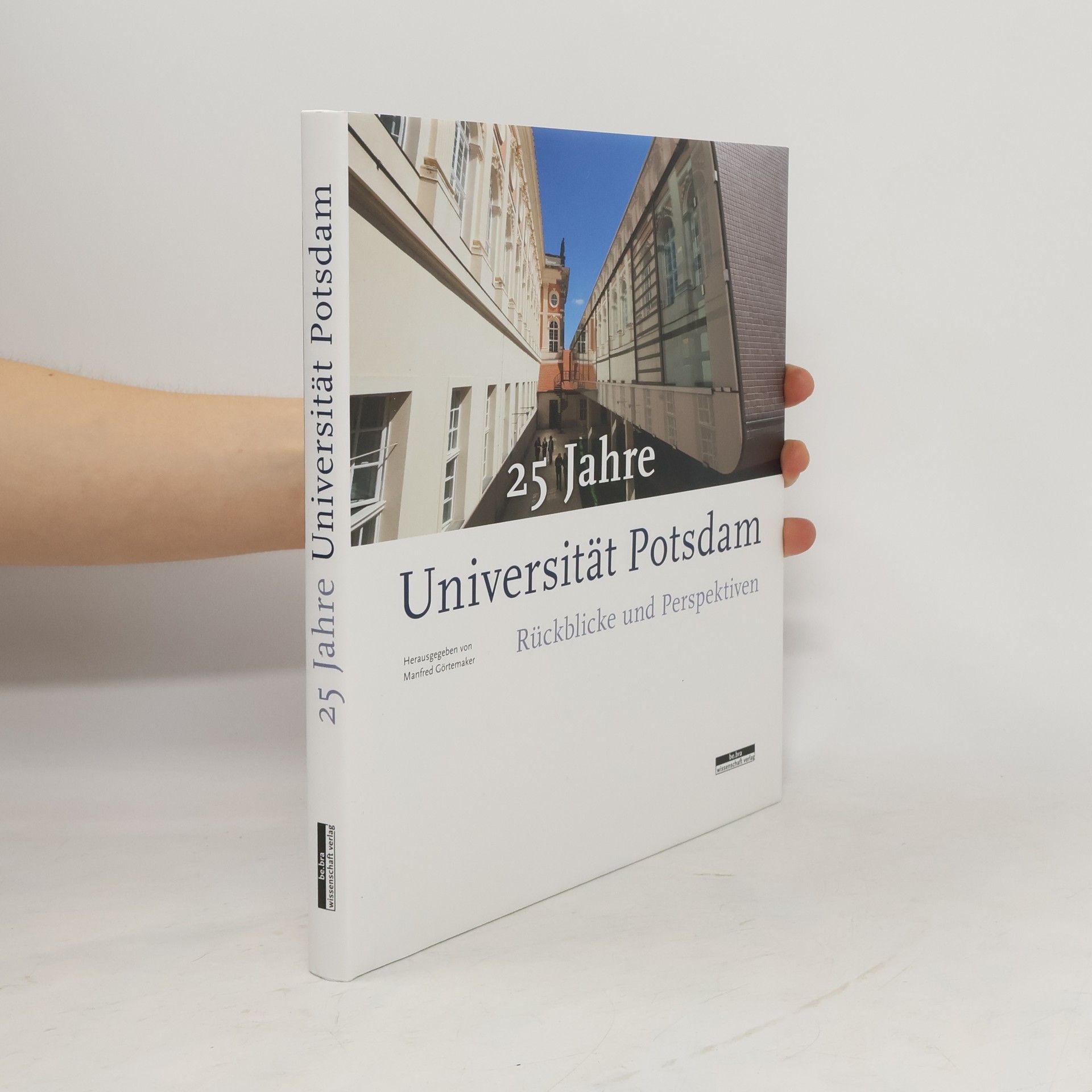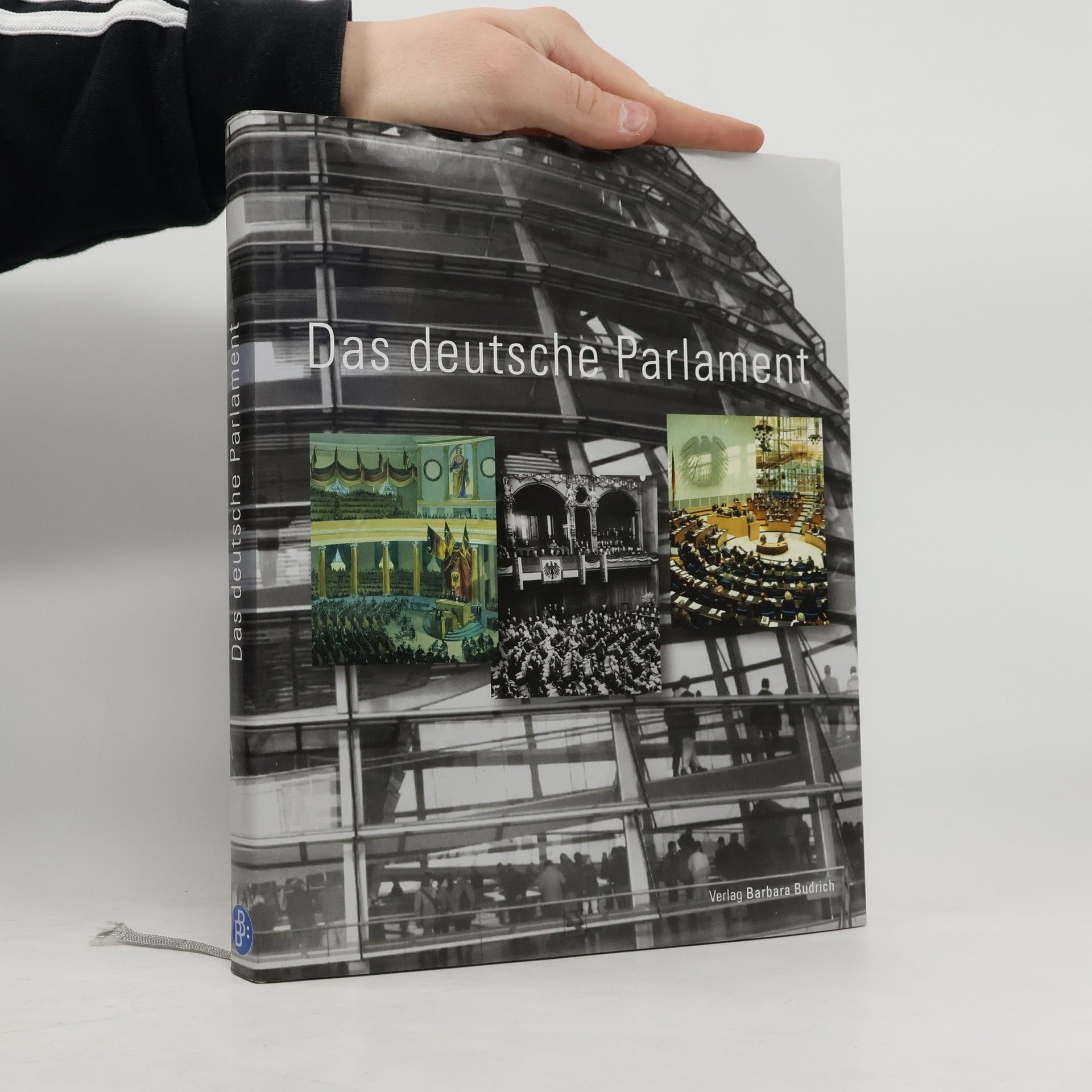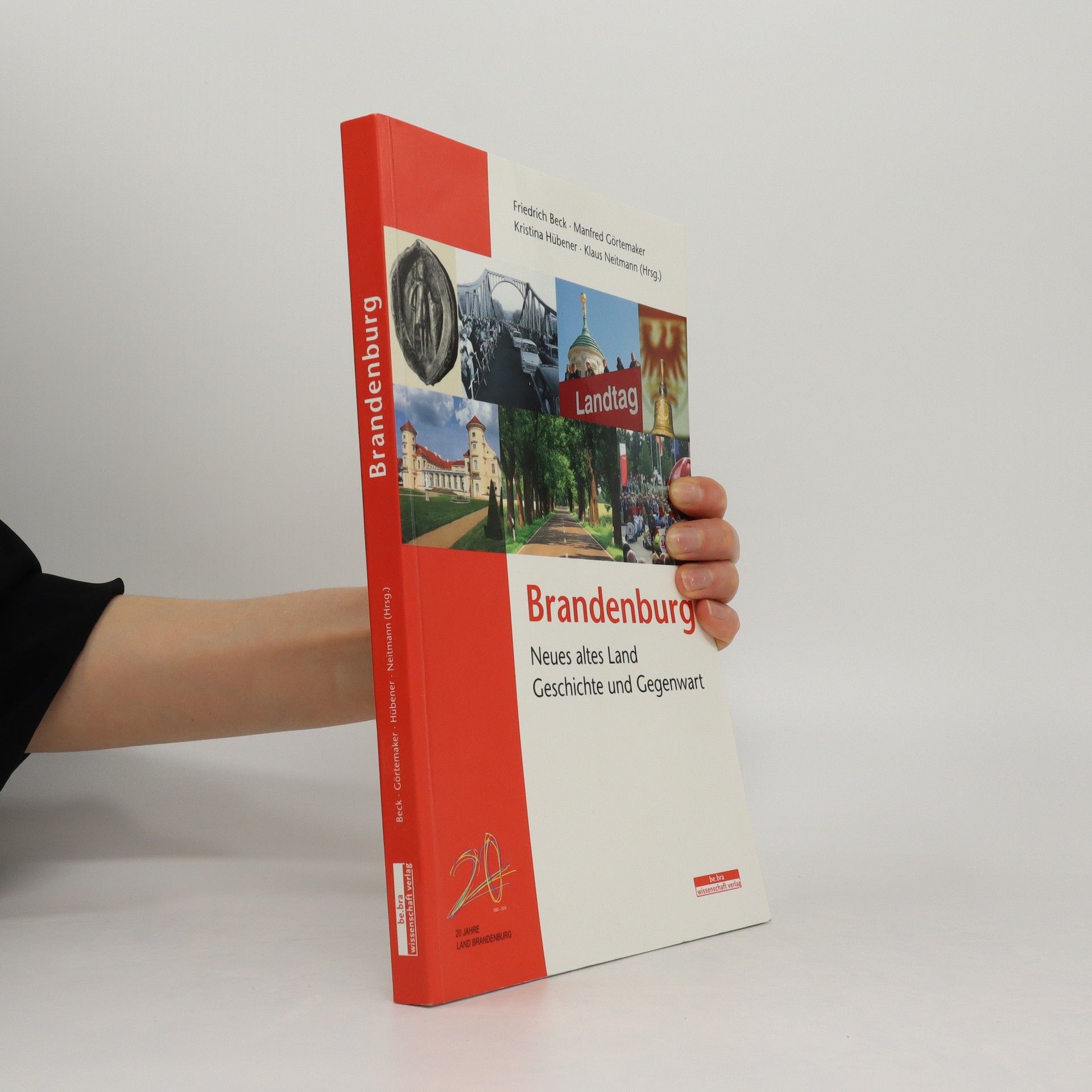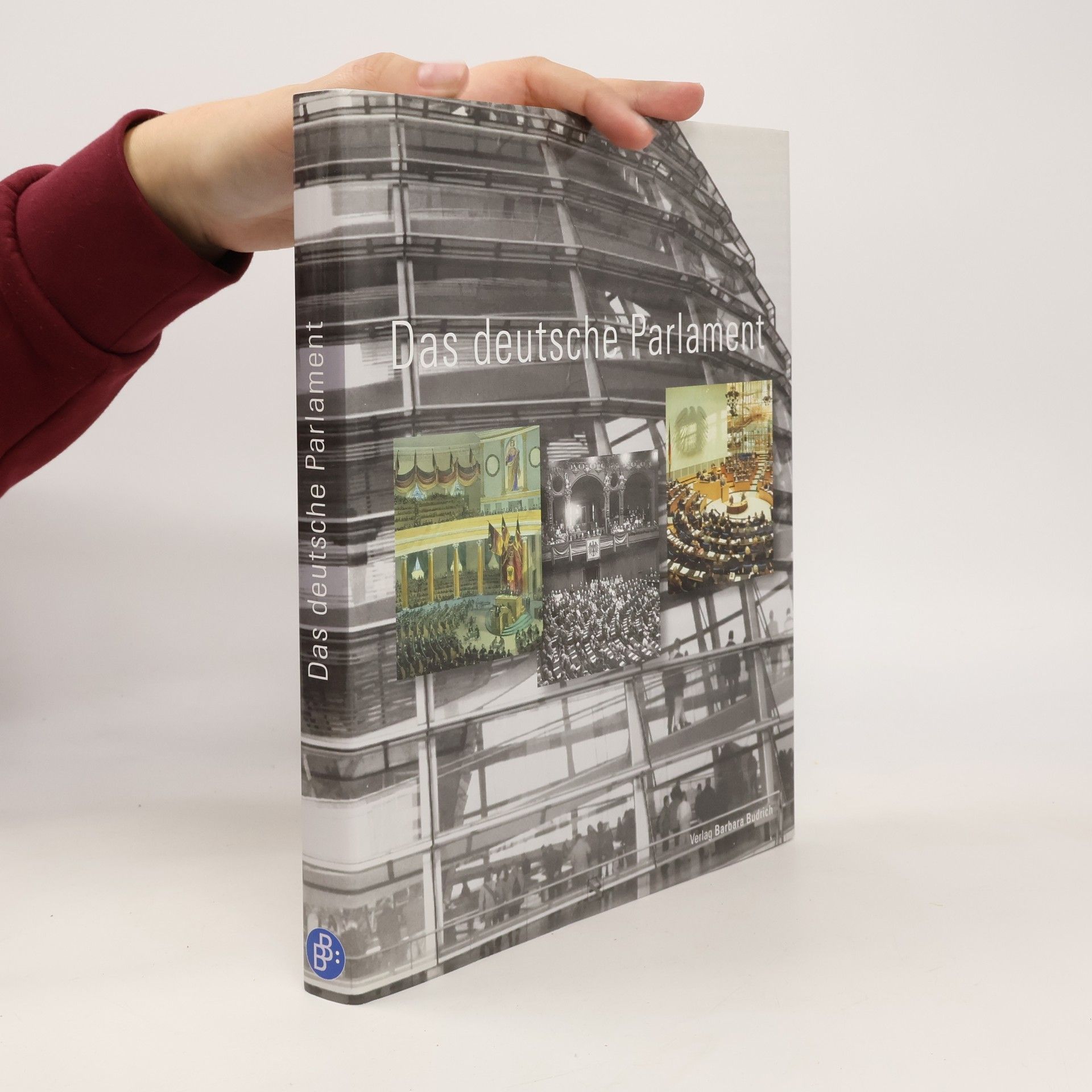Längsschnittanalyse des deutschen Föderalismus im Nationalstaat Der Föderalismus, dessen Wurzeln bis in das Mittelalter zurückreichen, gehört zu den Grundtatsachen der deutschen Geschichte. Dieses historische Erbe spiegelt sich in der heutigen deutschen Staatlichkeit wider, wie sie im Grundgesetz verankert ist und von Bund, Ländern und Kommunen mit Leben erfüllt wird. Renommierte Historiker, Politologen und Rechtswissenschaftler zeichnen in diesem Band die grundlegenden Entwicklungen der Föderalismusgeschichte in Deutschland seit der Gründung des deutschen Nationalstaats (1871) nach. Sie zeigen dabei die Kontinuitäten und Systembrüche deutscher Staatlichkeit auf - vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und den NS-Staat bis hin zur Gegenwart in der Bundesrepublik Deutschland.
Manfred Görtemaker Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
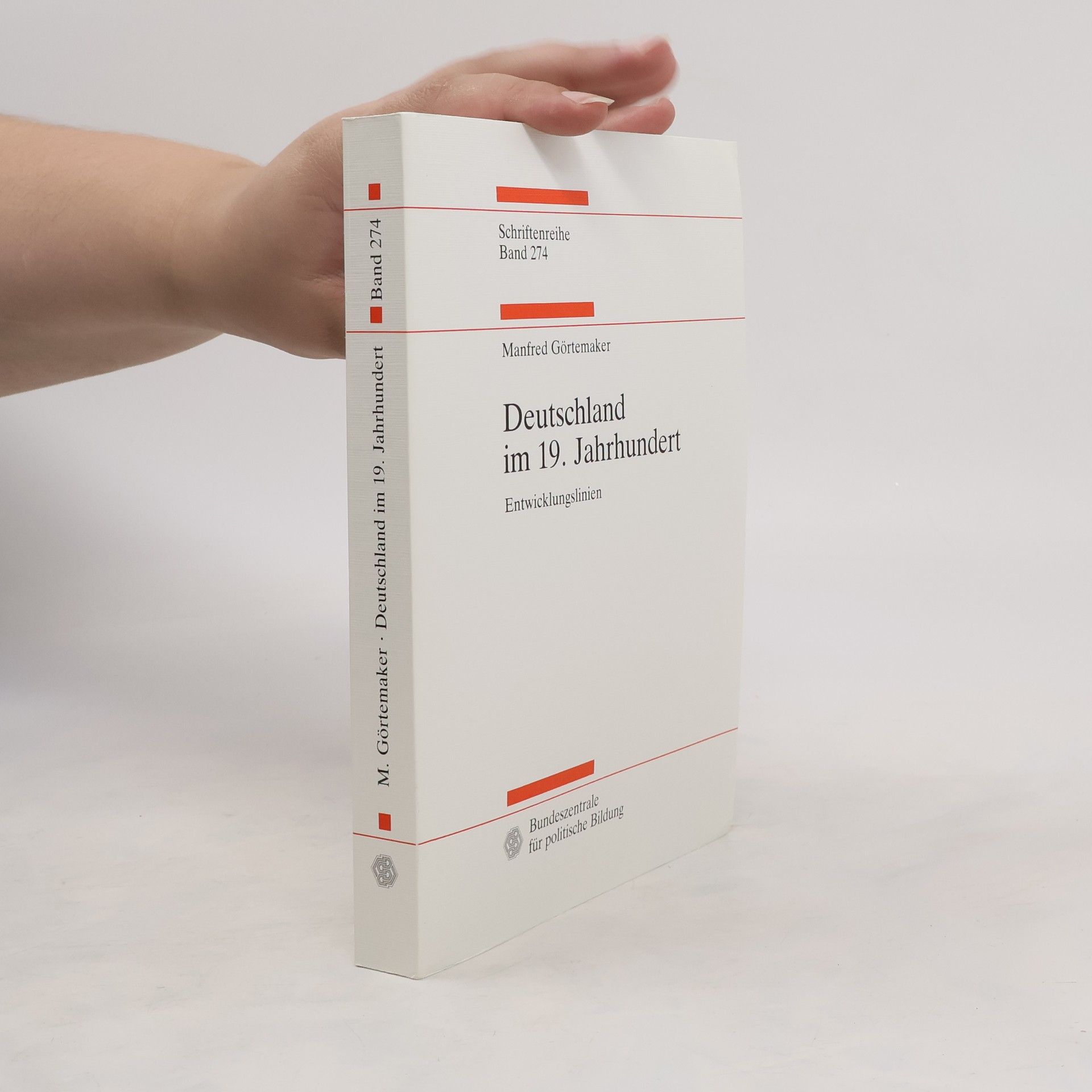
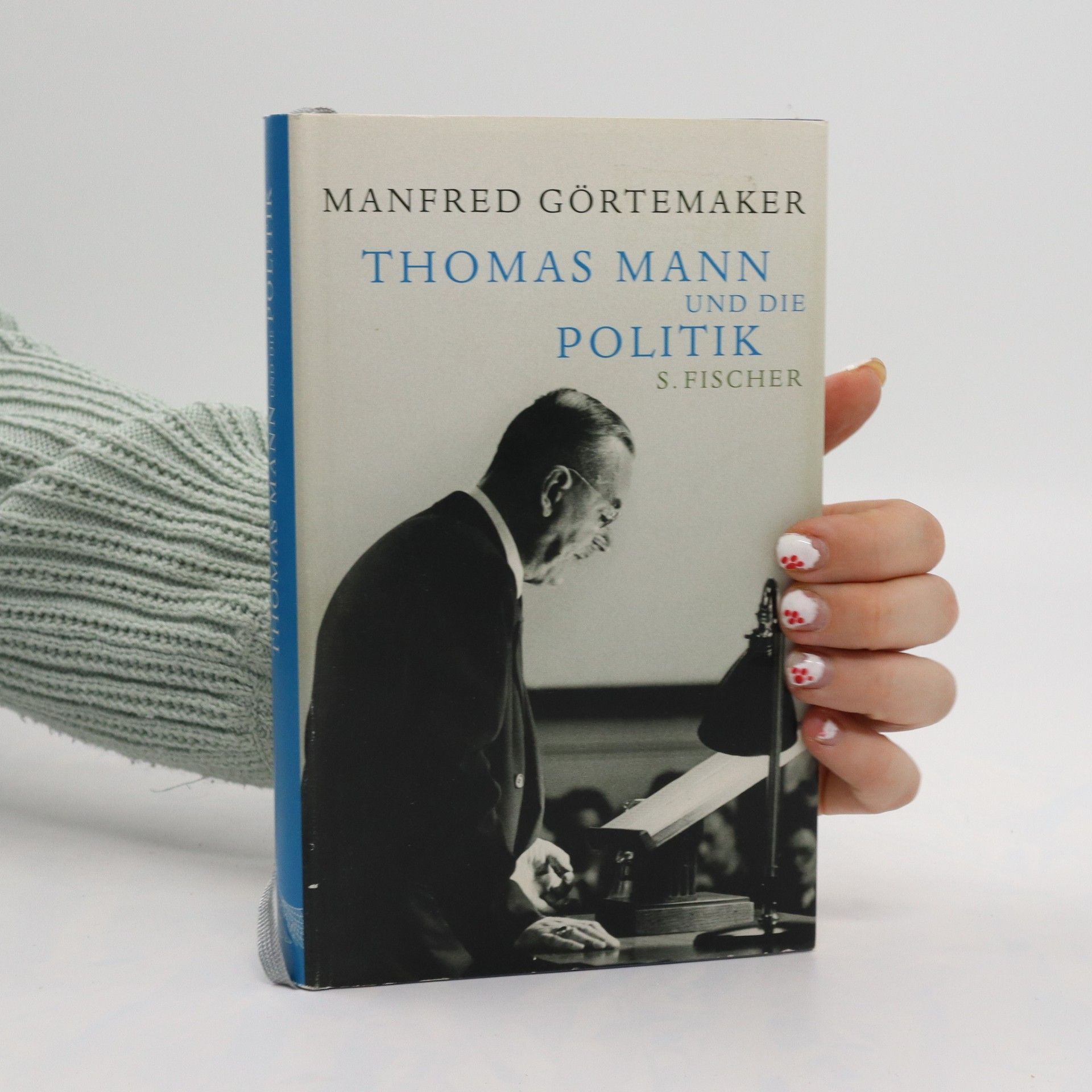


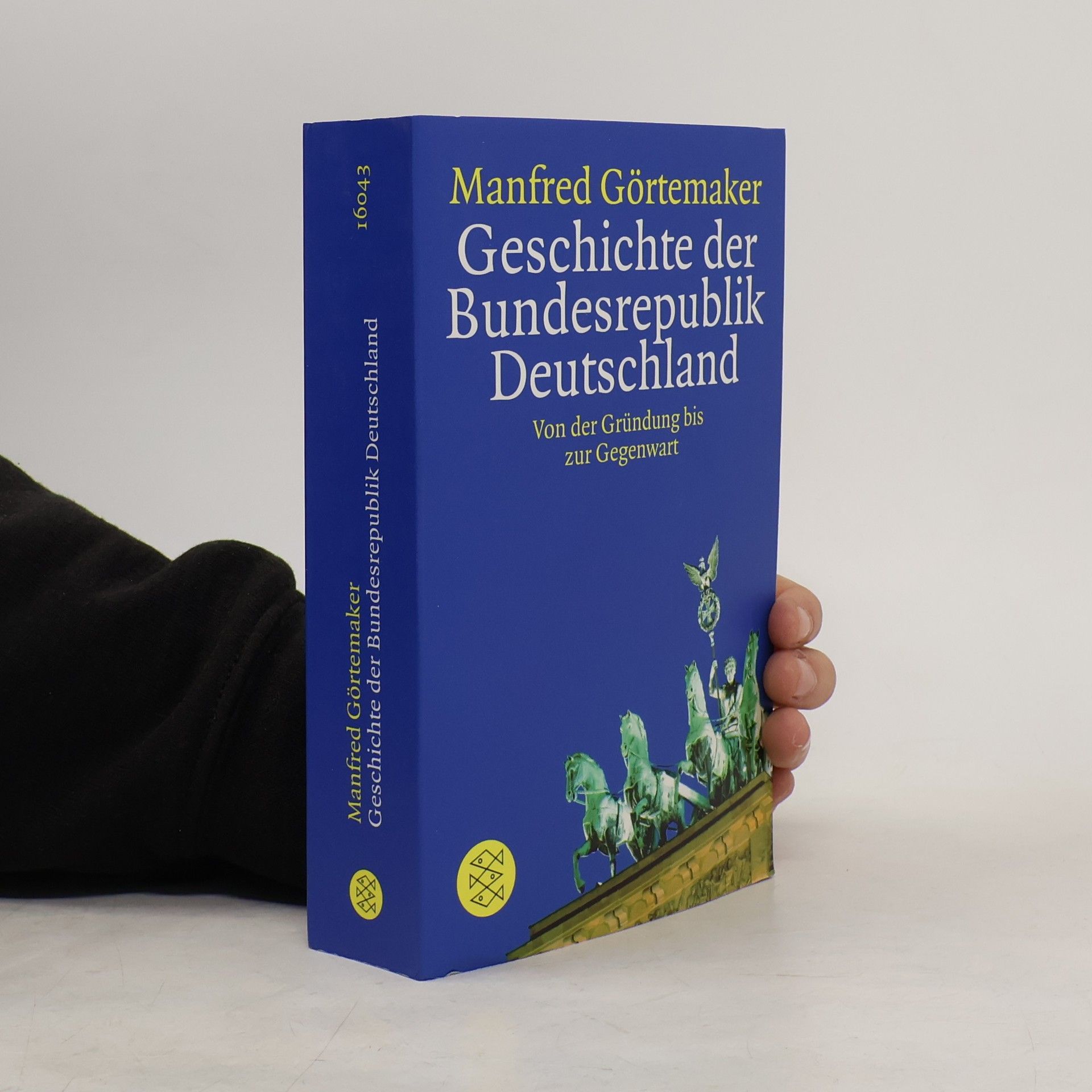

Bis zum Mauerbau 1961 verließen rund 2,8 Millionen Menschen die DDR. Danach war Flucht mit Gefahr für Leib und Leben verbunden, eine Übersiedlung in den Westen praktisch nur noch für Rentner möglich. Nach dem Beitritt der DDR zur UNO 1973 und der damit einhergehenden Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975, aus denen sich ein Recht auf Ausreise ableiten ließ, nahm die Zahl der Ausreiseanträge jedoch stark zu. Von den Behörden wurden sie als »rechtswidrige Ersuchen« eingestuft, da es für dauerhafte Ausreisen unterhalb des Rentenalters in der DDR bis Ende 1988 keine Rechtsgrundlage gab. Die Antragsteller mussten deshalb mit persönlichen und beruflichen Nachteilen rechnen, nicht selten auch mit Repressionen durch die Staatssicherheit.Wie Politik und Justiz der DDR mit »Republikflüchtigen« und Ausreisewilligen umgingen, ist Gegenstand dieses Buches. Auf der Grundlage von mehr als 8.000 Fällen in sieben Kreisen der ehemaligen DDR im heutigen Brandenburg und Thüringen wird darin die Praxis von Flucht und Ausreise von Mitte der 1970er Jahre bis zur Wiedervereinigung 1989/90 untersucht.
Als das Bundesministerium der Justiz 1949 seine Arbeit aufnahm, kam es zu ganz erheblichen personellen und politischen Verflechtungen mit dem "Dritten Reich“. Dass Juristen, die eine stark belastete NS-Vergangenheit hatten, in der Behörde Dienst taten, wurde nicht als problematisch empfunden. Dieses grundlegende Werk zeigt, wer alles im Ministerium unterkam und welchen Einfluss das auf die Rechtspraxis hatte – nicht zuletzt bei der Strafverfolgung von NS-Tätern. Die "Rosenburg“ in Bonn war von der Gründung der Bundesrepublik bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz. 2012 setzte das Ministerium eine Unabhängige Wissenschaftliche Kommission ein, die den Umgang der Behörde mit der NS-Vergangenheit in den Anfangsjahren der Bundesrepublik erforschen sollte. Zu diesem Zweck erhielt die Kommission uneingeschränkten Aktenzugang. Dieses Buch präsentiert ihre Ergebnisse. Zum "Geist der Rosenburg“, so zeigt die Studie, trugen maßgeblich Beamte und Mitarbeiter bei, die zuvor im Reichsjustizministerium, bei Sondergerichten und als Wehrrichter tätig gewesen waren. Ihre Karrieren vor und nach 1945 zeichnet die Kommission ebenso nach wie die Belastungen, die dies für das Ministerium und den Inhalt seiner Politik darstellte. So wird unter anderem gezeigt, welche zentrale Rolle das Ministerium spielte, als 1968 Zehntausende von Strafverfahren gegen NS-Täter eingestellt wurden.
Rudolf Hess
Der Stellvertreter
„Welch ein Anblick für die Welt“, notierte Joseph Goebbels, als Rudolf Hess zu seinem mysteriösen Flug nach England aufbrach, um Frieden zu stiften. Wer war dieser rätselhafte Mann, der Hitlers Schatten war, in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und nach seinem Tod zur Ikone der Neonazis wurde? Manfred Görtemaker präsentiert die erste umfassende Biographie, die mit neuen Quellen einen präzisen Einblick in die Führungsebene des NS-Regimes bietet. Der Potsdamer Zeithistoriker hat fast zwanzig Jahre an dieser akribisch recherchierten Biographie gearbeitet. Er wertete rund 4.100 Briefe und 50.000 Blatt Schriftwechsel aus dem Hess-Nachlass im Berner Bundesarchiv aus und erhielt Sondergenehmigungen, um die Papiere von Lord Selkirk of Douglas, dem Sohn des Duke of Hamilton, einzusehen. Das Ergebnis ist ein plastisches Lebensbild des Mannes, der von Anfang an Hitlers treuester Gefolgsmann war und dessen Einfluss als „Stellvertreter des Führers“ unbestritten blieb. Görtemaker gelingt es, Hess’ Briefe und Schriften zu analysieren und bietet eine präzise biographische Rekonstruktion, die exemplarisch zeigt, wie jemand zum Nazi wird.
Als das Bundesministerium der Justiz 1949 seine Arbeit aufnahm, kam es zu ganz erheblichen personellen und politischen Verflechtungen mit dem „Dritten Reich“. Dass Juristen, die eine stark belastete NS-Vergangenheit hatten, in der Behörde Dienst taten, wurde nicht als problematisch empfunden. Dieses grundlegende Werk zeigt, wer alles im Ministerium unterkam und welchen Einfluss das auf die Rechtspraxis hatte – nicht zuletzt bei der Strafverfolgung von NS-Tätern. Die “Rosenburg„ in Bonn war von der Gründung der Bundesrepublik bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz. 2012 setzte das Ministerium eine Unabhängige Wissenschaftliche Kommission ein, die den Umgang der Behörde mit der NS-Vergangenheit in den Anfangsjahren der Bundesrepublik erforschen sollte. Zu diesem Zweck erhielt die Kommission uneingeschränkten Aktenzugang. Dieses Buch präsentiert ihre Ergebnisse. Zum “Geist der Rosenburg", so zeigt die Studie, trugen maßgeblich Beamte und Mitarbeiter bei, die zuvor im Reichsjustizministerium, bei Sondergerichten und als Wehrrichter tätig gewesen waren. Ihre Karrieren vor und nach 1945 zeichnet die Kommission ebenso nach wie die Belastungen, die dies für das Ministerium und den Inhalt seiner Politik darstellte. So wird unter anderem gezeigt, welche zentrale Rolle das Ministerium spielte, als 1968 Zehntausende von Strafverfahren gegen NS-Täter eingestellt wurden.
Die Universität Potsdam hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1991 fest in der deutschen und internationalen Wissenschaftslandschaft etabliert. Der vorliegende Band nimmt neben der jüngeren eigenen Geschichte auch die Vorgängerinstitutionen der Universität an ihren drei Standorten in den Blick: die Juristische Hochschule Potsdam in Golm, die Pädagogische Hochschule »Karl Liebknecht« am Neuen Palais und die Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Babelsberg. Ein Gang durch die Architekturgeschichte zeigt zudem die vielschichtige Verflechtung der Universität mit der Kulturlandschaft Potsdams. Schließlich wagt der Band aber auch einen Blick in die Zukunft der Hochschule als größte universitäre Forschungs- und Ausbildungseinrichtung des Landes Brandenburg.
Im Land Brandenburg haben die Menschen seit 1989/90 bewegte Jahre durchlebt: Den Umbruch in der DDR, die deutsche Vereinigung, die Wiederbildung des Landes und den folgenden Prozess seines Aufbaus. Brandenburgs Geschichte ist reich an Ereignissen und Veränderungen. Historische Dokumente belegen 1000 Jahre Landesgeschichte. Erst Markgrafschaft, dann Kurfürstentum, territoriale Mitte und später Provinz des Staates Preußen. Schließlich ein Land, das 1947 gegründet und bereits 1952 wieder aufgelöst wurde. Nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist Brandenburg als föderatives Land der Bundesrepublik wieder erstanden, das durch seine Menschen gestaltet und repräsentiert wird. Seit der Gründung des neuen alten Landes bilden der Aufbau der Wirtschaft, Bildung und Kultur und eine Verwaltungsreform die Prioritäten. Brandenburg ist 20 Jahre nach seiner Gründung im Aufwind. Der vorliegende Band dokumentiert diese wechselvolle Geschichte – illustriert von einer Vielzahl zum Teil erstmals veröffentlichter exklusiver Abbildungen. Mit Beiträgen von Friedrich Beck, Michael C. Bienert, Manfred Görtemaker, Frank Göse, Kristina Hübener, Klaus Neitmann und Hans-Joachim Schreckenbach.
„Dem deutschen Volke“ Die Parlamentarische Demokratie in Deutschland wird von ihren Anfängen - Paulskirche 1848 - bis zur Gegenwart in Text und Bild dargestellt. Besondere Kapitel befassen sich mit der Architekturgeschichte des Reichstagsgebäudes und mit dem neuen Parlamentsviertel in Berlin. Die deutsche parlamentarische Demokratie wird von ihren gescheiterten Anfängen 1848 über den Zusammenbruch der Weimarer Republik und den Neubeginn nach 1945 bis zur Gegenwart dargestellt. Neben den historischen Kapiteln steht eine systematische Darstellung über die Arbeit des heutigen Parlaments, des Deutschen Bundestages, über seine Funktionen, seine Organisation und die demokratische Willensbildung. Ein zentraler Ort der Demokratiegeschichte in Deutschland ist das Reichstagsgebäude in Berlin, dessen Baugeschichte erzählt wird. Symbol der deutschen Vereinigung ist das Berliner Parlamentsviertel, das die für 40 Jahre durch die Mauer getrennten Hälften Berlins wieder zusammenbindet. Der großformatige Band ist mit mehr als 250 überwiegend farbigen Abbildungen illustriert. Die Autoren sind bekannte Historiker bzw. Politikwissenschaftler.
Der bekannte Zeithistoriker Manfred Görtemaker spannt den Bogen von der Wiedervereinigung 1990 bis zum Jahr 2005: Erstmals werden hier die großen Themen der Außen- und Innenpolitik (wie die Auslandseinsätze der Bundeswehr oder die Reform des Sozialstaats) und die Veränderungen im Parteiensystem im Kontext der jüngeren deutschen Vergangenheit analysiert. Die Bände der Reihe Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert vermitteln verständlich, kompakt und anschaulich den neuesten Stand der historischen Forschung. Mit Abbildungen und Literaturempfehlungen.