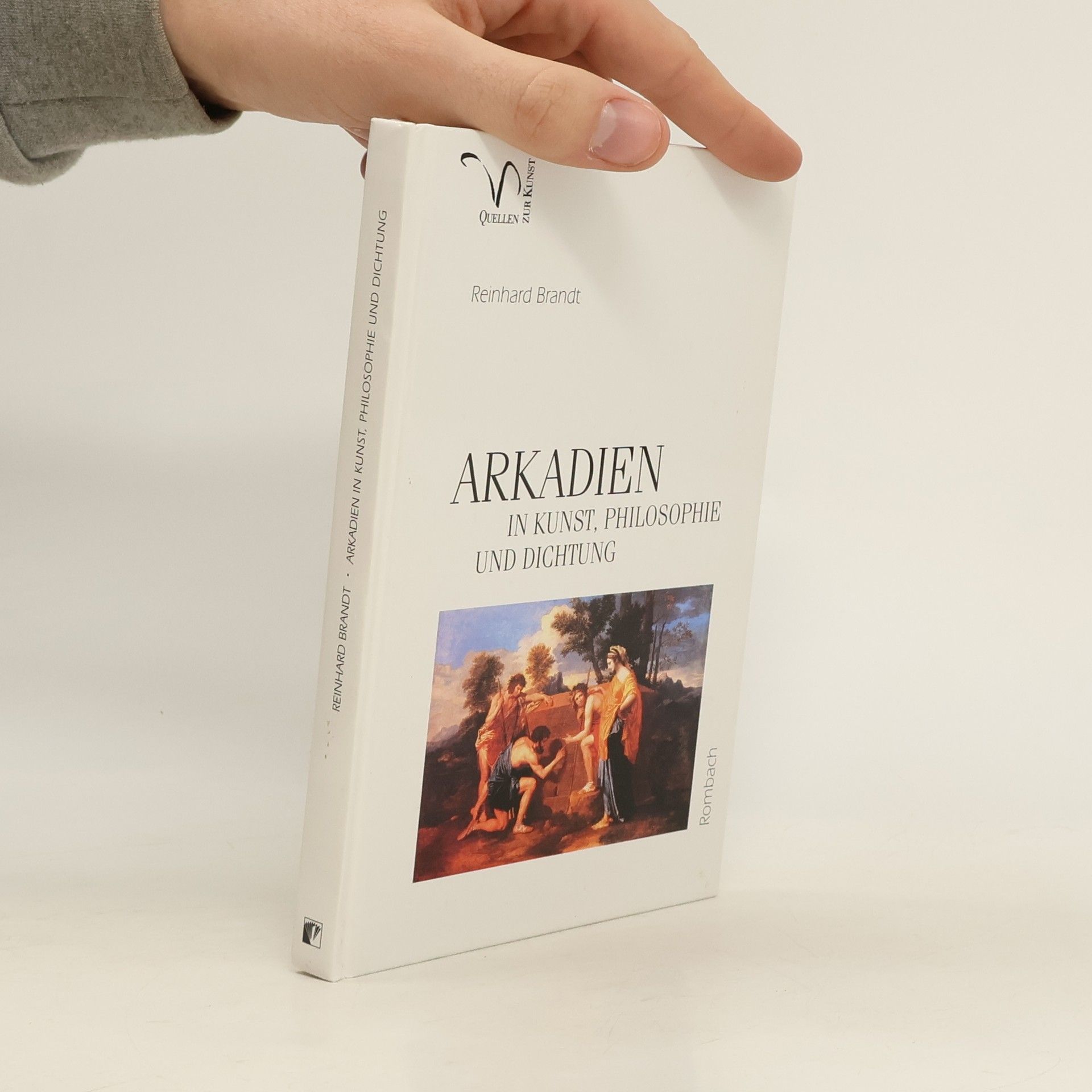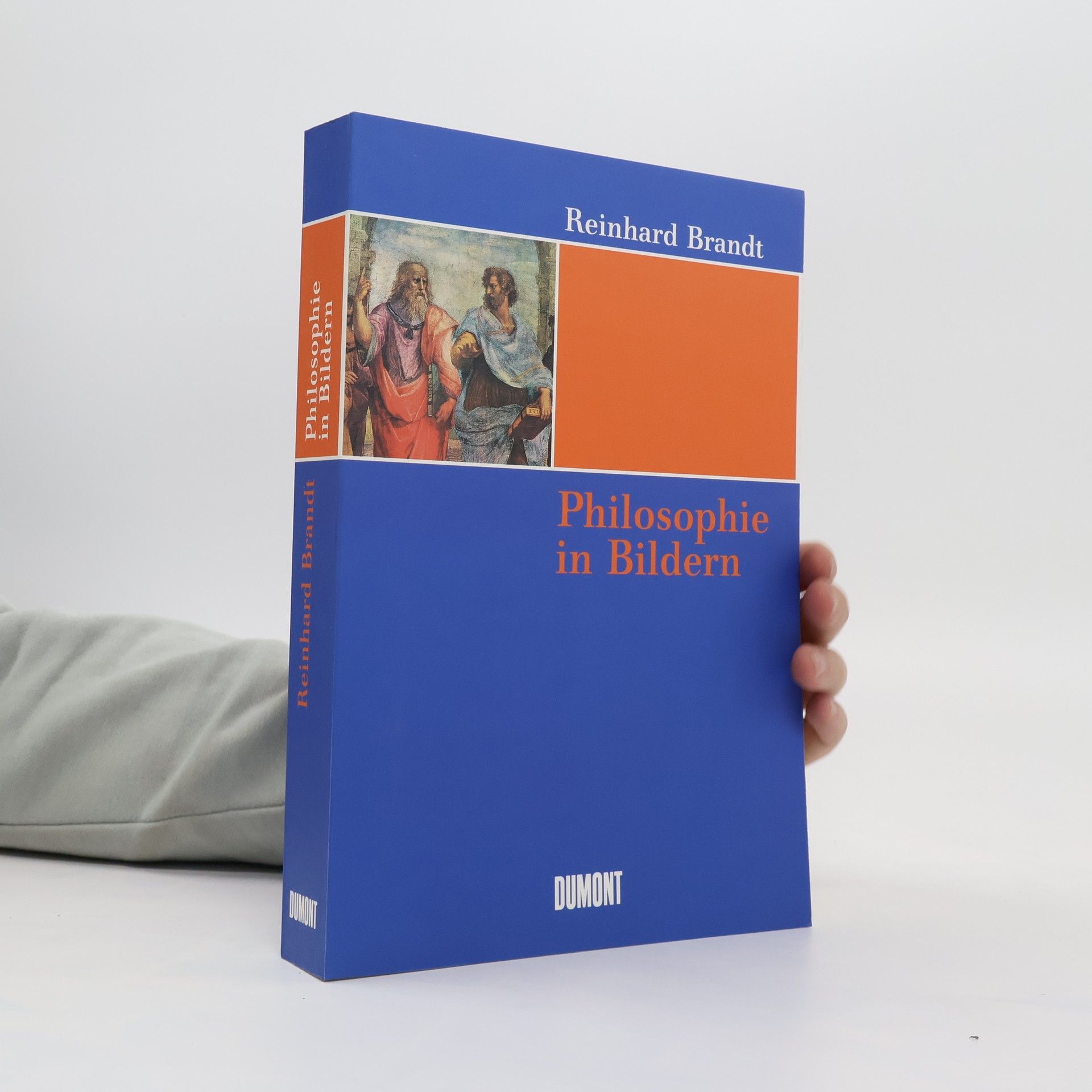Das Frage-Buch von Reinhard Brandt beginnt mit der Entdeckung, dass die Raum-Zeit-Lehre der Kritik der reinen Vernunft einen Gottesbeweis als Subtext enthält. Es wird untersucht, welche Rolle die Theologie in der kritischen Philosophie spielt und ob sie die Anwendung der euklidischen Geometrie auf den Raum der reinen Anschauung rettet. Der zweistufige kategorische Imperativ wird im Kontext von „status naturalis“ und „status civilis“ betrachtet, wobei die Freiheit unter eigener Gesetzgebung im Vordergrund steht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Gleichsetzung von sittlicher Freiheit und Gesetzgebung haltbar ist oder ob es in Extremsituationen eine Pflicht zu lügen gibt. Zudem wird Kants Definition eines empirischen Naturprodukts in der „Kritik der teleologischen Urteilskraft“ hinterfragt, ebenso wie die Auffassung des Vertrags in der „Rechtslehre“ und die Herausforderungen, die Kants Ehe- und Strafrecht mit sich bringt. Die Prinzipien der Aufklärung und der Menschenwürde werden als unhinterschreitbar betrachtet, und es wird nach ihrer genauen Begründung gefragt. Brandt zielt nicht auf die Bewahrung des Kantischen Erbes ab, sondern darauf, was mit Kant und darüber hinaus auch heute noch gedacht werden kann. Der Traktat folgt einer Tradition, die mit den 'Kritiken' beginnt und die Leser dazu anregt, der Argumentation kritisch zu folgen oder sie abzulehnen.
Reinhard Brandt Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
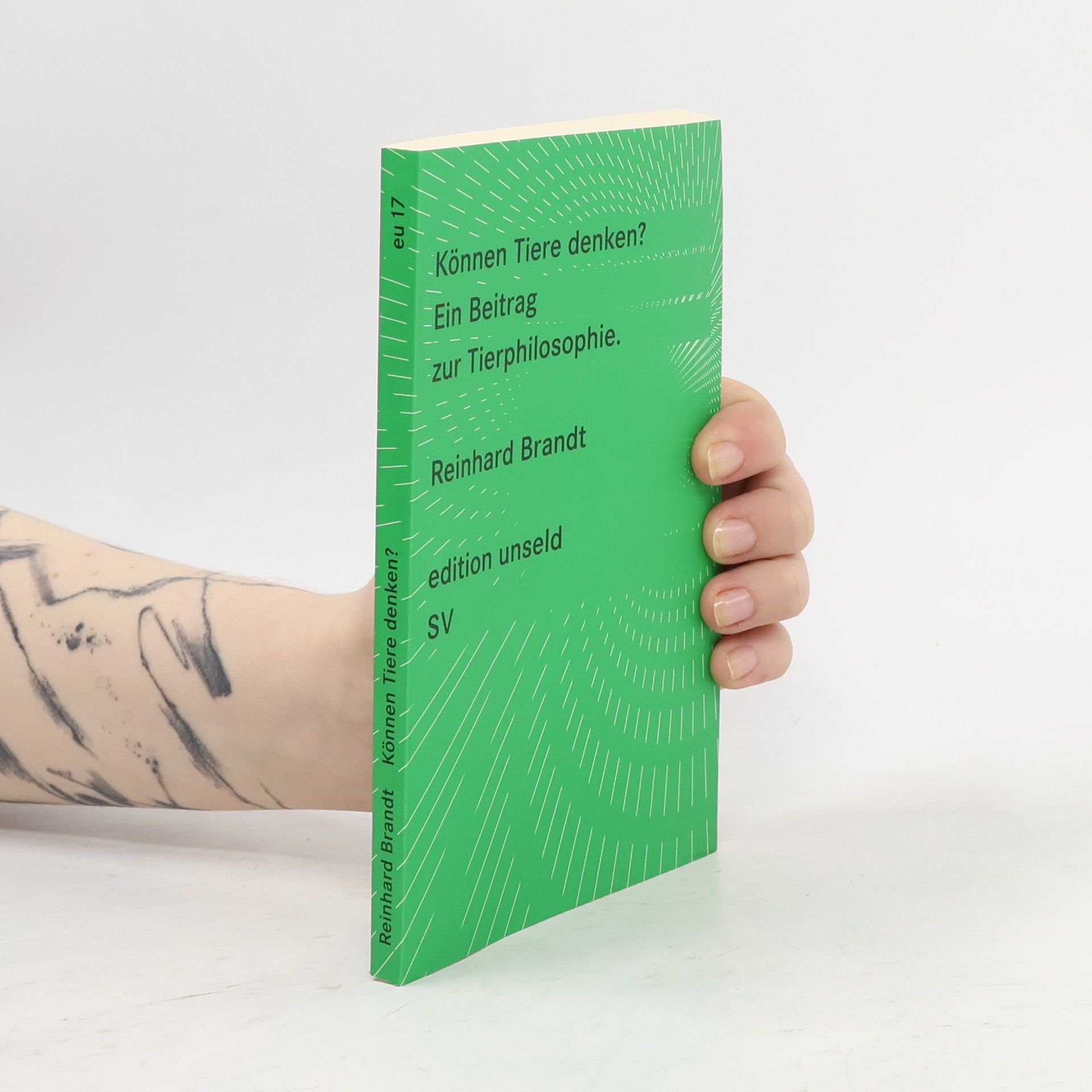
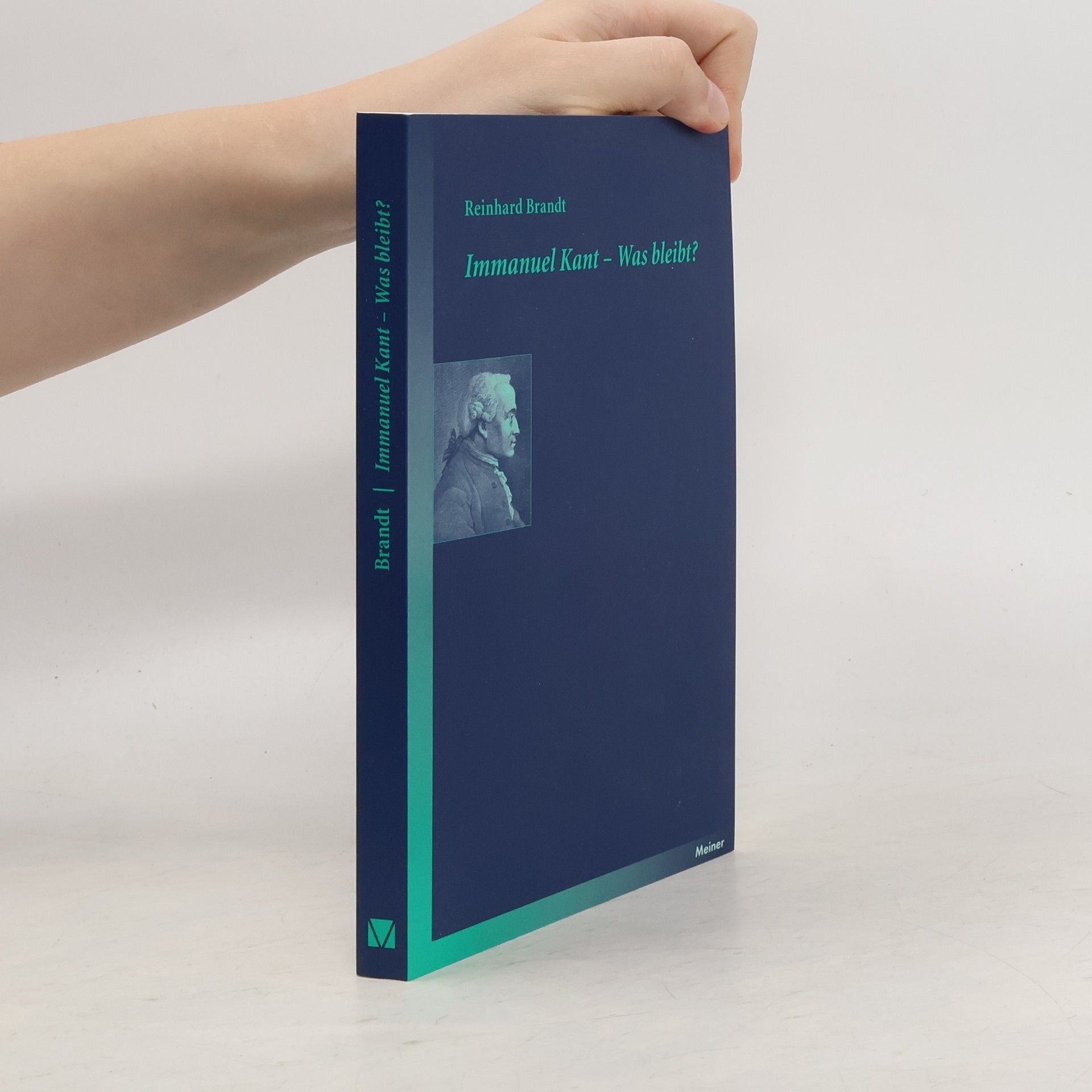


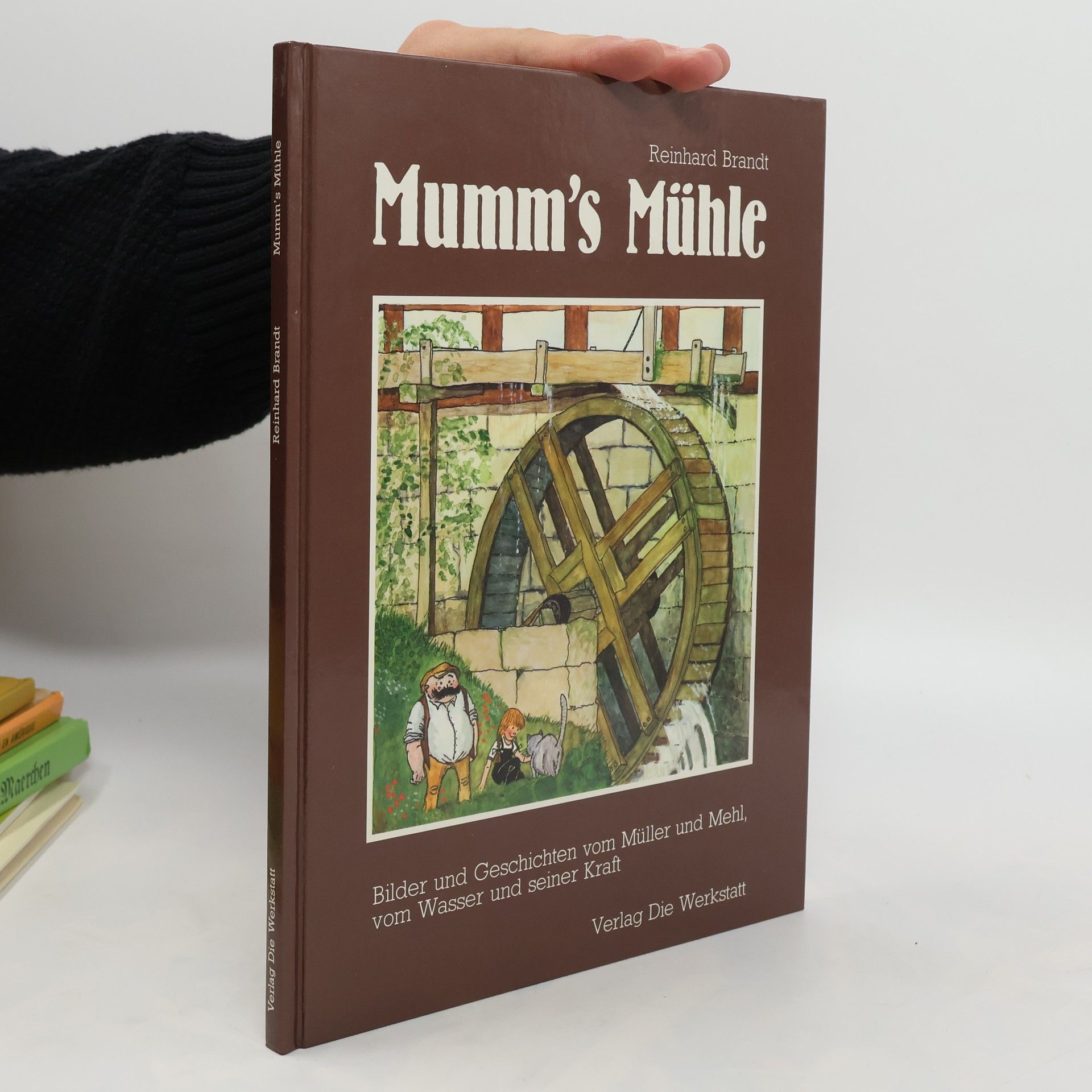
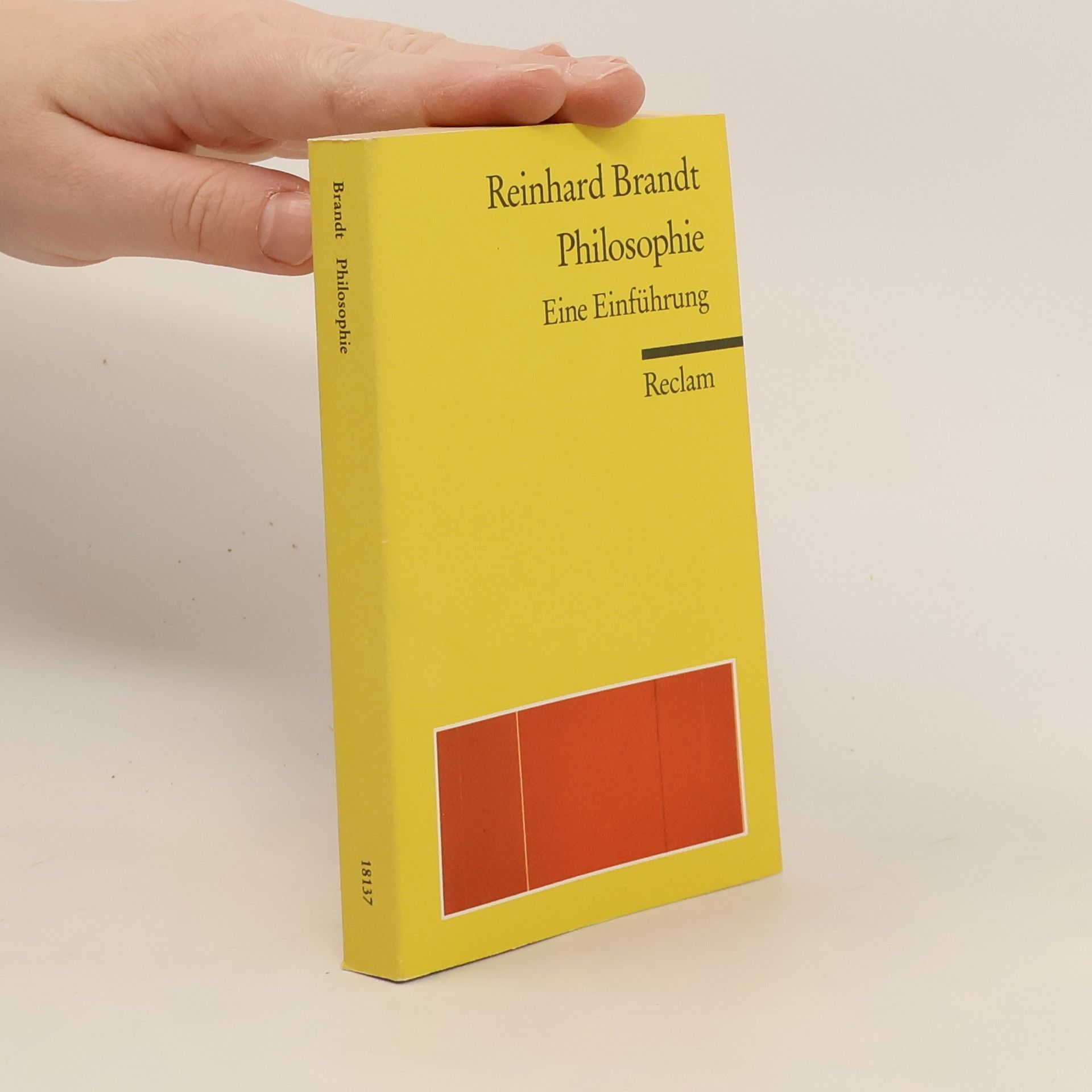
Tiere besitzen bemerkenswerte kognitive Fähigkeiten und Formen des Selbstbewusstseins, doch das Denken in diskreten Urteilen bleibt ihnen verwehrt. Dies führt zu einer Unfähigkeit, zwischen Bejahung und Verneinung sowie zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Die Entstehung des menschlichen Denkens und die Rolle des Gehirns in diesem Kontext sind zentrale Fragen. Menschen leben in zwei Welten, die paradoxerweise eine sind. Unsere Lebenswelt, geprägt von Tageslicht, Gerüchen und physischen Grenzen, ähnelt der des Hundes, der uns begleitet. Tiere nehmen die Welt ebenso sinnlich wahr, erschrecken bei lauten Geräuschen und zeigen Freude. Gleichzeitig existiert für uns eine zusätzliche Welt, die den Tieren offenbar verborgen bleibt: Wir Menschen machen Dinge zu Objekten der Erkenntnis. Während wir die Sonne als zentralen Körper im Planetensystem erkennen, bleibt dies den Tieren unbekannt. Wir spüren Kälte und verstehen ihre Ursachen, während Tiere keine Konzepte von Ursache oder Wunder haben. Es gibt eine Debatte über die Denkfähigkeit von Tieren: Einerseits wird behauptet, sie könnten denken, andererseits wird argumentiert, dass ihnen die notwendigen Voraussetzungen für Urteilen und Denken fehlen, da sie keine geeigneten Begriffe und keine gemeinsame Öffentlichkeit besitzen, die durch das Zeigen und Urteilen geschaffen wird.
Arkadien in Kunst, Philosophie und Dichtung
- 167 Seiten
- 6 Lesestunden
Das Ich im Zentrum von Vergils Arkadien-Dichtung. Guercinos und Poussins 'Et in Arcadia ego': Wer spricht? '1645' als Jetzt-Inschrift einer Ruine: Die Gegenwart als Vergangenheit in der Zeitschleife bei Castglione. Der geschichtsphilosophische Tod Arkadiens. Die Antike naiv? Keine Spur.
Mythos und Mythologie
- 257 Seiten
- 9 Lesestunden
Mythen dienen der Bewältigung praktischer gesellschaftlicher Probleme, sie bieten Anleitungen zum poietischen und praktisch-politischen Handeln - dies bildet das einigende Band der im vorliegenden Buch versammelten Beiträge.
Klassische Werke der Philosophie
- 380 Seiten
- 14 Lesestunden
Philosophie
- 296 Seiten
- 11 Lesestunden
Diese Einführung in die Philosophie ist eine Anleitung zum Selberdenken: Bedeutende Texte der Philosophiegeschichte, die abgedruckt und erläutert werden, machen den Leser mit allen wichtigen Fragestellungen bekannt. Texte und Themen werden daraufhin in Form von „weiterführenden Reflexionen“ diskutiert. Ein höchst anregender Einstieg ins Philosophieren für alle, die sich ernsthaft darauf einlassen wollen.
Algunos de los artículos reunidos en este libro fueron presentados en el marco del Seminario La Filosofía Política de Kant que Reinhard Brandt impartiera en la Línea de Filosofía Política del Posgrado de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa en el mes de julio de 1999. Este seminario forma parte del Programa Académico Filosofía Práctica: Tradición y Crítica que el Posgrado en Humanidades (Línea de Filosofía Política) de la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa en colaboración con el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DDAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico) y el Instituto Goethe de México llevan a cabo desde el año de 1999. En el marco de este Programa se cuenta con la participación de docentes de Universidades alemanas de diversas orientaciones filosóficas interesados en los problemas relativos a la praxis humana en diversos niveles, a sus condiciones de articulación, a sus parámetros normativos, a su marco institucional y a su crítica.
Philosophie in Bildern
- 470 Seiten
- 17 Lesestunden