Wohin gehen Technologien, wenn sie verschwinden und weder Zukunft noch Anwendung haben? Lässt sich ihr Verschwinden überhaupt erzählen? Vielleicht als eine Geschichte im Rückwärtsgang? Oder bloss als grosse Aufräumaktion, bei der Abriss, Demontage und Entsorgung die Hauptrolle spielen? Die hier zusammengestellten Versuche zeigen, wie sich starke Verbindungen wieder auflösen können, warum sogar höchst prominente Technologien plötzlich obsolet werden, während andere erst nach langer Wartezeit in einem überfüllten Museumskeller als kurioses Ausstellungsobjekt entdeckt werden.
David Gugerli Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
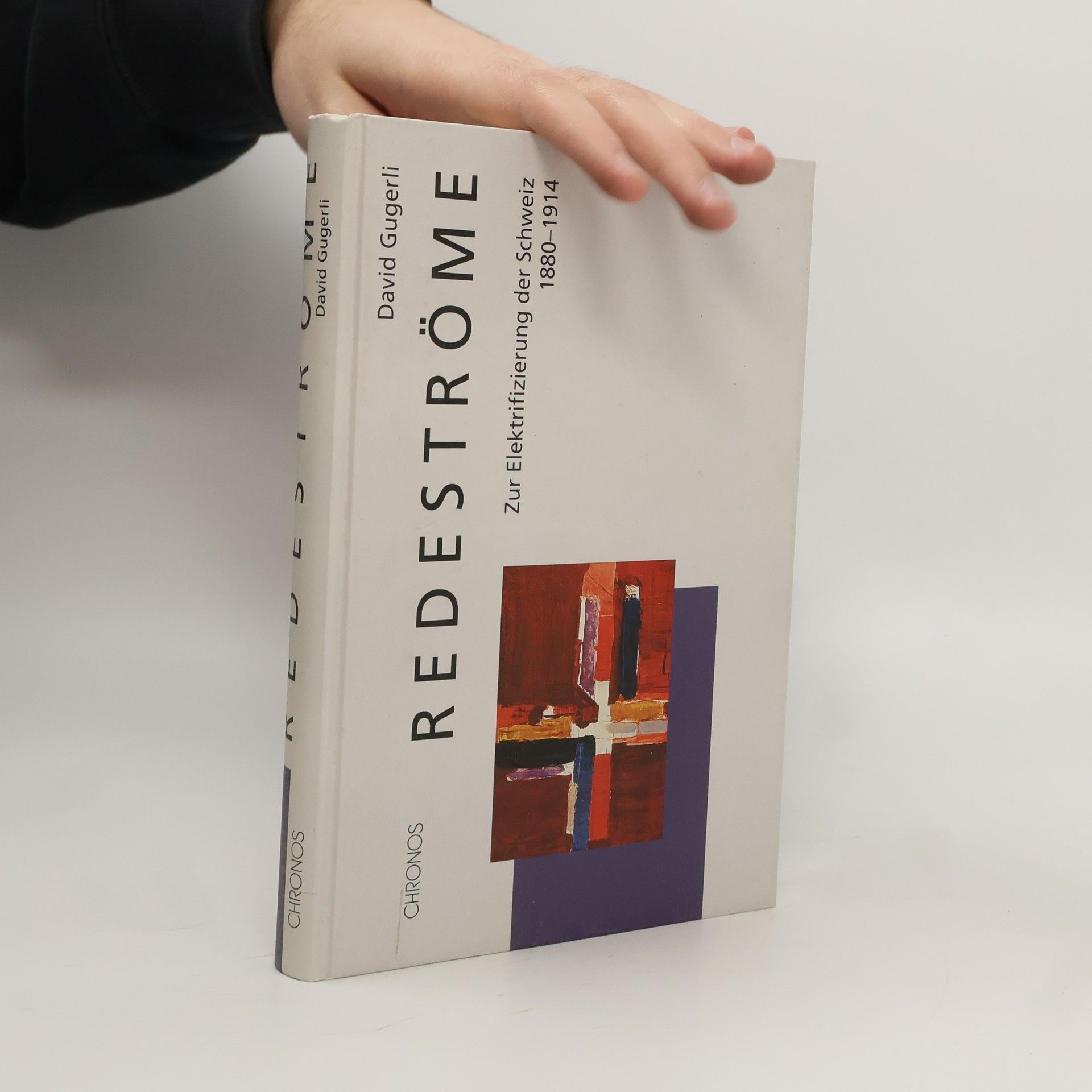
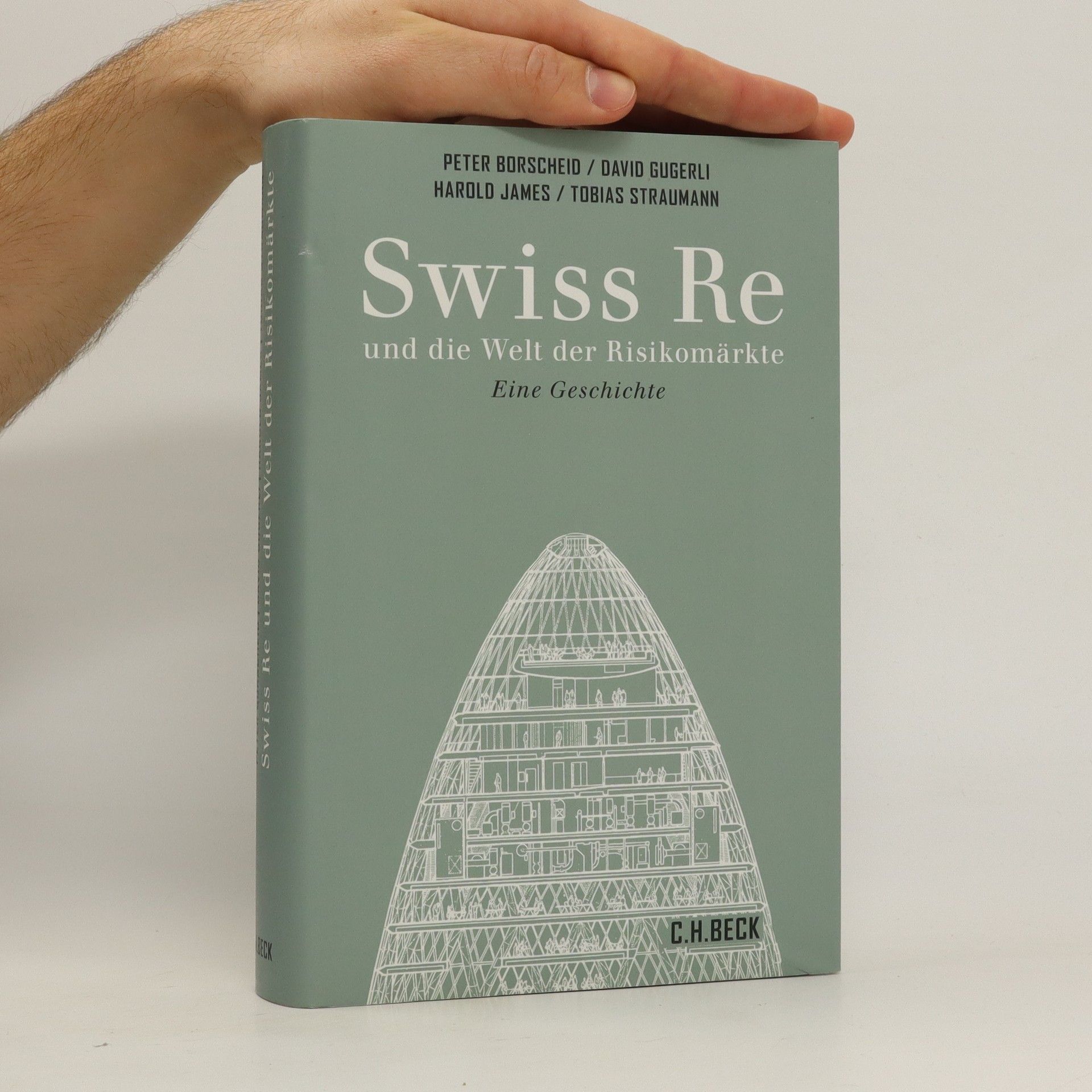



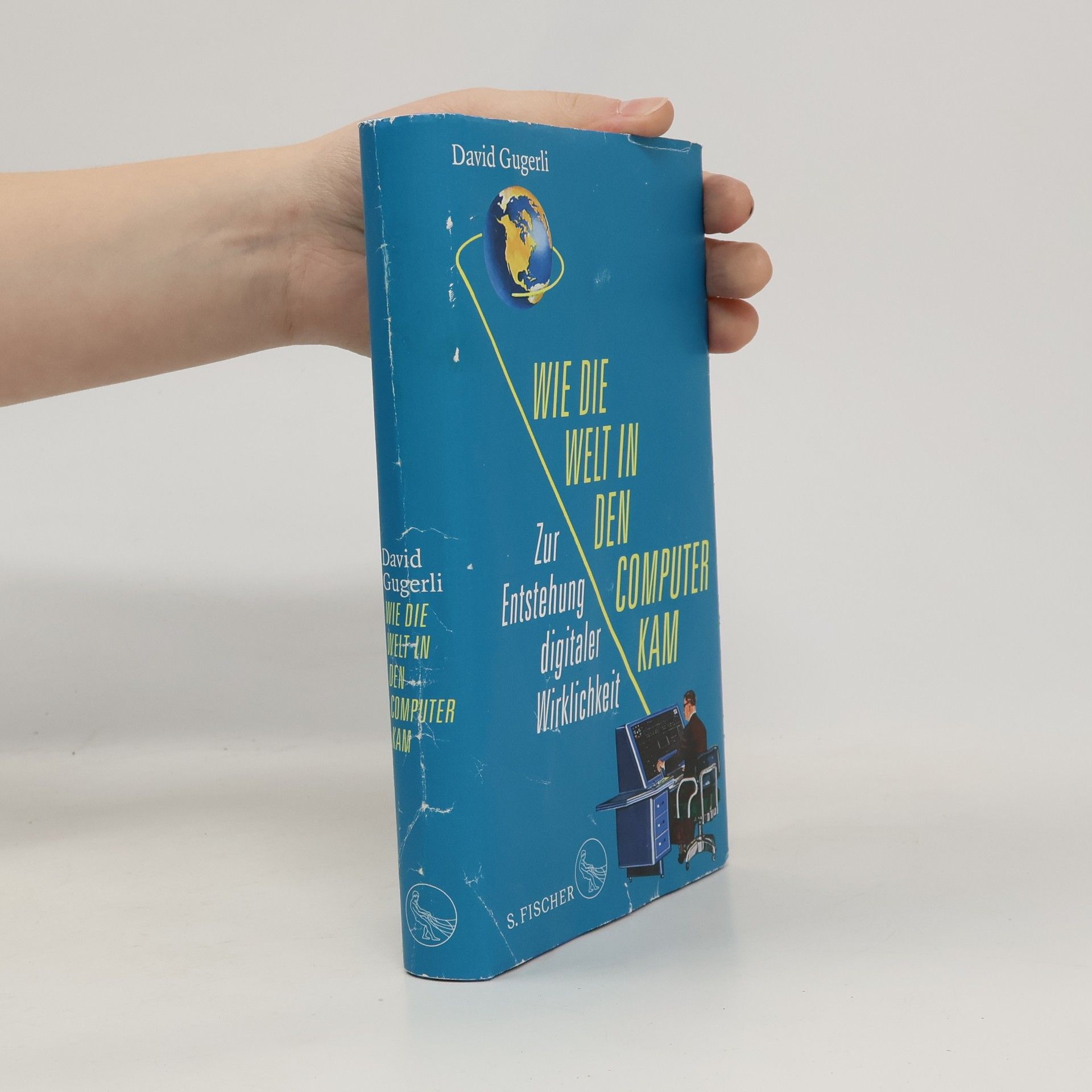
How the World got into the Computer
The Emergence of Digital Reality
An den Grenzen der Berechenbarkeit
Supercomputing in Stuttgart
Simulation for All
The Politics of Supercomputing in Stuttgart
Wie die Welt in den Computer kam
Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit
Der Weg in die digitale Kultur Damit die Welt mit Computern verwaltet und organisiert werden kann, muss sie in den digitalen Raum der Maschinen überführt werden. Der Historiker David Gugerli erzählt die Geschichte dieses großen Umzugs anhand von prägnanten Beispielen. Er schildert, wie Techniker, Manager, Berater und User miteinander gestritten haben, wie sie ihre Wirklichkeit formatiert und welche neue Unübersichtlichkeit sie dabei erzeugt haben. Sie haben Rechner verbunden, Daten kombiniert, Programme umgeschrieben und aus dem Computer fürs Personal einen Personal Computer gemacht – warum und wie, zeigt dieser glänzend geschriebene Essay. »Wer befürchtet, dass Computer ›den Menschen‹ bald verdrängen werden, muss dieses Buch lesen.« Professor Timothy Lenoir
Topografien der Nation
Politik, kartografische Ordnung und Landschaft im 19. Jahrhundert
Landkarten ordnen den Raum und bestimmen die Verhältnisse seiner natürlichen und politischen Elemente. Wer über die entsprechende kartografische Lektüretechnik verfügt, dem steht die Karte als räumliches Orientierungsmittel, als politische Entscheidungsgrundlage oder als Instrument der sozialen Selbstverortung zur Verfügung. Auch die Kartografie des 19. Jahrhunderts hat dieses Ziel verfolgt und dafür eigene Wege und Methoden entwickelt. Dank wissenschaftlicher Präzision, abstrakter Ästhetik und organisatorischer Innovation hat sie Produkte hervorgebracht, die sich einer neuartigen Legitimation durch Verfahren erfreuten. Die neuen Bilder ermöglichten gleichzeitig eine nationalistische Lektüre die Landschaft und die kartografische Reproduktion der Nation. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich Karte und Nation gegen Ende des Jahrhunderts schliesslich zur Deckung bringen liessen, hat eine Geschichte, die nur als historische Konfiguration von Politik, kartografischer Ordnung und Landschaft verstanden werden kann. Sie ist Gegenstand dieses Buches. Am Beispiel der schweizerischen Landesvermessung, die zwischen 1832 und 1865 unter der Leitung von General Guillaume-Henri Dufour durchgeführt worden ist, untersucht 'Topografien der Nation' die sozialen Voraussetzungen der kartografischen Lesbarkeit der Welt.
Redeströme
Zur Elektrifizierung der Schweiz, 1880-1914