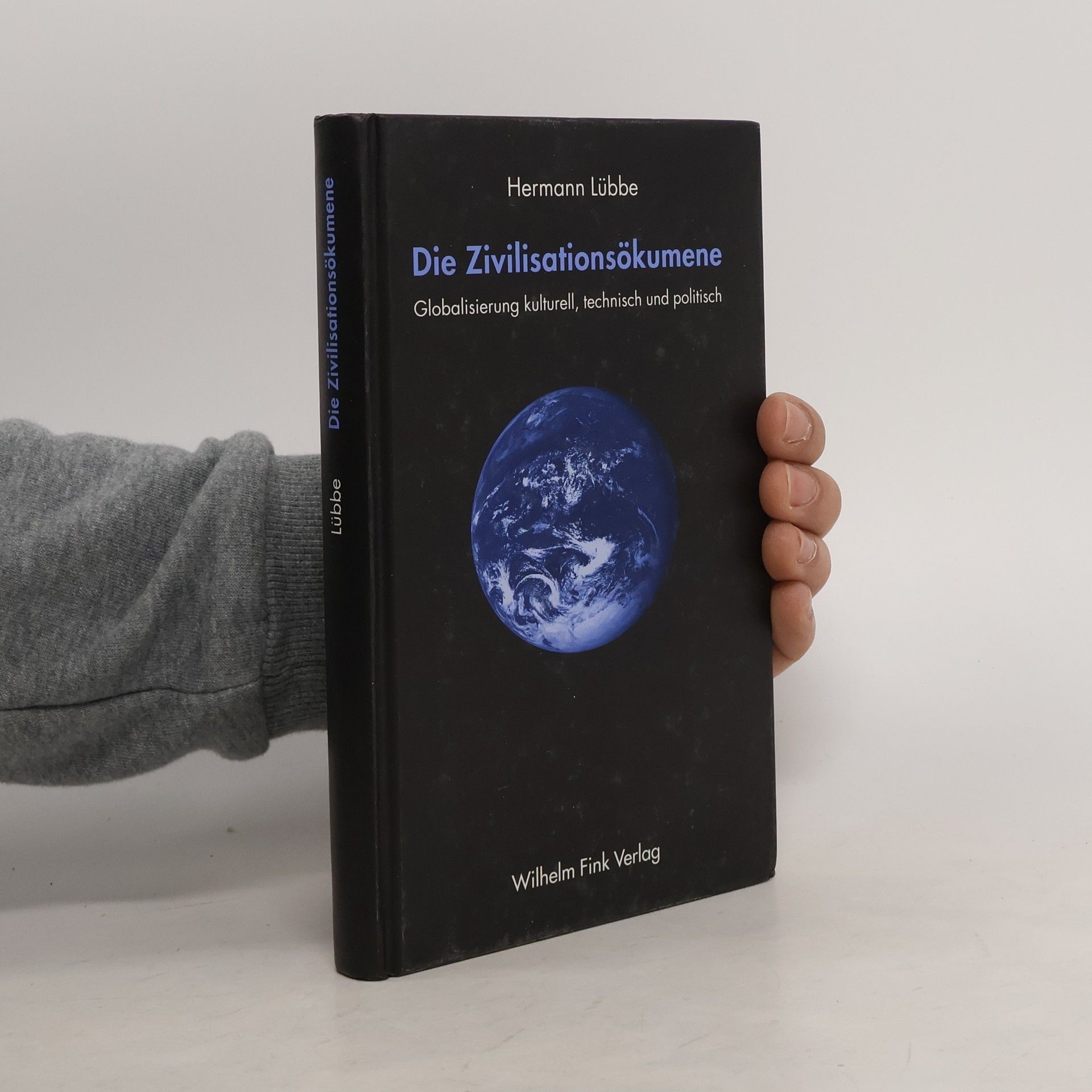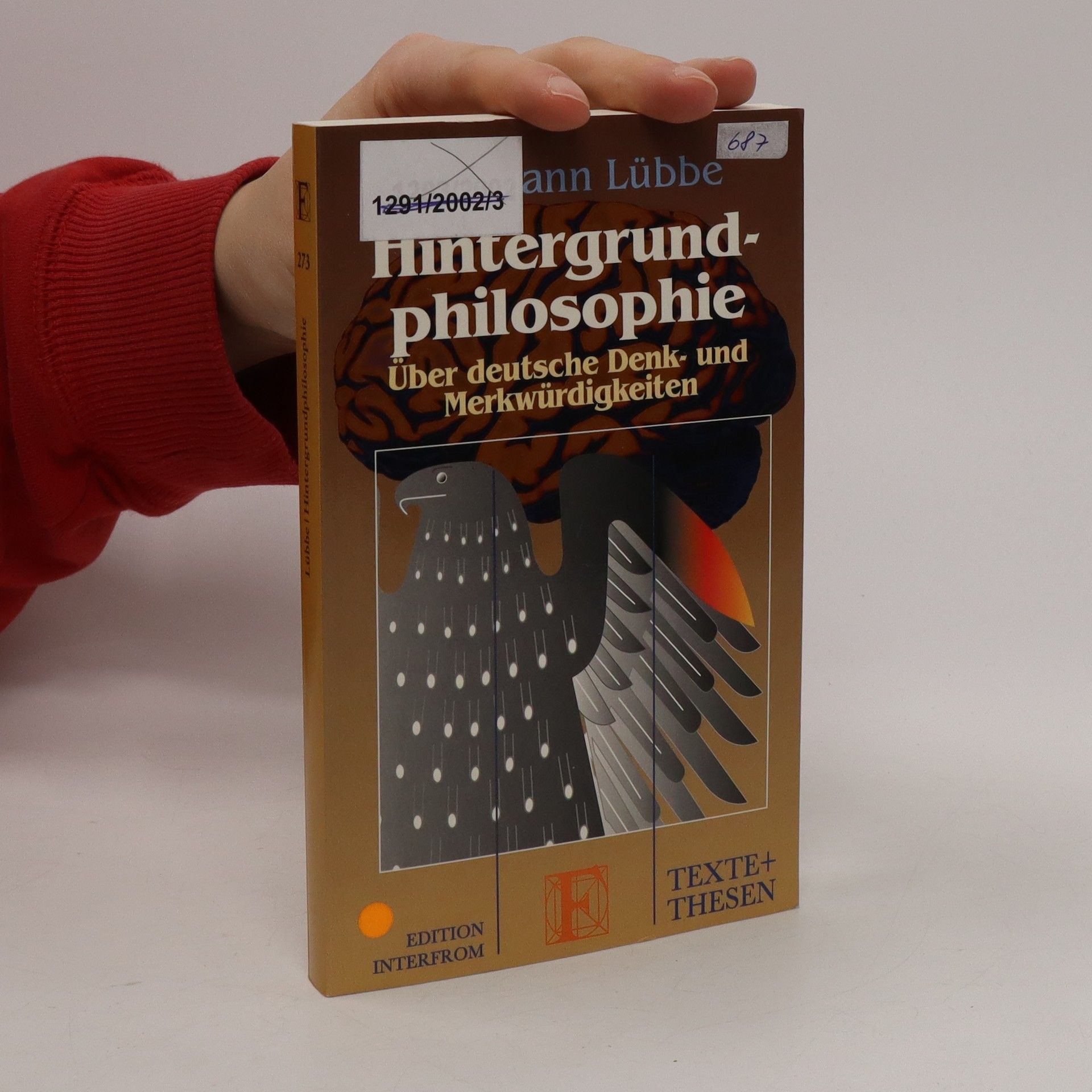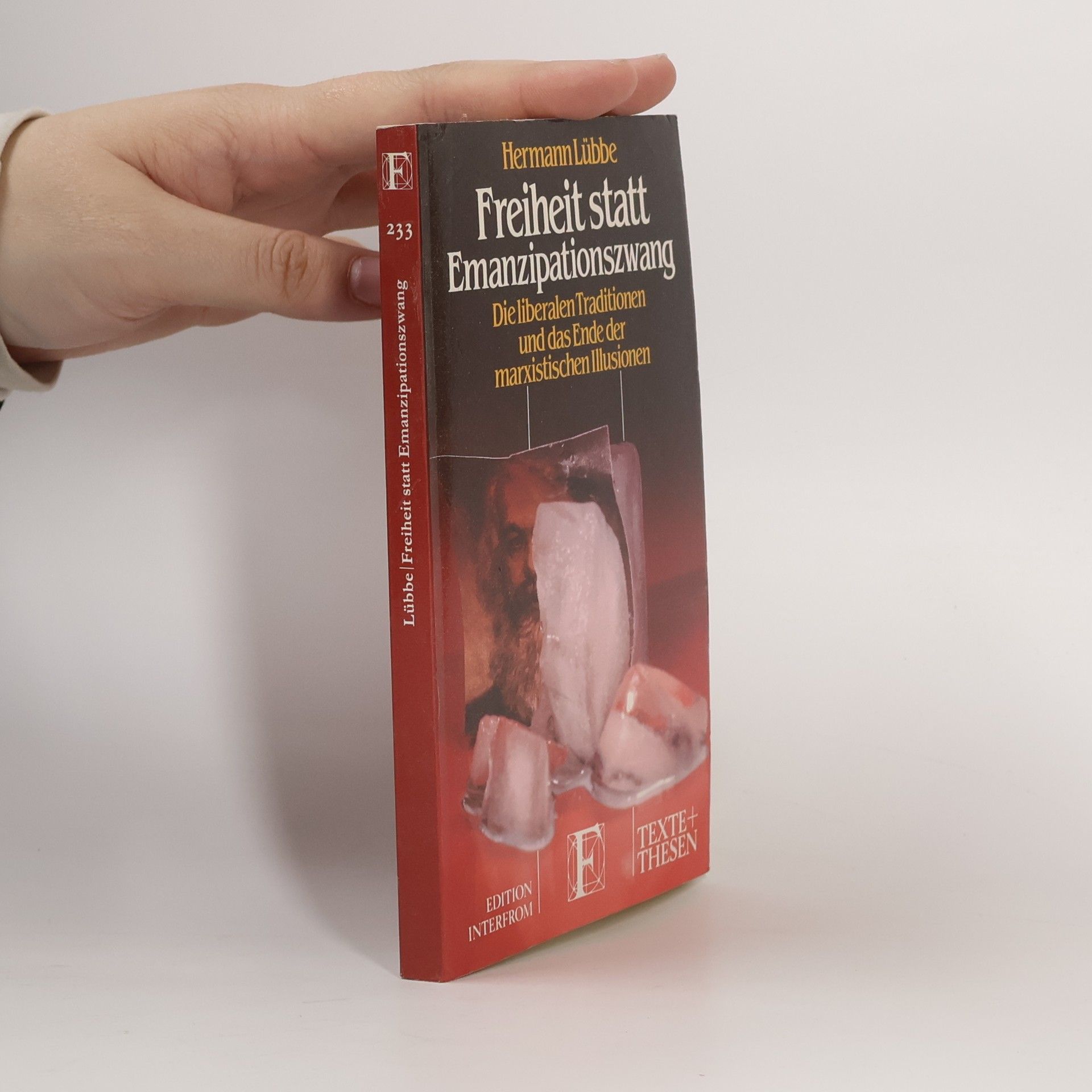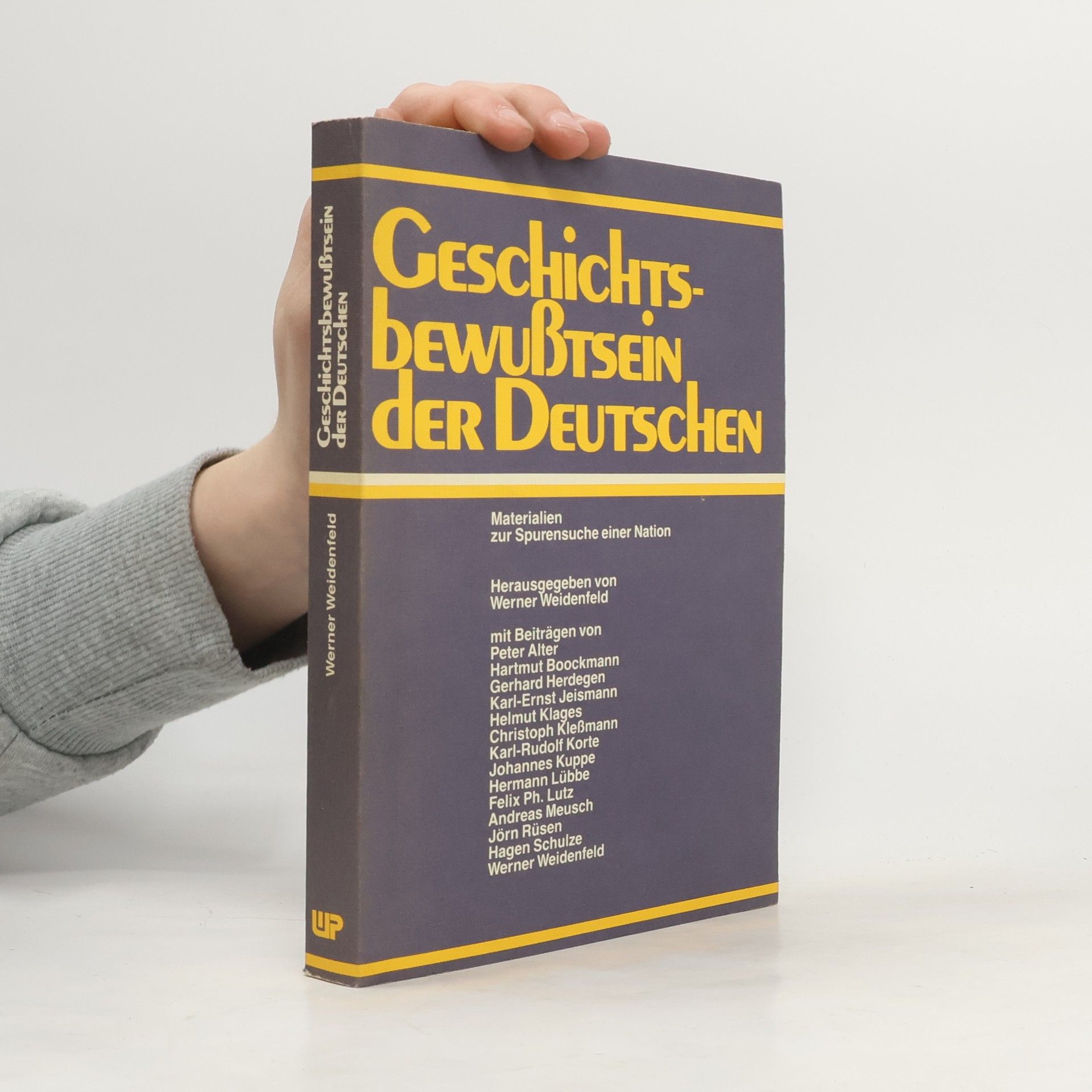Mit den zentralen Fragen Europas beschäftigte sich Hermann Lübbe vor 25 Jahren. Er nannte seinen Essay "Abschied vom Superstaat - Vereinigte Staaten von Europa wird es nicht geben". Ergänzt um ein aktuelles Vorwort kann der Text wieder vorgelegt werden: Fragen und Herausforderungen, denen sich Europa stellen muss, sind geblieben. Sie wurden in überraschend vorausschauender Weise behandelt: Die Furcht vor und die Sehnsucht nach dem Superstaat, die Sonderstellung Großbritanniens, Osteuropa, die Währungsfrage, die nationalen Orientierungen, die Forderungen der Minderheiten, Föderalismus und Regionalismus. Die Migrationsfrage war damals kein Problem. Ihr stellt sich der Autor heute in seinem Vorwort. Seine Meinung: "So wenig Einheit wie nötig, so viel Selbständigkeit auch kleiner Einheiten wie möglich."
Hermann Lübbe Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
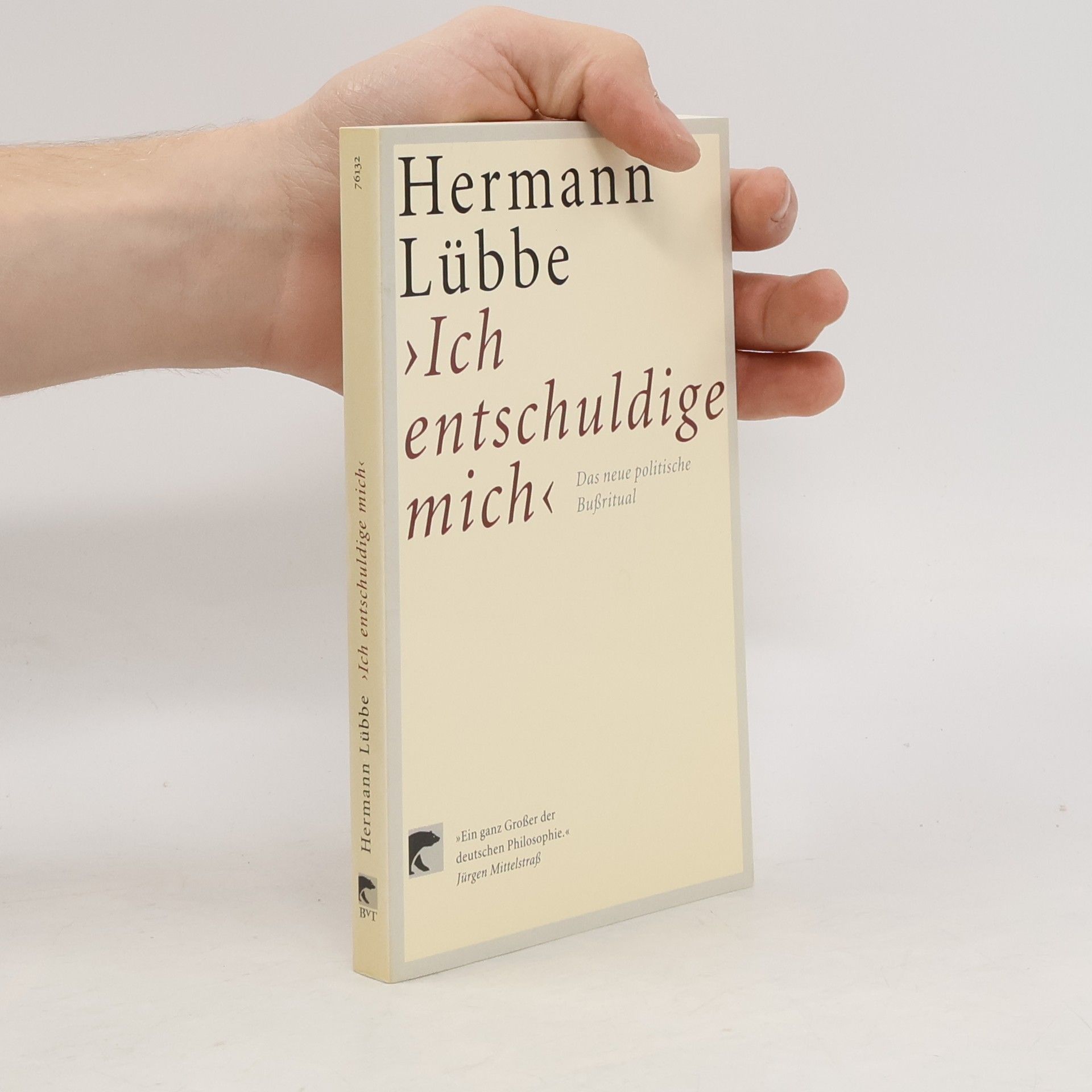


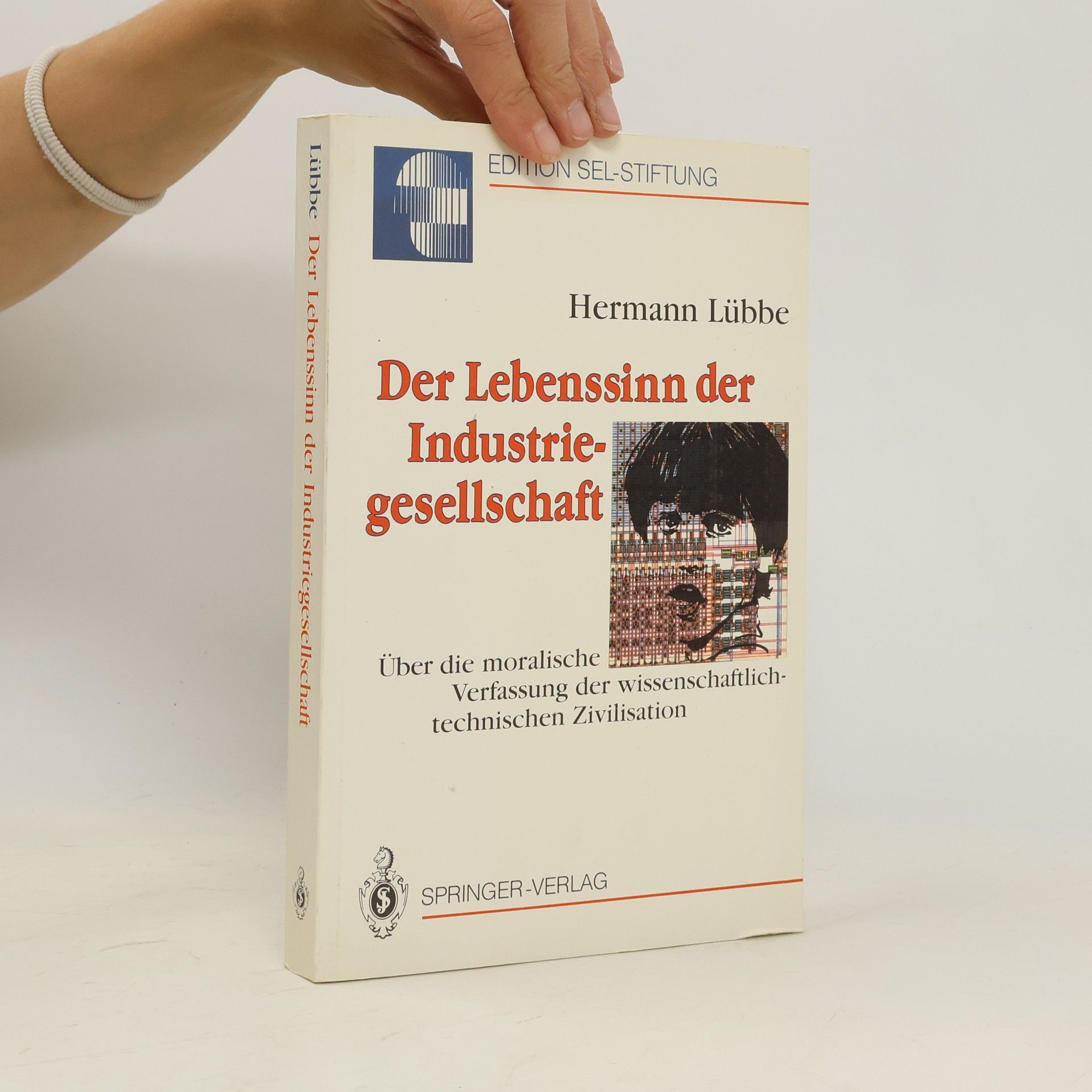
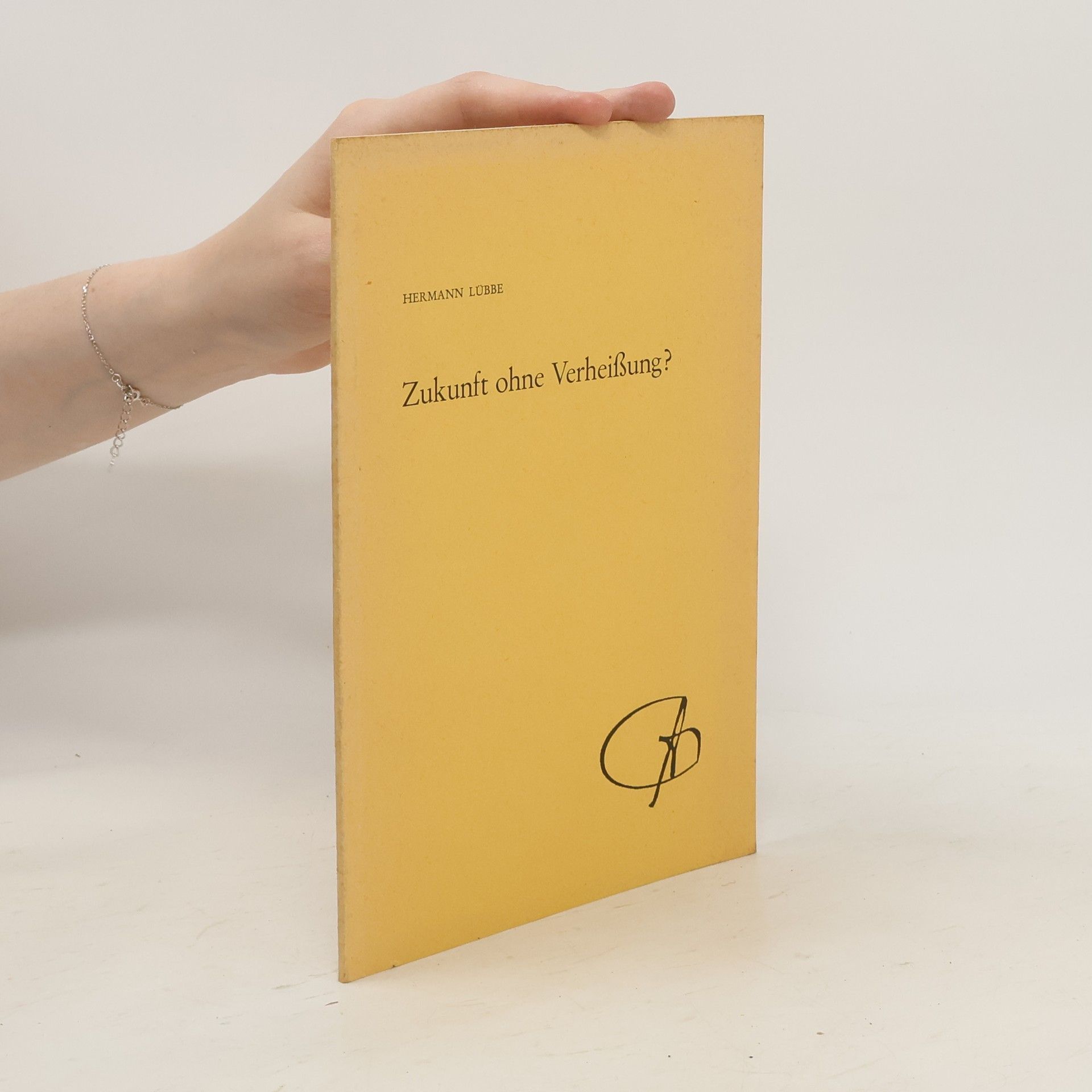
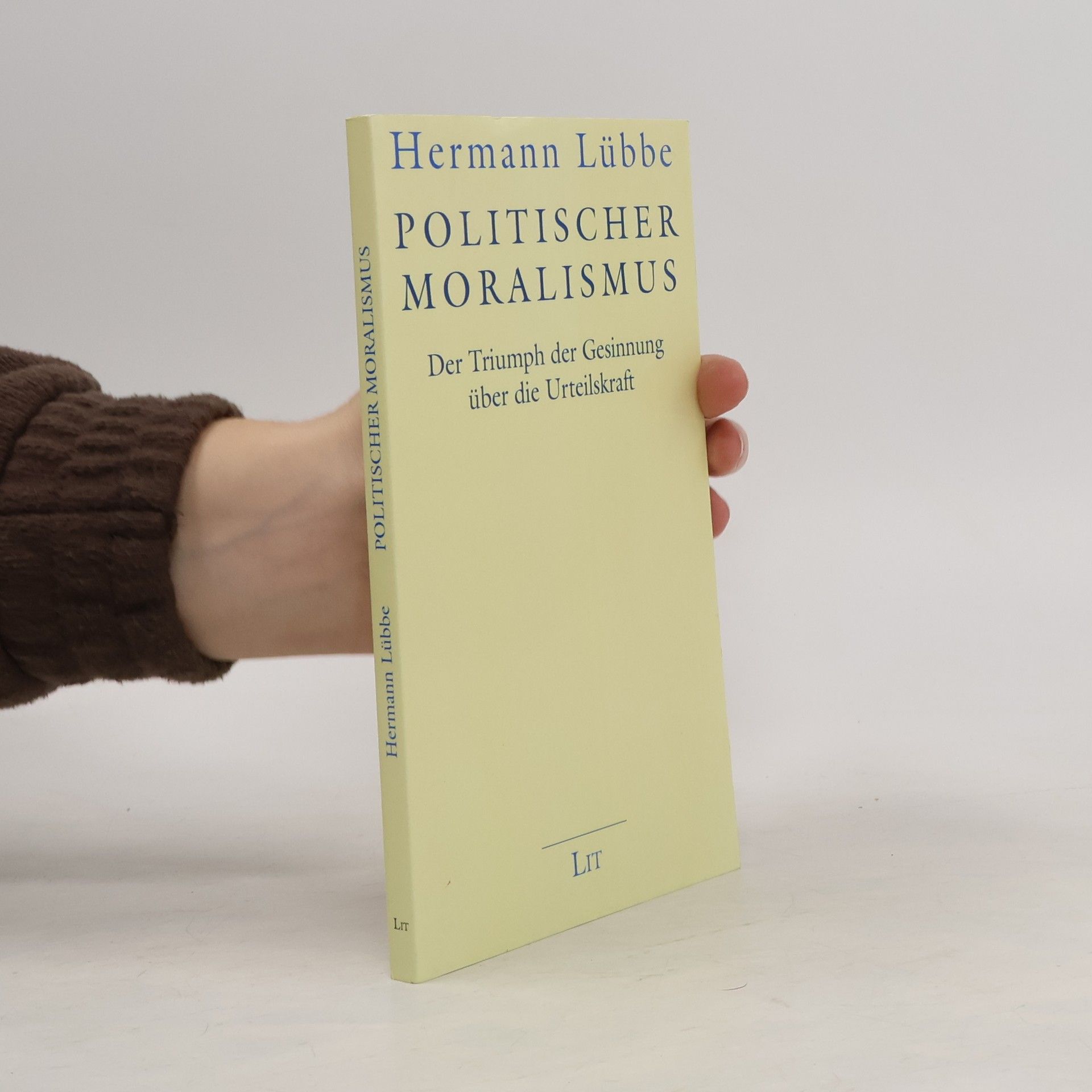
Der Ausbreitungserfolg wissenschaftlichen Wissens beruht nicht auf der Tätigkeit von Propheten und Missionaren. Die Wissenschaft kennt keine heiligen Bücher. Sie verlangt von uns Neugier statt Bekehrung und sie empfiehlt sich überdies durch die Lebens-vorzüge ihrer technischen, organisatorischen und kulturellen Nutzung. Zur Attraktivität dieser Lebensvorzüge gehört, dass sie die Werte unserer kulturellen Herkunftswelten gar nicht in Frage stellen. Modernisierungsschübe begünstigen sogar Renaissancen kulturell massgebender Traditionen. Auch für die Religionen gilt das – im Orient wie im Westen, in den USA zum Beispiel. Die ökumenisch, nämlich global gewordene moderne Zivilisation bleibt somit eine Zivilisation der Vielfalt – regional und national, nach Staaten und Religionsgemeinschaften. Nicht immer handelt es sich dabei um eine friedliche Welt, wie uns aggressive Fundamentalismen lehren. Aber die Zwänge der Kooperation, ohne die die Lebensvorzüge der modernen Zivilisation nicht zu haben wären, wachsen. Sogar Demokratisierungszwänge sind wirksam – nicht wegen der unwiderstehlichen Zugkraft westlicher politischer Ideale, vielmehr wegen der Abhängigkeit moderner Wohlfahrt von expandierenden Freiräumen individueller und kollektiver Selbstbestimmung.
Ich entschuldige mich
- 144 Seiten
- 6 Lesestunden
Willy Brandts Kniefall 1970 vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos bleibt unvergessen und markiert den Beginn einer Tradition öffentlicher Entschuldigungen. Bill Clinton gesteht vor der Community of Kisowera School ein, dass Amerika unrechtmäßig vom Sklavenhandel profitierte. Johannes Rau bittet vor der Knesset in Jerusalem um Verzeihung für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Der Papst nutzt das Heilige Jahr, um für die Sünden der Kirche während der Kreuzzüge und der Inquisition um Vergebung zu bitten. Hermann Lübbe beschreibt die Praxis führender Politiker, die Untaten ihrer Nation öffentlich zu bekennen, die weltweit an Bedeutung gewinnt. Dieser neue Ritus fördert eine „Geschichtsmoral“, die eine umfassende Anerkennung der Vergangenheit verlangt, was zur Zeit des Kalten Krieges unvorstellbar war. Jedes Bekenntnis zur Täterschaft kann für eine Gemeinschaft ebenso prägend sein wie die Erinnerung an die Leiden der Opfer. Die Worte öffentlicher Bitten um Vergebung sind stark vom religiösen Bereich geprägt, was eine Analyse der Sprache notwendig macht. Lübbe untersucht dieses gesellschaftspolitische Phänomen mit scharfer Zunge und Verstand, als Grenzgänger zwischen den Disziplinen.
Zwischen Herkunft und Zukunft
- 59 Seiten
- 3 Lesestunden
Die Zukunft der modernen Industriegesellschaft hängt letztlich nicht von ökonomischen, vielmehr von kulturellen und politischen Faktoren ab. Das erfahren heute alle, die in Wirtschaft und Verwaltung, in Politik und Wissenschaft für diese Zukunft einstehen. Im vorliegenden Buch wird zunächst die gewandelte Einstellung in der Bevölkerung zu ihren industriegesellschaftlichen Lebensgrundlagen untersucht; die Ursachen reichen weit über die uns bedrängenden ökologischen Probleme hinaus. Dennoch bringen sich Wohlfahrt und Freiheit unverändert als Lebensvorzüge der modernen Industriegesellschaft zur Geltung. Der Aufbruch im Bereich des ehemaligen Sozialismus demonstriert das eindrucksvoll. Als orientierungspraktisch-kulturelle Konsequenz ergibt sich: Verlangt ist nicht die Suche nach großen alternativen Gesellschaftsentwürfen, vielmehr politische, ökonomische und wissenschaftlich-technische Steuerungskunst unter den moralischen und kulturellen Zielvorgaben des Gemeinsinns.
Geschichtsbewusstsein der Deutschen
- 255 Seiten
- 9 Lesestunden
Text: German