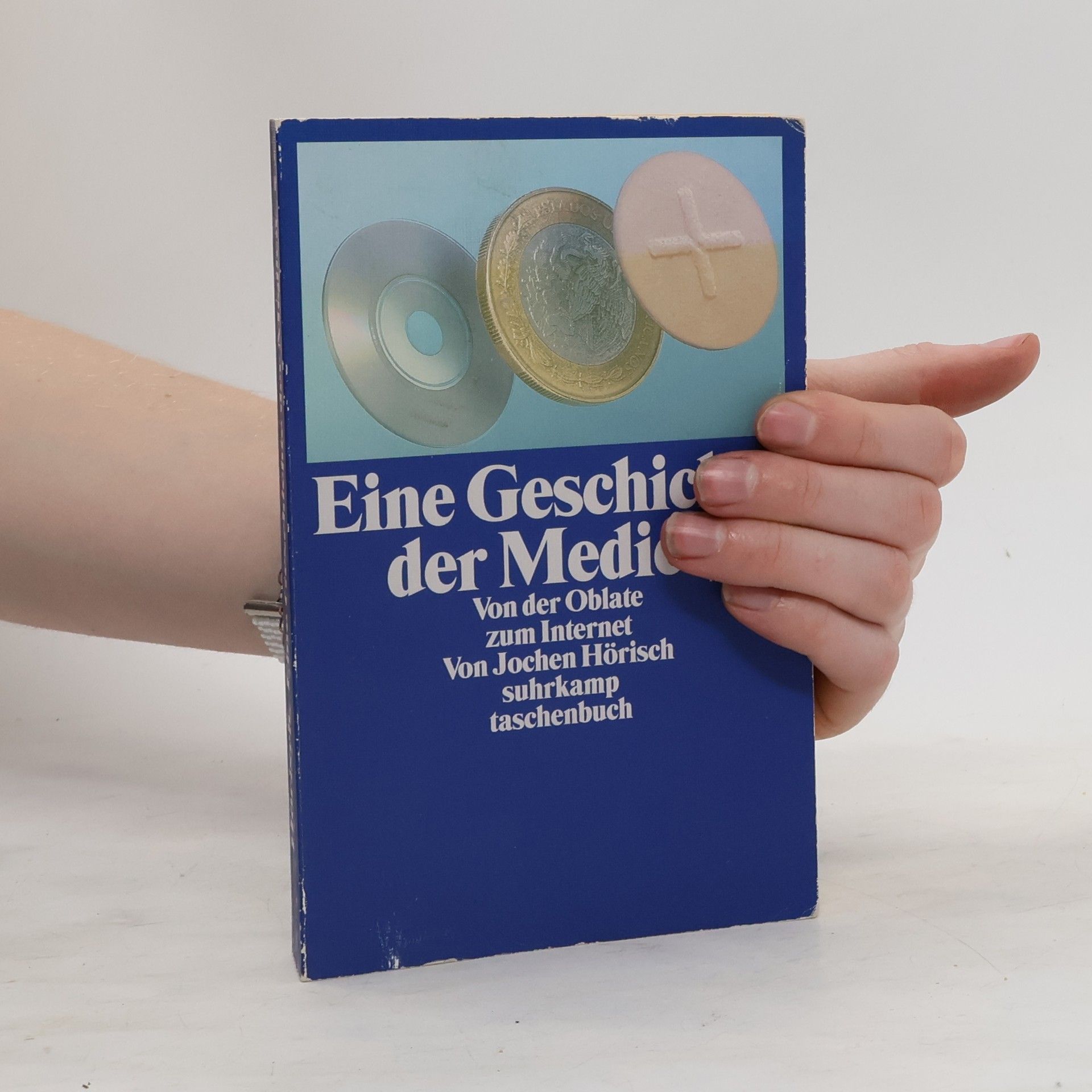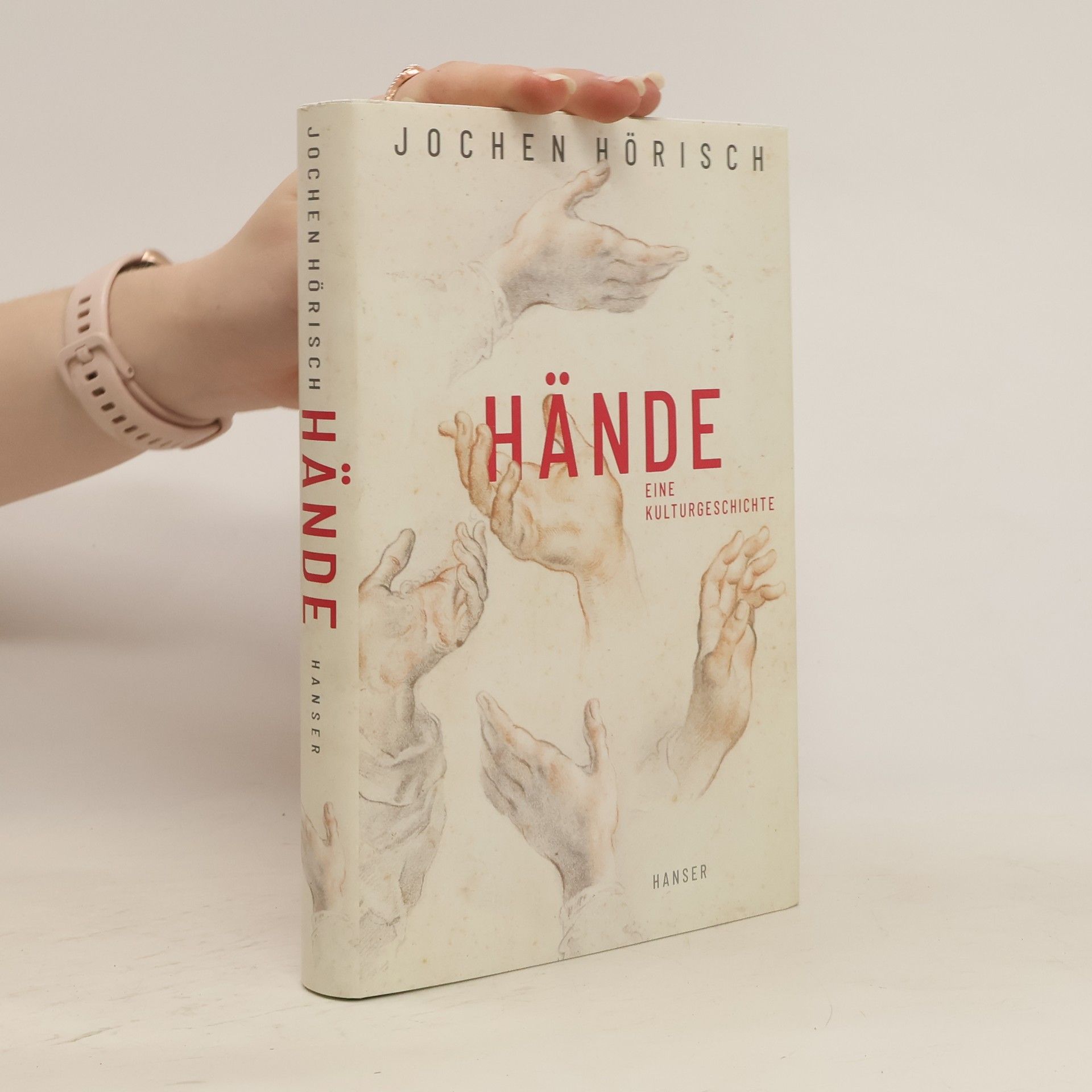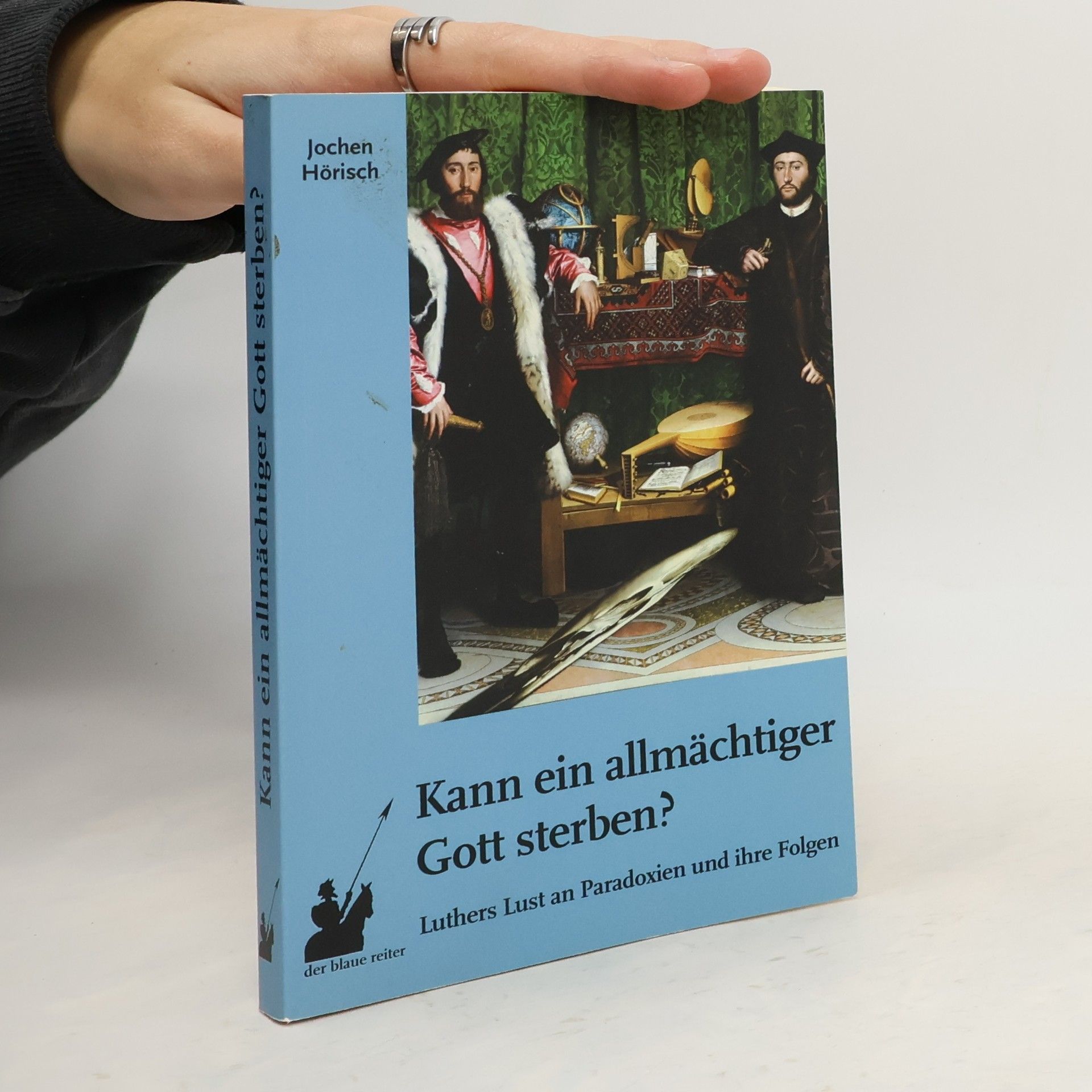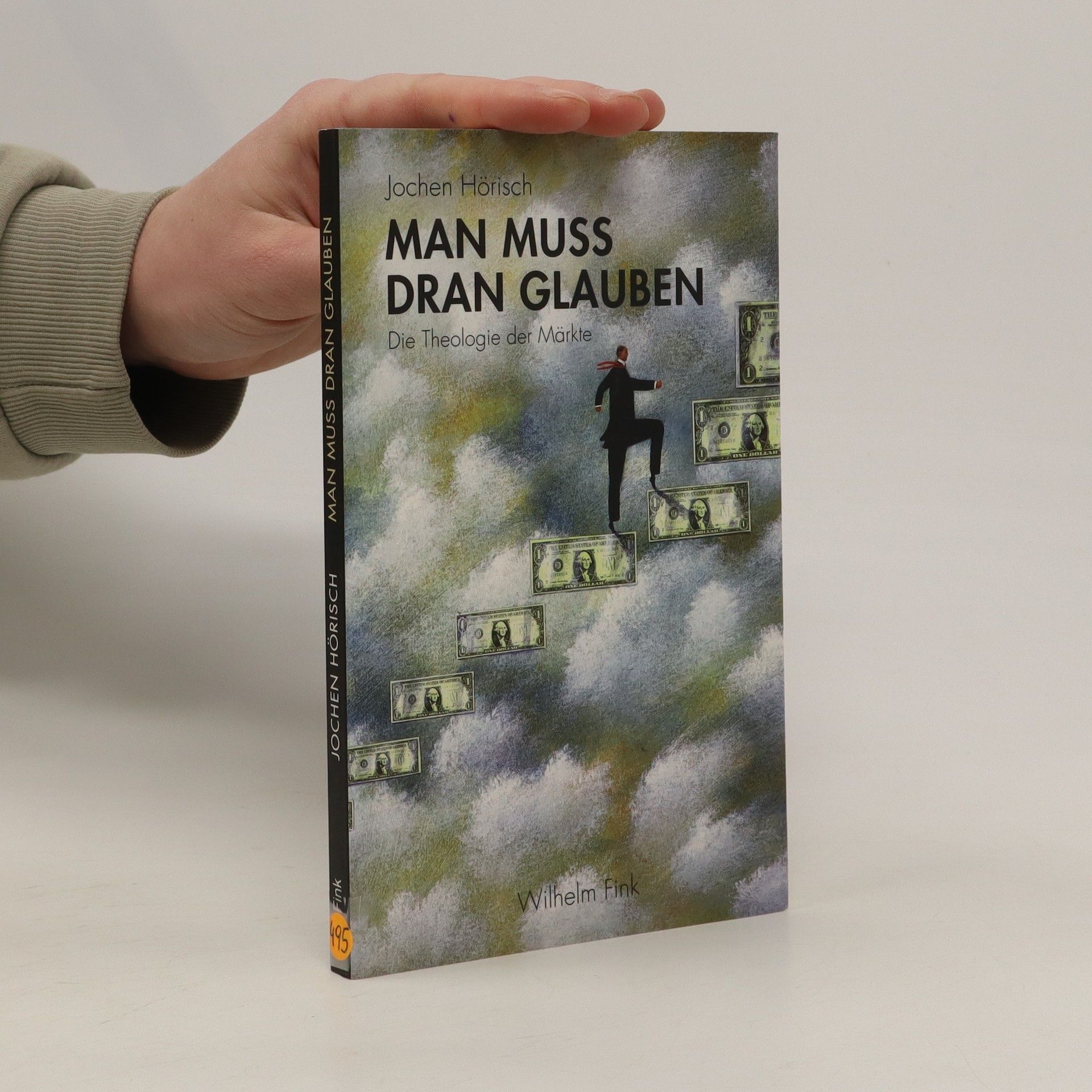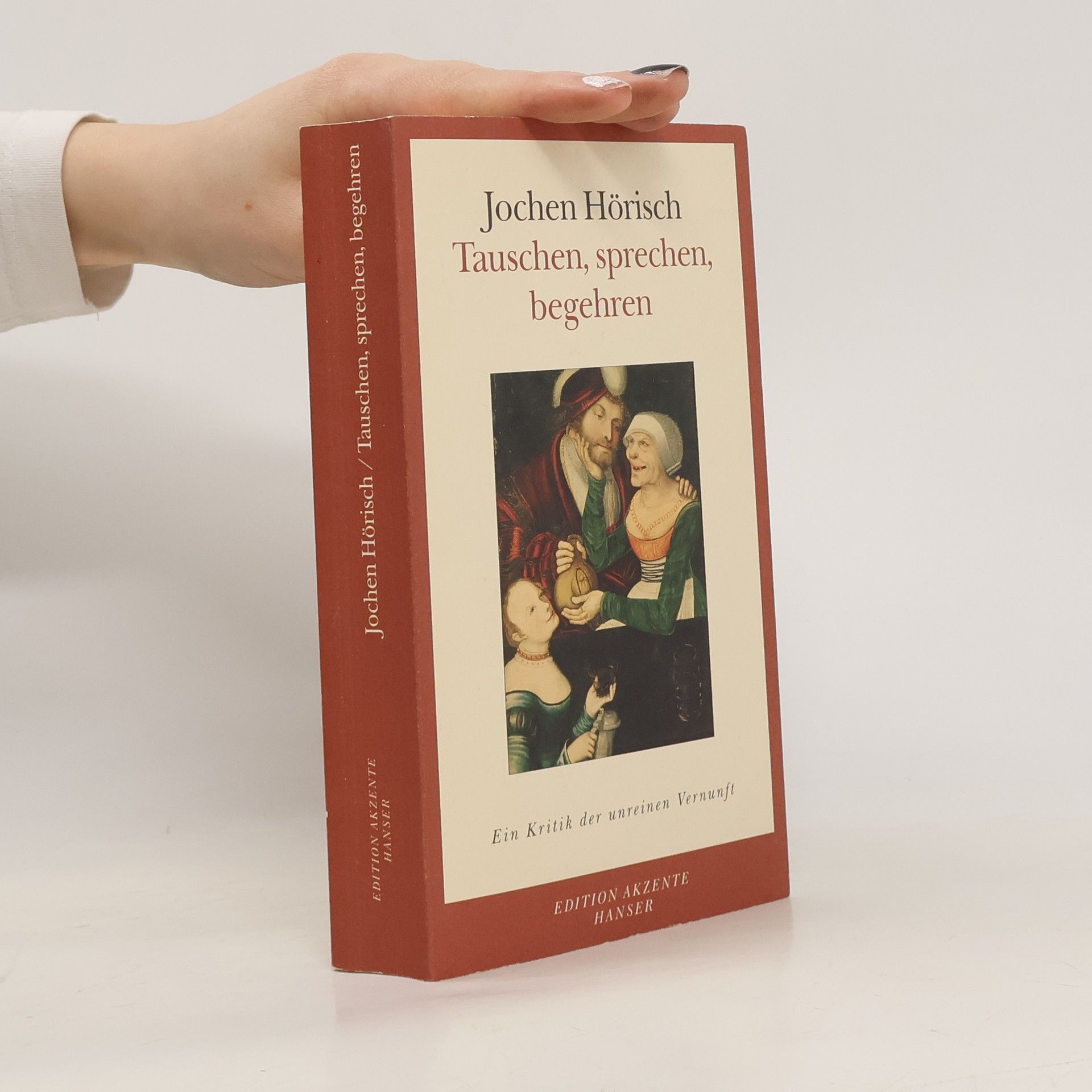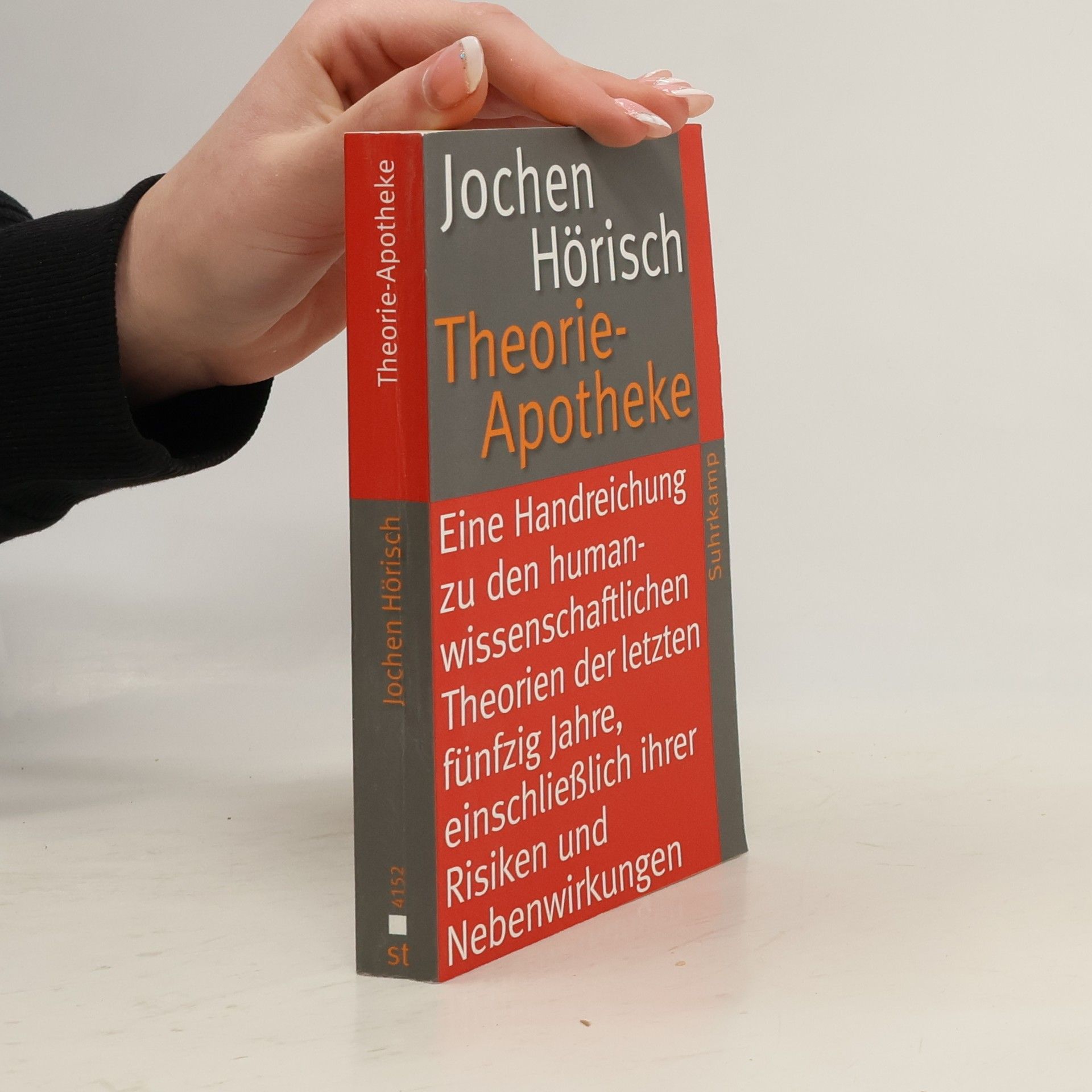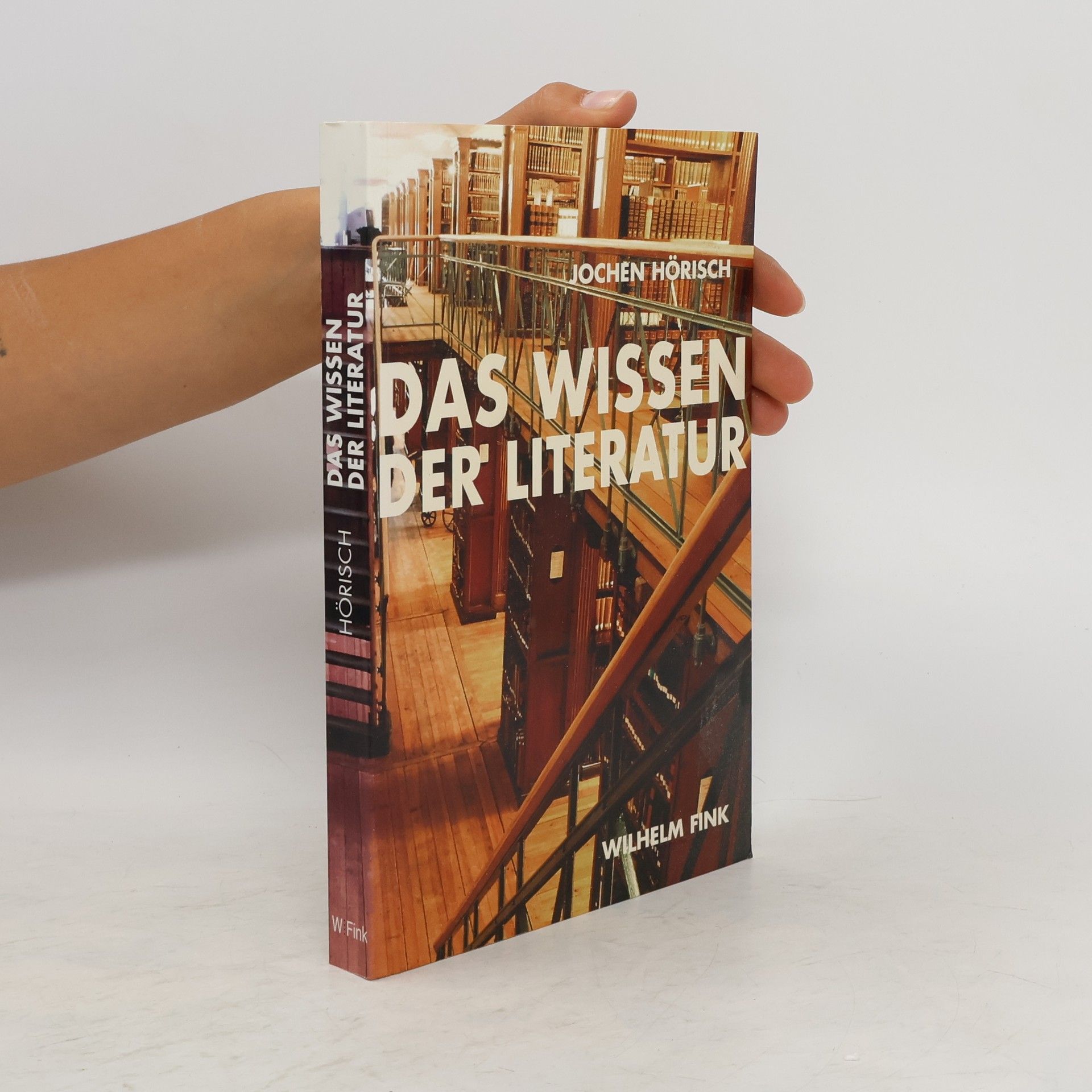Der Dilettantismus der Geisteswissenschaften
Studien zur Funktion von Denkmodellen, Medien, Ökonomie und Politik
- 440 Seiten
- 16 Lesestunden
Der Autor Jochen Hörisch ermutigt dazu, disziplinäre Grenzen zu überschreiten und einen breiten Blick auf verschiedene Themen zu werfen. In seinen Essays behandelt er vielfältige Aspekte wie die Psychoanalyse des Eigennamens, Rechtspopulismus und die Auswirkungen von Freundschaft im Internet. Durch seinen Ansatz des "ambitionierten Dilettantismus" gelingt es ihm, überraschende Einsichten zu gewinnen, die oft spezialisierten Denkweisen entgehen. Hörischs stilistische Prägnanz und intellektuelle Neugier fördern ein tieferes Verständnis vertrauter Sphären.