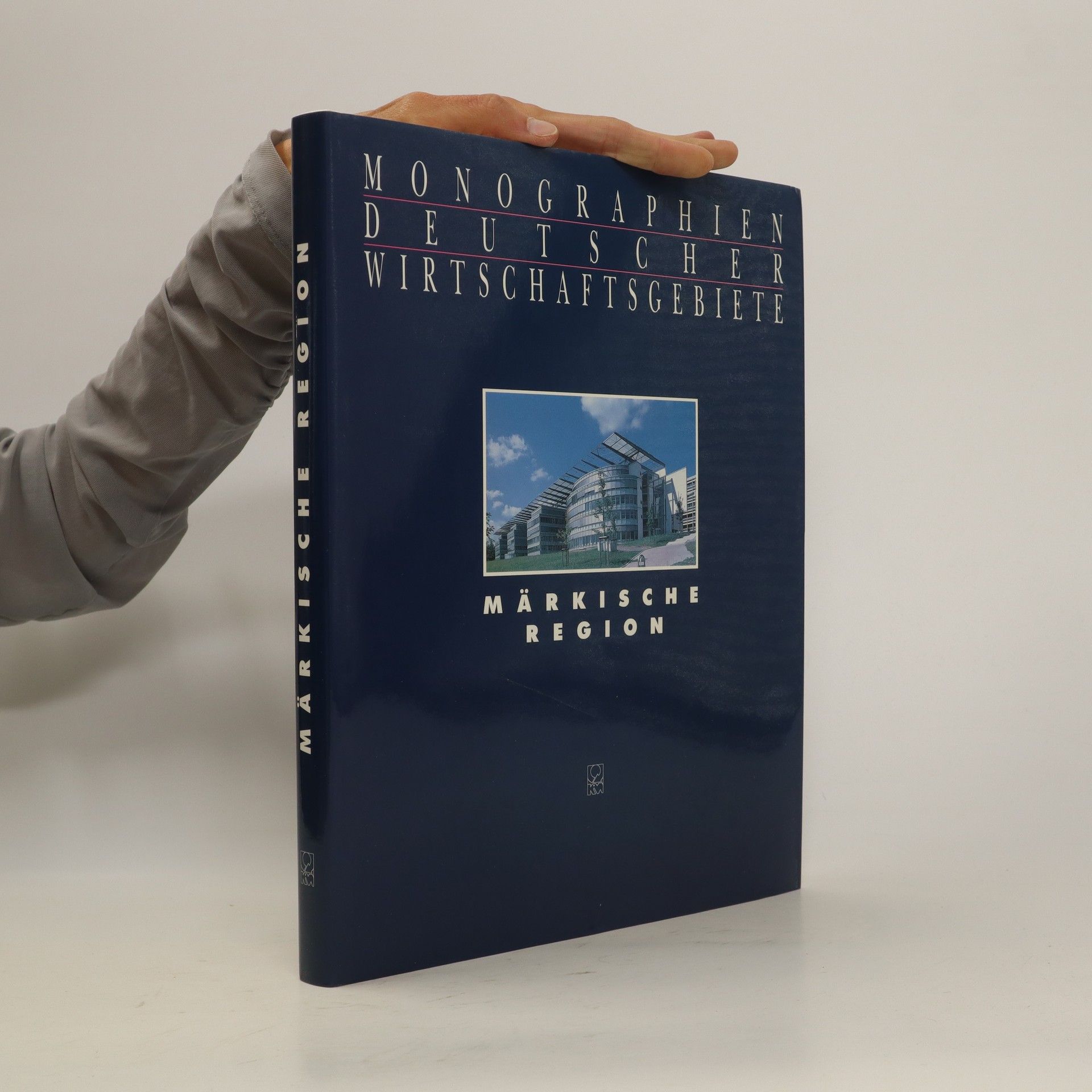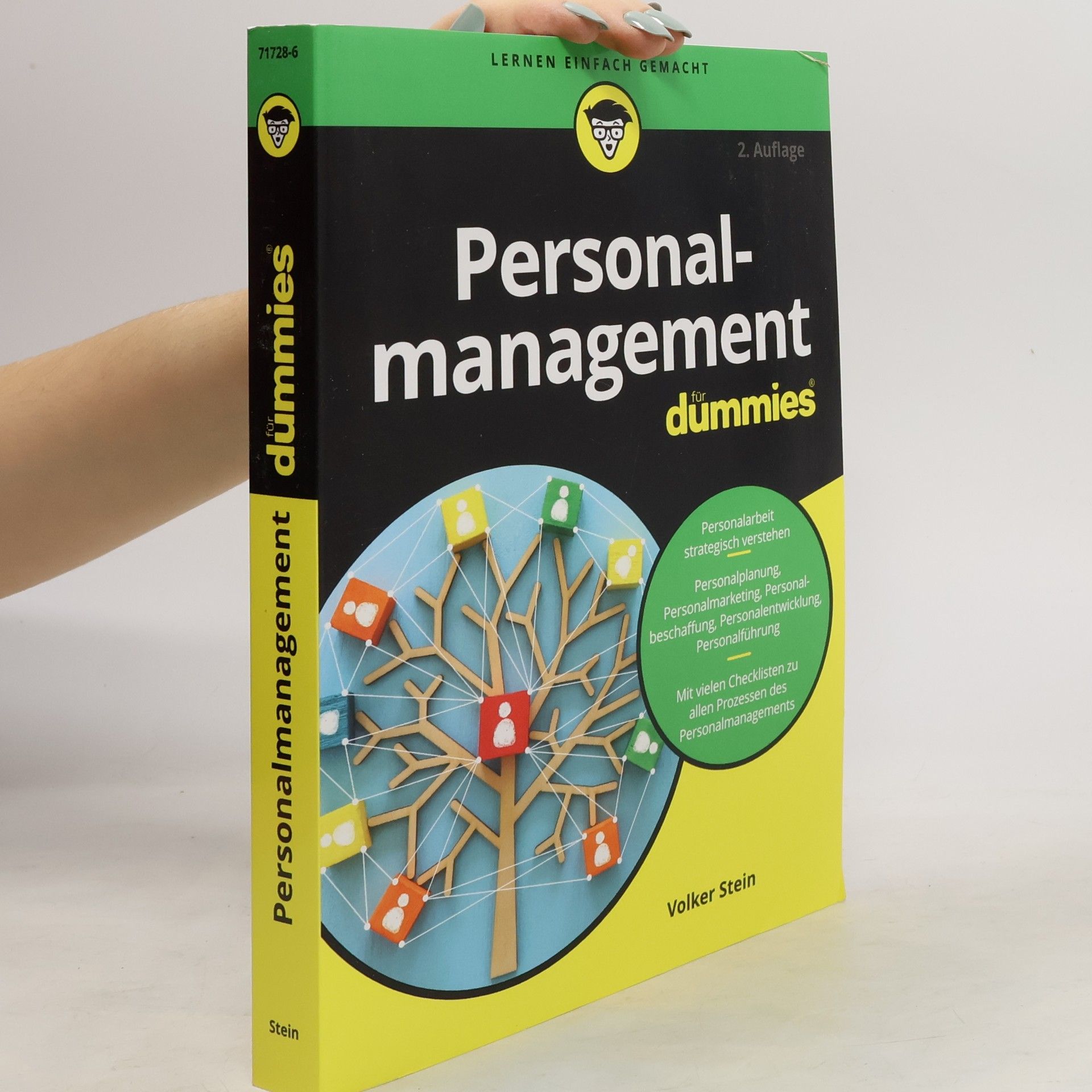Personalmanagement für Dummies
- 428 Seiten
- 15 Lesestunden
Dieses Buch erläutert anhand von vielen Beispielen und Checklisten die Bedeutung des Personalmanagements für Unternehmen. Der Autor zeigt auf, wie man den unterschiedlichen Anspruchsgruppen im Unternehmen begegnen kann, damit die personal- und mitarbeiterbezogenen Ziele erreicht werden können: nicht nur den Mitarbeitern und Zeitarbeitnehmern, sondern auch den Führungskräften, dem Betriebsrat, den Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Dabei weist er darauf hin, wo personalwirtschaftliche Besonderheiten für kleine und mittlere Unternehmen auftauchen. So kann ein professionelles Personalmanagement einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Unternehmenserfolg leisten.