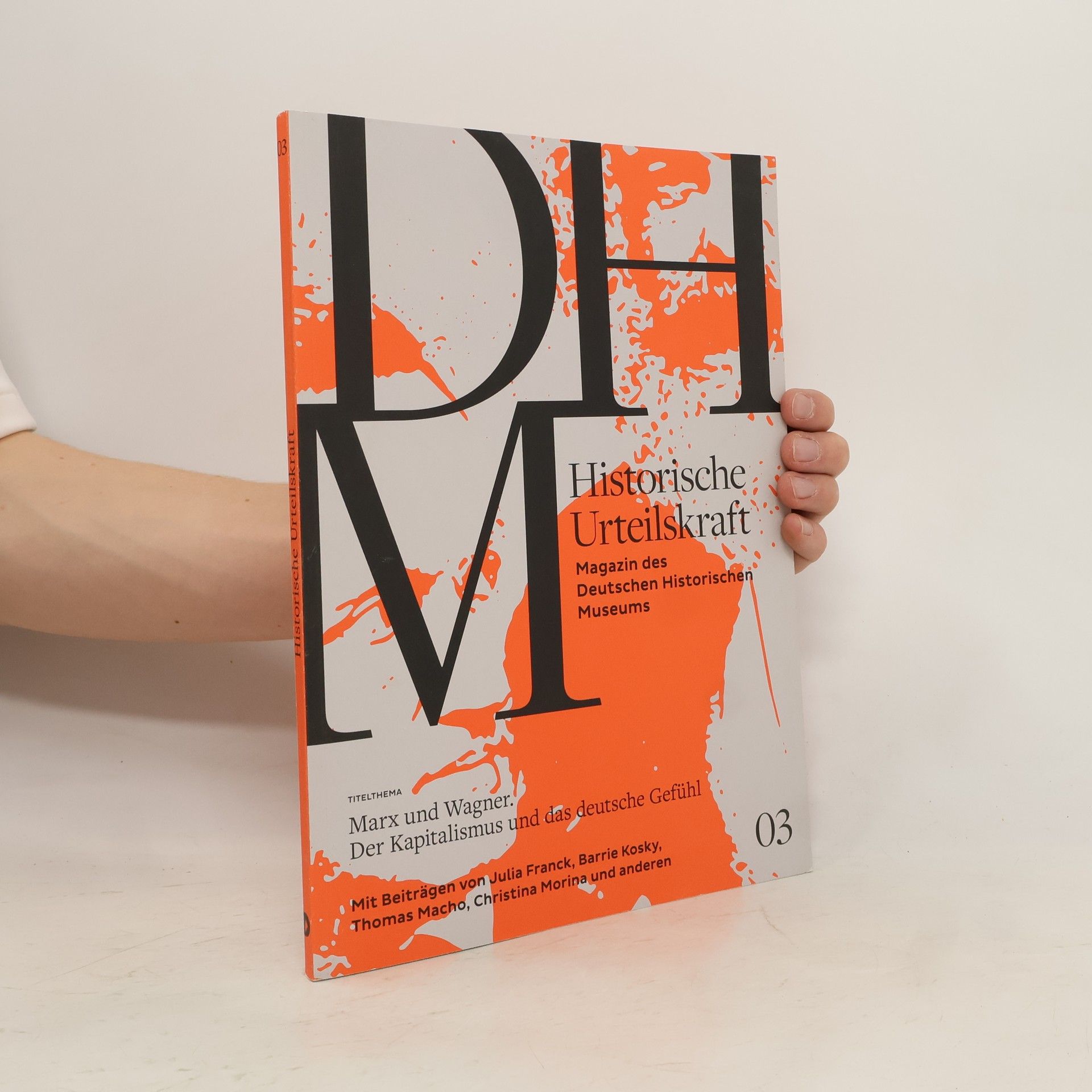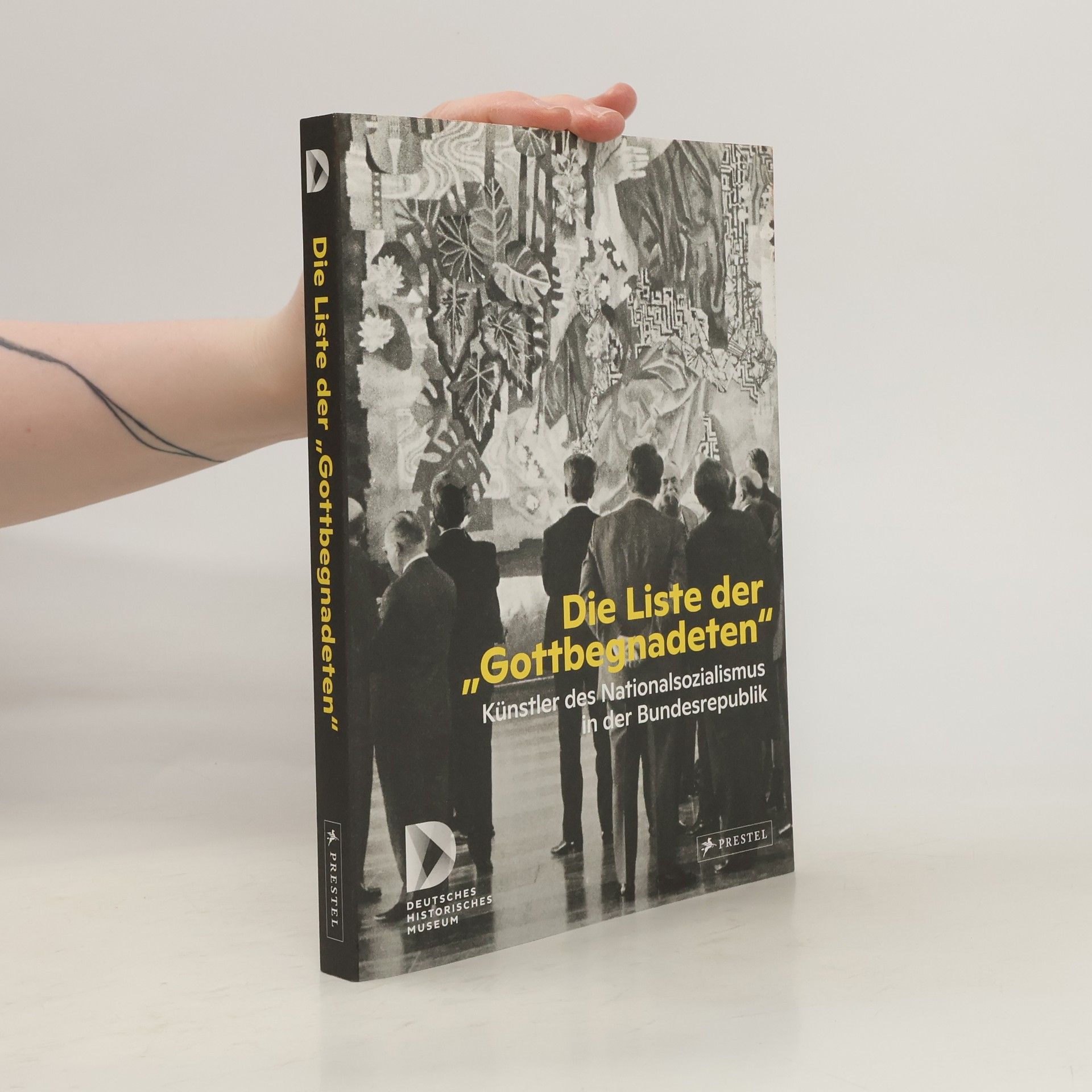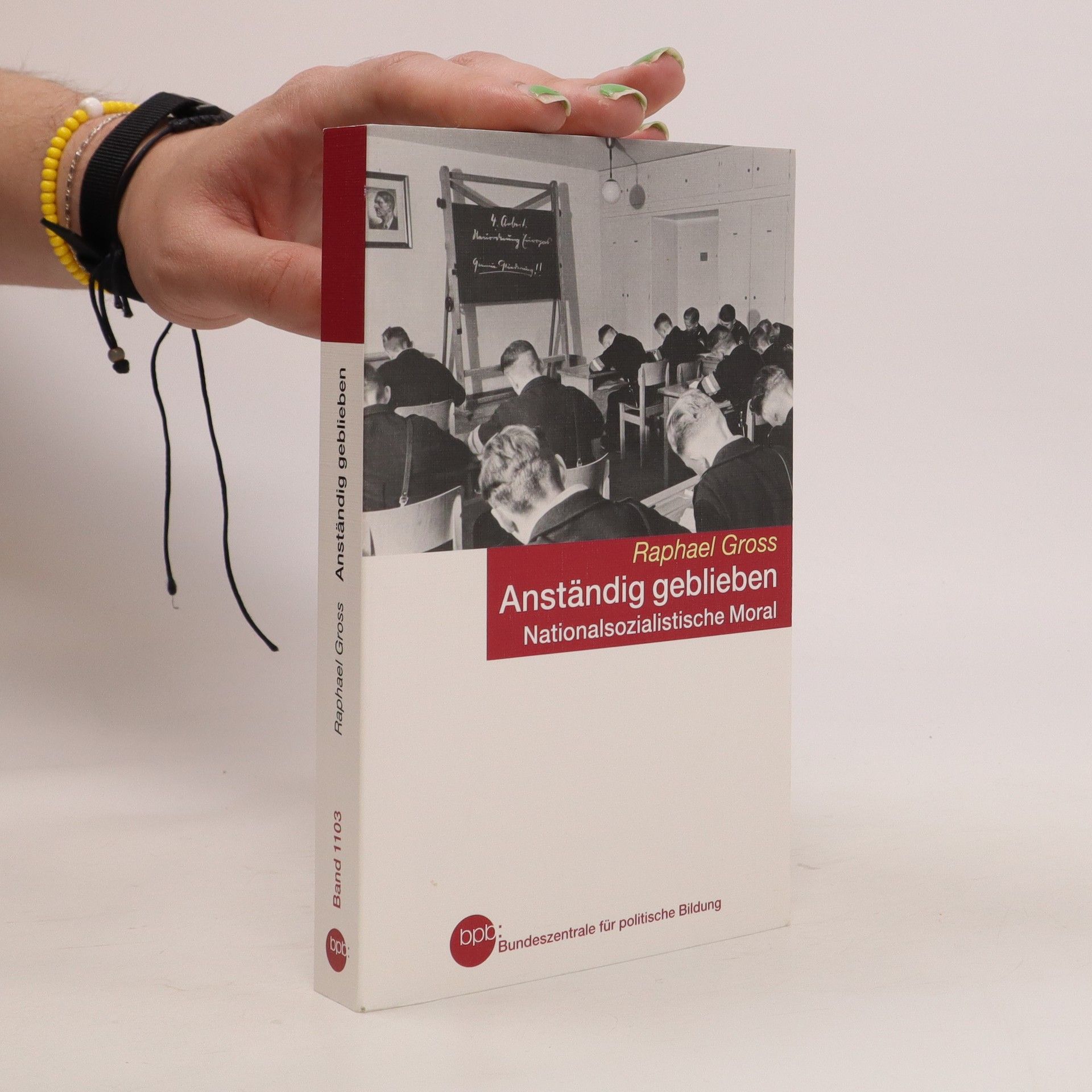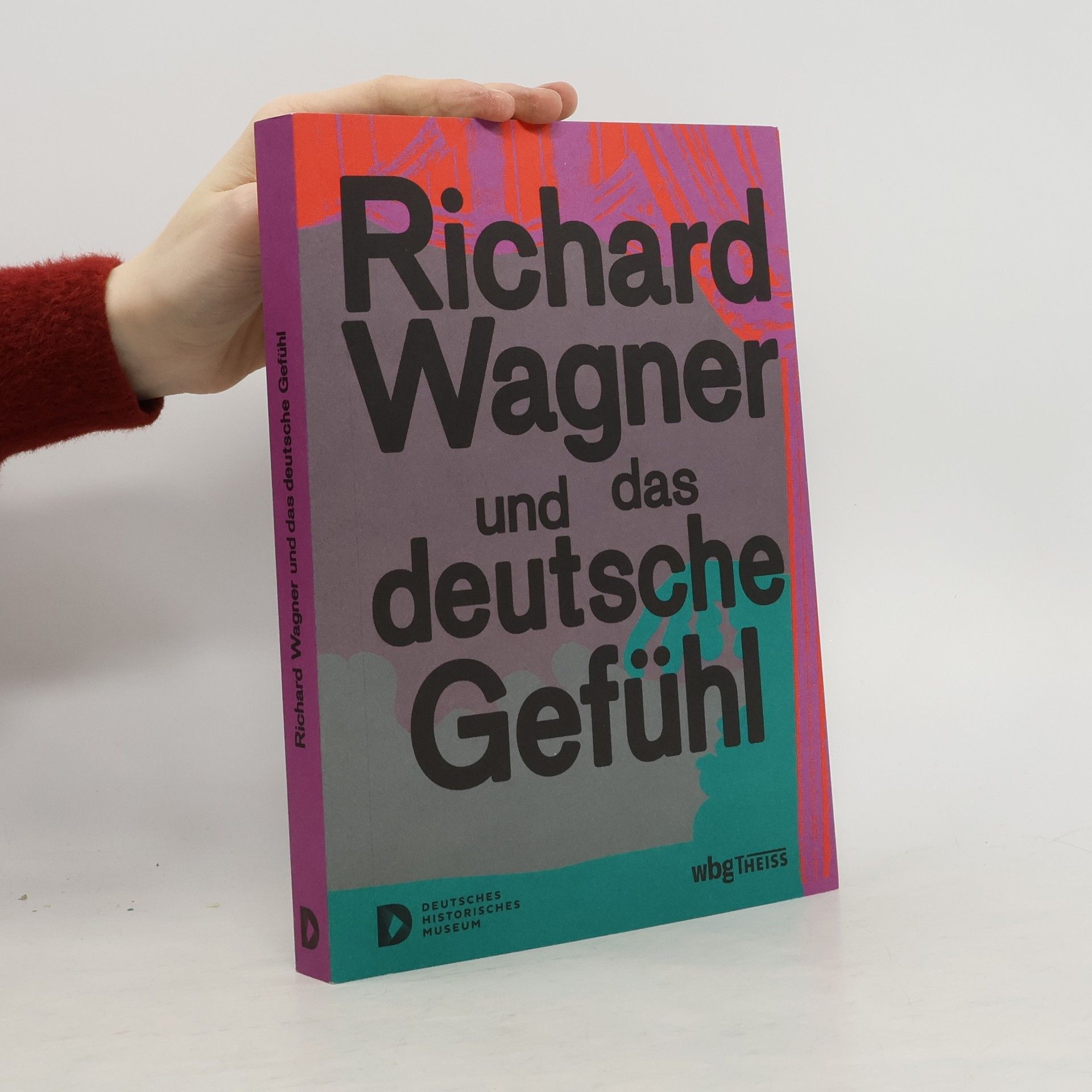Gewalt ausstellen: Erste Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa, 1945–1948
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
Das Buch zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum In den unmittelbaren Nachkriegsjahren trat ein bislang kaum beachtetes, aber historisch prägendes Phänomen auf: Gewalt und Vernichtung, die der Zweite Weltkrieg und die Besetzung weiter Teile Europas durch das nationalsozialistische Deutschland verursacht hatten, wurden Gegenstand von Ausstellungen. Von 1945 bis 1948 eröffneten in den ehemals besetzten Ländern in Ost- wie Westeuropa zahlreiche Ausstellungen, die Hunderttausende Besucher sahen. Die Beiträge in diesem Band zeigen, wie in London, Paris, Warschau, Liberec und Bergen-Belsen erste Ausstellungen zur jüngsten Gewaltgeschichte realisiert wurden, Erzählungen von Zerstörung, Opfern, Widerstand und Kollaboration entstanden und wie jüdische Überlebende, die in diesen zumeist nationalen Konzeptionen keinen Platz fanden, den Holocaust dokumentierten und an die Öffentlichkeit brachten. In Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum »Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa«. Begleitband zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, Berlin, 24.5. bis 23.11.2025