Kleine Kunstgeschichte Wiens
- 255 Seiten
- 9 Lesestunden
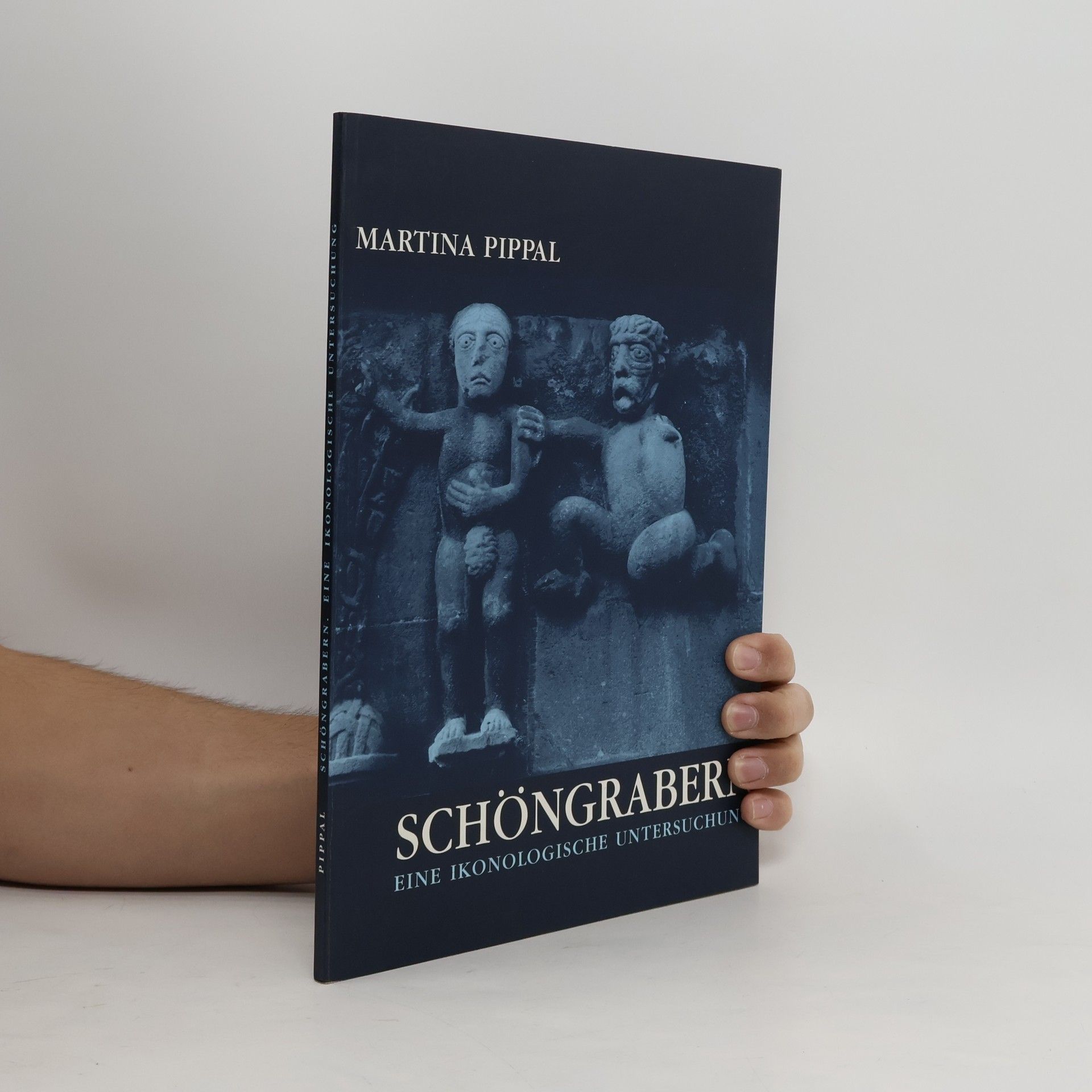
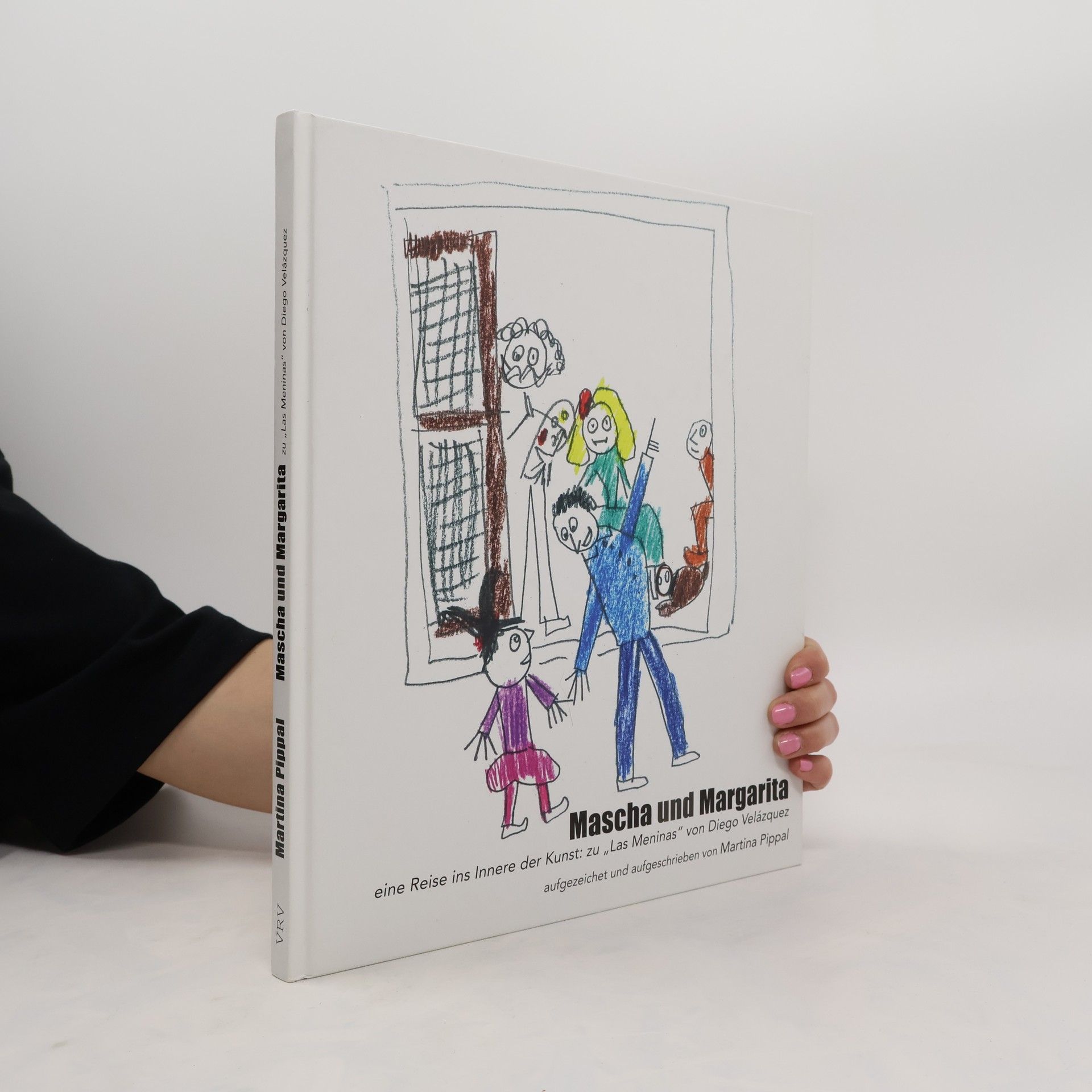


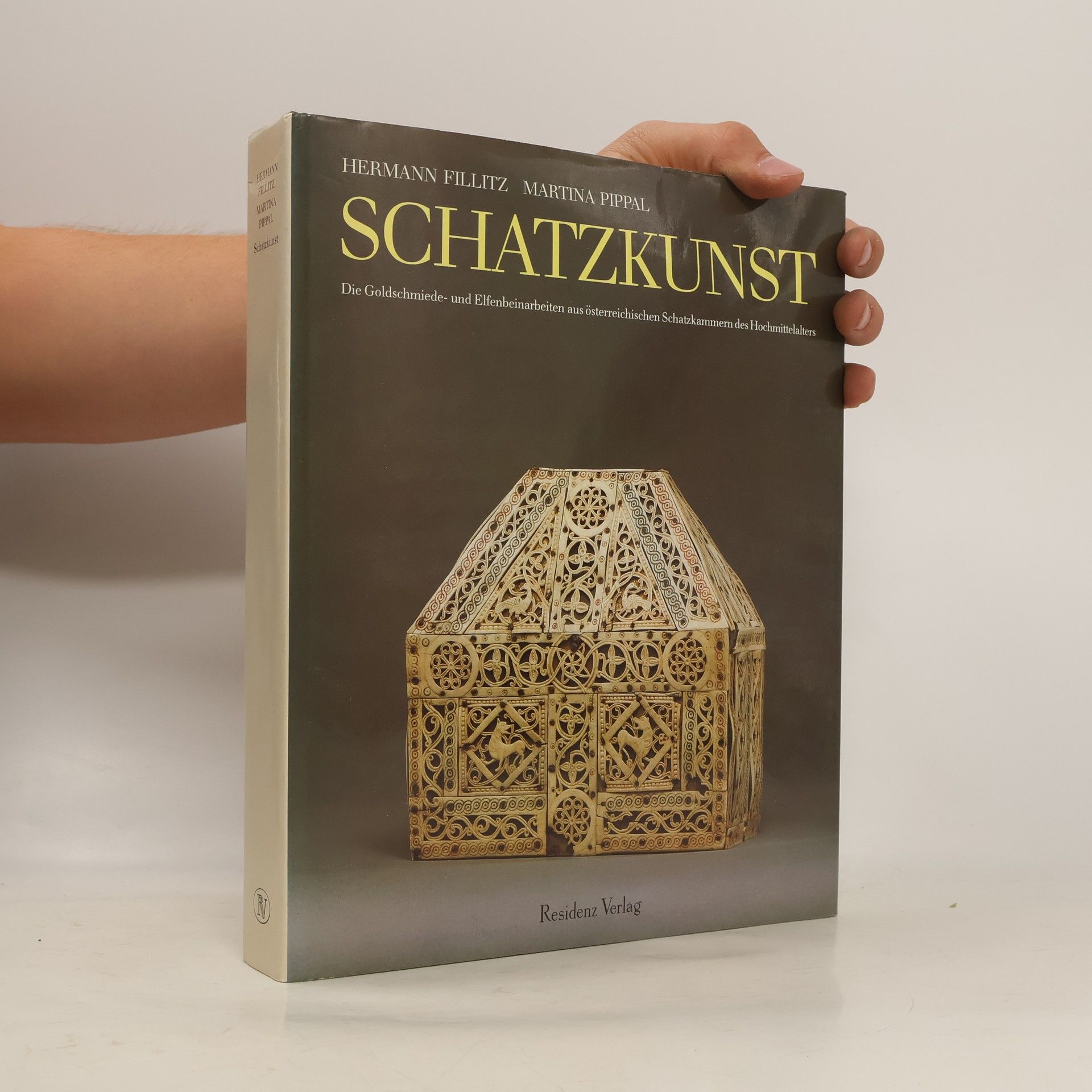

War in den 1980er Jahren schon einmal die Frage im Raum gestanden, ob die Kunstgeschichte am Ende sei, hat sich unser Fach seit dem nicht nur als lebensfähig erwiesen, sondern ein enormes Potential zu einer rasanten Weiterentwicklung offenbart. Eine Art Globalisierungsprozess hinsichtlich des einbezogenen Materials sowie die Vervielfältigung der methodischen Ansätze machen es den Studierenden wie Kunstinteressierten jenseits des Universitätsbetriebs schwer, sich in der Fülle des Angebots zu orientieren. Das vorliegende Buch legt daher bewusst rote Fäden durch die visuellen Medien Architektur, Skulptur, Malerei, etc., die zwischen dem 1. Jh. n. Chr. und dem Übergang von der Romanik zur Gotik in Europa sowie in den an das Mittelmeer südlich und östlich angrenzenden Ländern zur Anwendung kamen. Es zeigt kunstimmanente Zusammenhänge auf, versteht die einzelnen Werke aber zugleich als Stimmen in einem umfassenden Diskurs.
In Städten treten Gegensätze, etwa von Fortschrittlichkeit und Retrospektivität, deutlich hervor – nicht erst heute, sondern schon im 15. Jahrhundert. Vier Kapitel vereinen 18 Perspektiven auf komplexe Phänomene: „Stifter, Stadt und Studium“ fokussiert auf Identitätskonstruktion und kulturelle Identitätsvernichtung. „Die Entdeckung der Welt“ widmet sich dem Ineinandergreifen von bildender Kunst und „Scientia nova“, das Kapitel „Spielarten des Neuen“ der Rezeption der „ars nova“ aus den Niederlanden, „Import – Export – Migration“ dem Austausch zwischen Wien und anderen Regionen bis hin nach Siebenbürgen.