Der Verlust des Vaters ist ein brutaler Einschnitt, der einen Sohn lebenslang begleitet - und oft auch beschädigt, selbst wenn er es nicht bewußt wahrnimmt. Das Nicht-fragen-können führt viele zu Selbsttäuschung und mitunter auch zu Selbstquälerei. Das Selbstvertrauen steht nicht selten auf wackligem Grund. Kernstück dieses Buches bilden die Lebensberichte von Männern, die zwischen 1933 und 1945 geboren wurden und vaterlos aufwuchsen. Auch wenn sich Vaterbilder und spätere Lebenskonzepte der zurückgebliebenen Söhne unterscheiden: Das Gemeinsame ist die oft uneingestandene lebenslange Trauer, die meist erst spät einsetzende Wahrnehmung von fehlendem Halt und dem ständigen Zwang, die erahnten Defizite zu überwinden. Nicht selten machten die Söhne in Gehorsam zum (fehlenden) Vater oder zur (überforderten, tapferen) Mutter Karriere, engagierten sich sozial oder politisch und unterdrückten ihre Suche nach der eigenen Identität zu Gunsten eines Idealbildes. Die Autoren untersuchen die lebenslange Bedeutung der abwesenden Väter und zeigen Wege, wie Männer mit der Hypothek der Vaterlosigkeit konstruktiv umgehen können.
Jürgen Reulecke Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
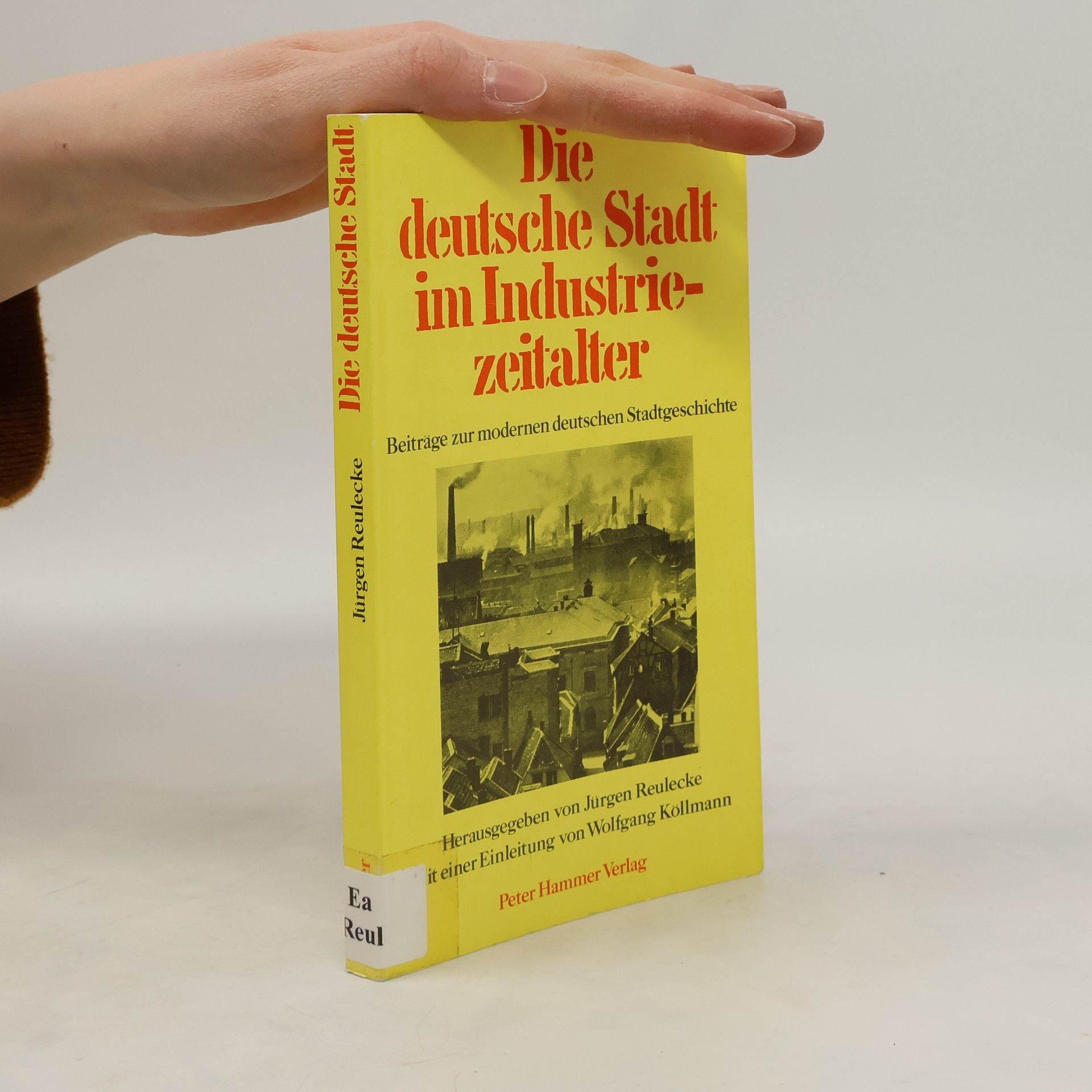
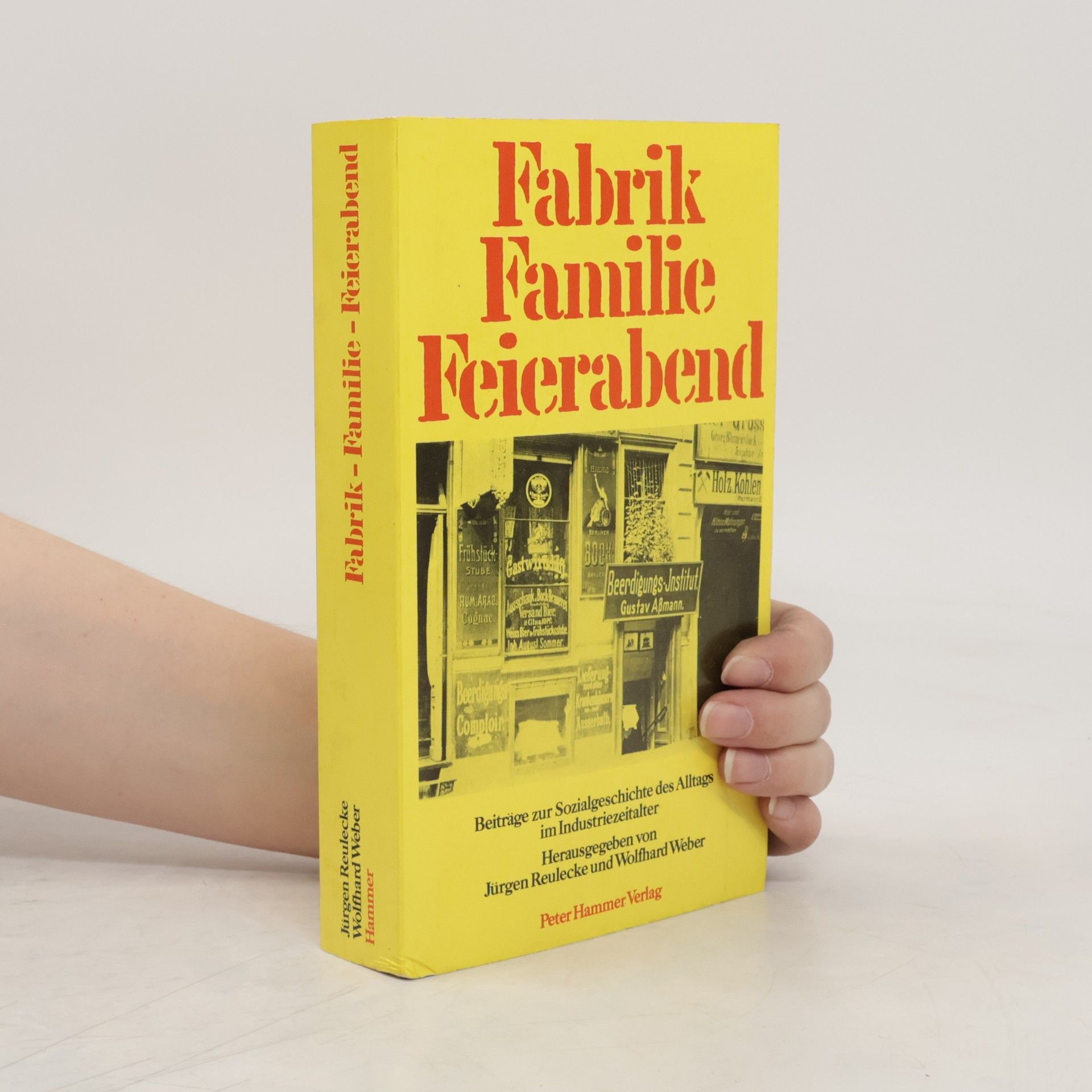
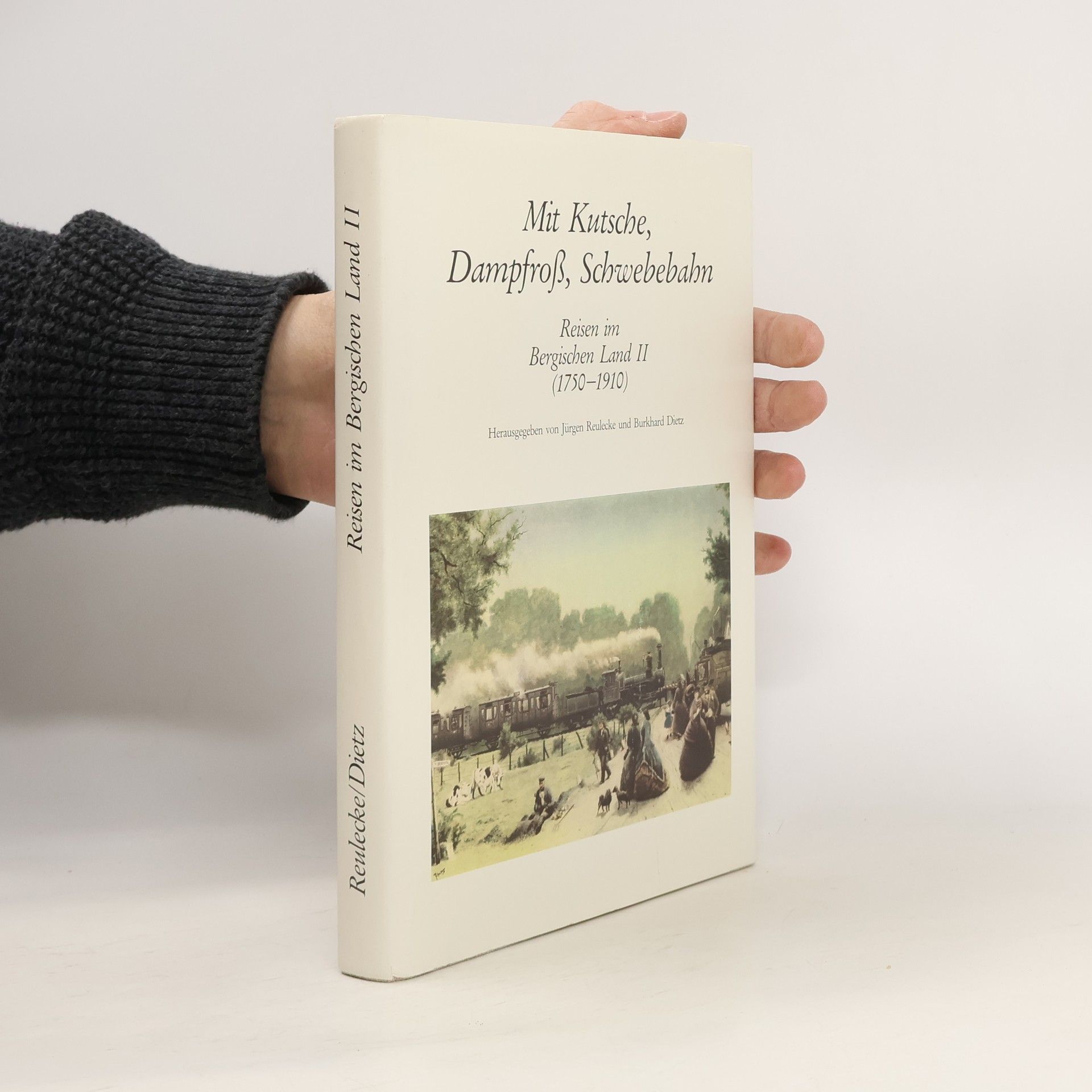

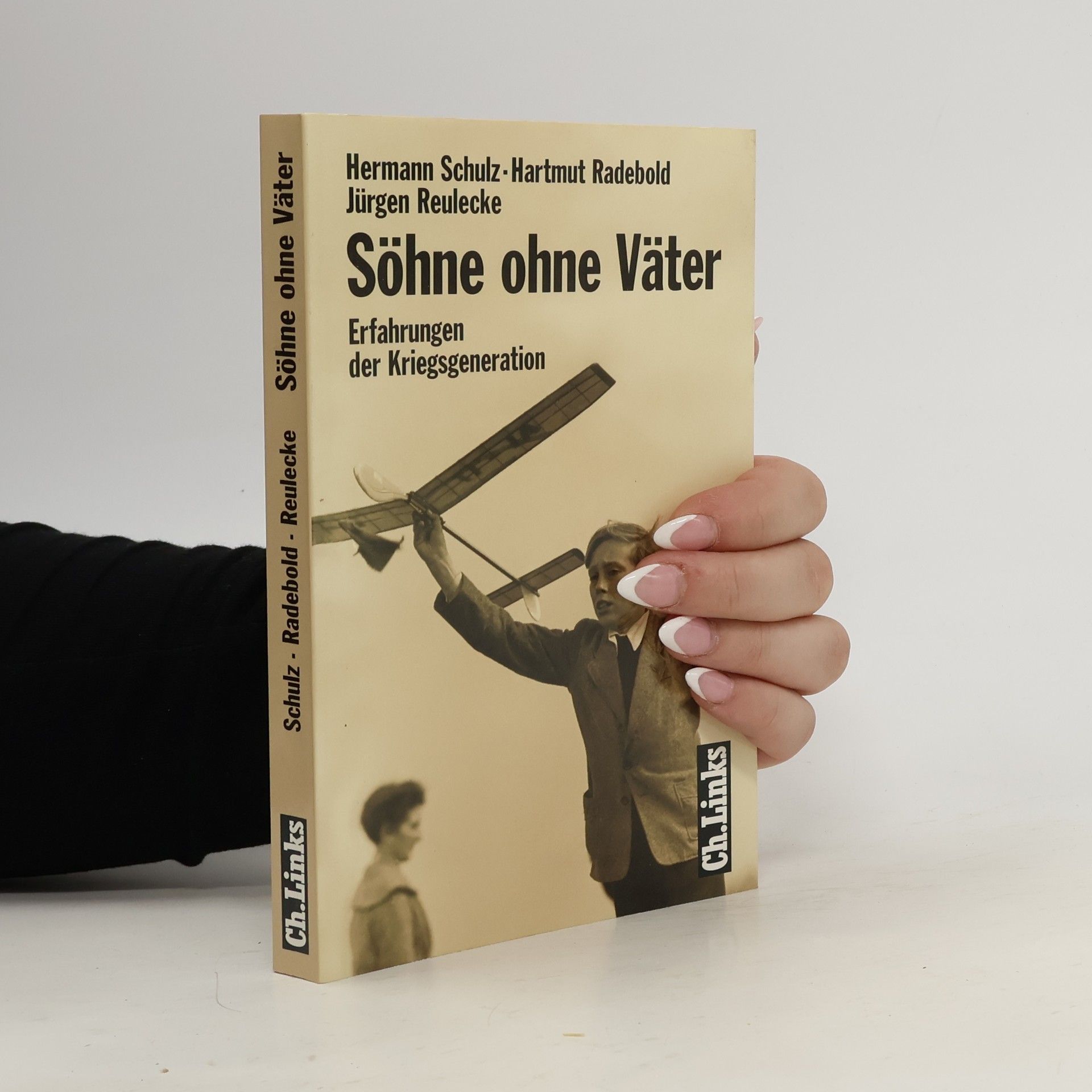

1800-1918. Das bürgerliche Zeitalter 1997 767 S. Hardcover !! Nur Band3!! Gutes Exemplar, geringe Gebrauchsspuren, Cover/SU berieben/bestoßen, innen alles in Ordnung; Good copy, light signs of previous use, cover/dust jacket shows some rubbing/wear, interior in good condition. C250410ah124 ISBN: 9783421031136
Der vorliegende Band schildert im ersten Teil die rechtlichen und sozioökonomischen Grundlagen der modernen Stadt, wie sie seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts geschaffen wurden, verfolgt dann die Etappen der Verstädterung unter dem Einfluß der allgemeinen Mobilisierung der menschlichen und materiellen Ressourcen in der Früh- und Hochindustrialisierungsphase und beschäftigt sich mit den krisenhaften und konfliktträchtigen sozialen Zuspitzungen im Gefolge dieser Entwicklung. Der zweite Teil behandelt die Bewältigungsanstrengungen und Reformbestrebungen, die aufgrund der Herausforderungen in die Wege geleitet wurden, zugleich aber auch die Versuche seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sich verstärkt mit Hilfe von Ideologien vor allem mit dem Phänomen der modernen Großstadt auseinanderzusetzen, und erläutert schließlich die Ereignisse, Prozesse und Eingriffe, die das Städtewesen in Deutschland in den ersten zwei Dritteln unseres Jahrhunderts veränderten.
Mit Kutsche, Dampfross, Schwebebahn
Reisen im Bergischen Land II (1750-1910)
Hrsg. Reulecke, Jürgen ; Weber, Wolfhard 34 Phot., 29 Abb., 25 Tab. 420 S. 2. A.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Barmen von 1910 bis 1925, Band X.
- 219 Seiten
- 8 Lesestunden

