Als historische Studie begonnen, stellt diese brisante Auseinandersetzung mit Rousseau nicht zuletzt eine Theorie des Lesens dar. Erstmals auf Deutsch öffnen die Rousseau-Aufsätze einen scharfsinnigen neuen Zugang zu Rousseau und zu de Mans eigenem Denken. Im Nachwort stellt Gerhard Poppenberg Paul de Mans Reflexionen in den Kontext der Freundschaft zu dem Philosophen Jacques Derrida und beider wirkungsmächtiger Auseinandersetzung mit Rousseau.
Paul de Man Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Paul de Man war ein belgisch-amerikanischer Literaturkritiker und Theoretiker der Dekonstruktion. Seine Arbeit konzentrierte sich darauf, traditionelle Interpretationen in Frage zu stellen und die inhärenten Widersprüche in literarischen Texten aufzudecken. De Mans Einfluss auf die Literaturtheorie ist bedeutend, auch wenn sein Vermächtnis durch Enthüllungen über seine Kriegsaktivitäten kompliziert wurde. Er war eine zentrale Figur der sogenannten Yale School der Dekonstruktion und prägte die Arbeit vieler nachfolgender Gelehrter.


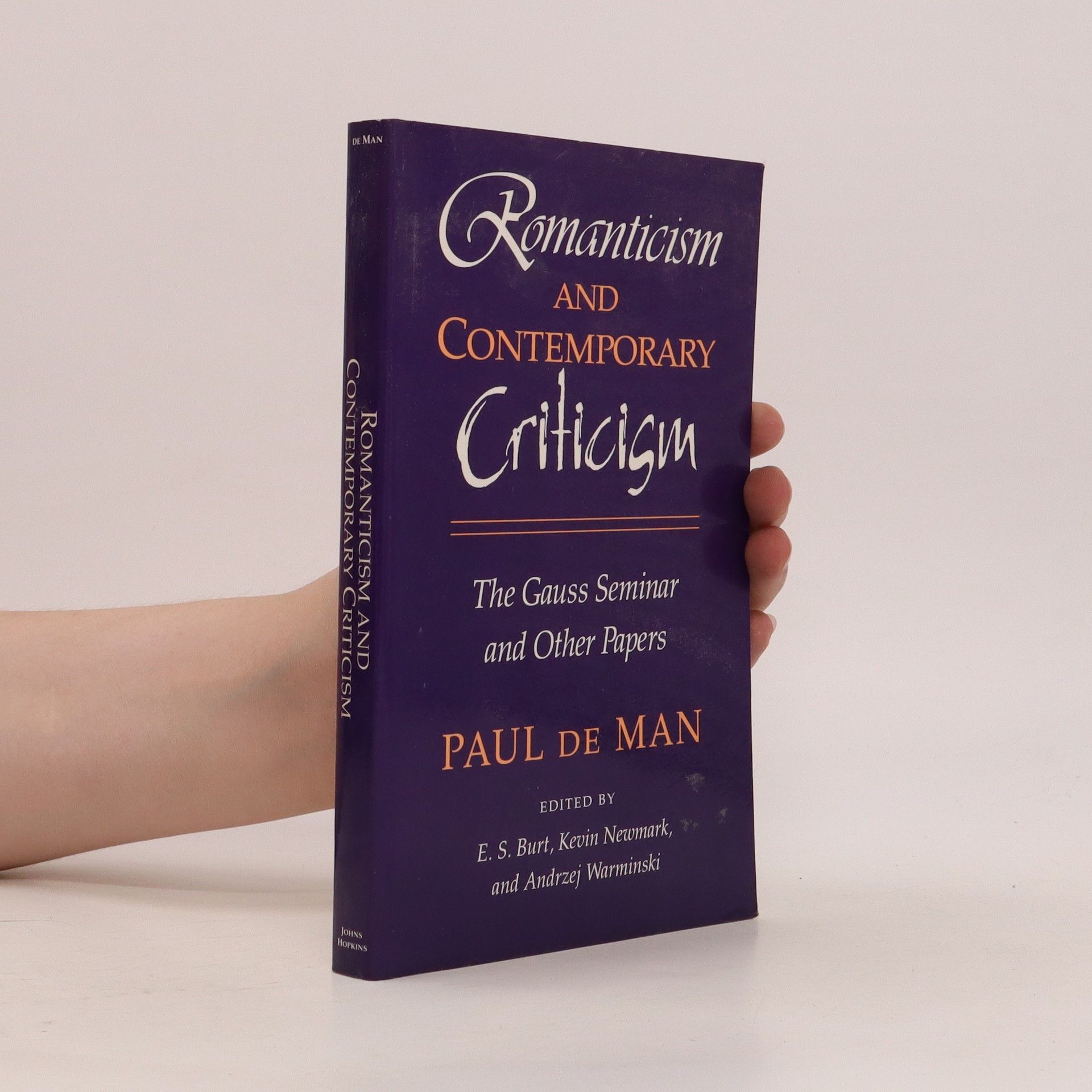

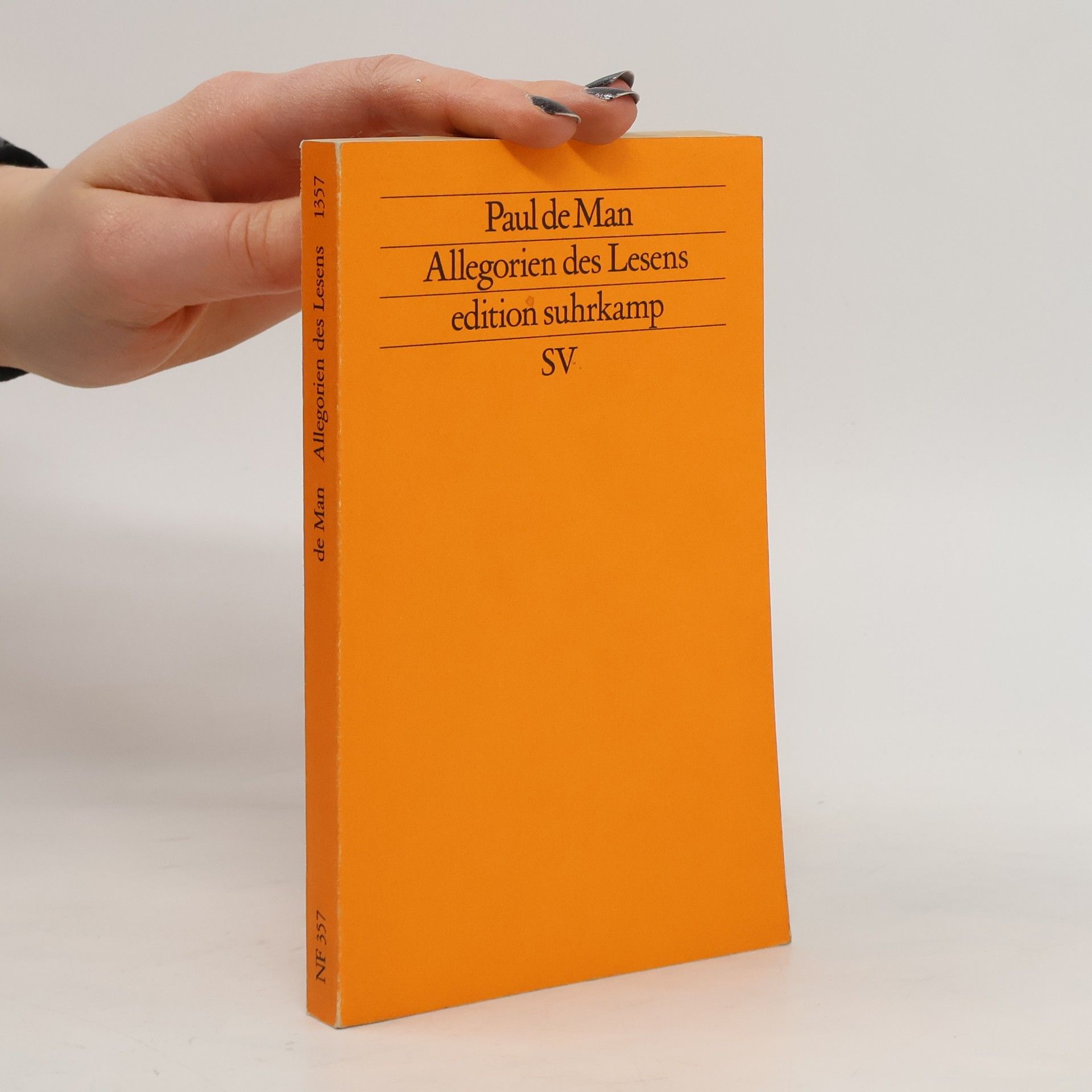
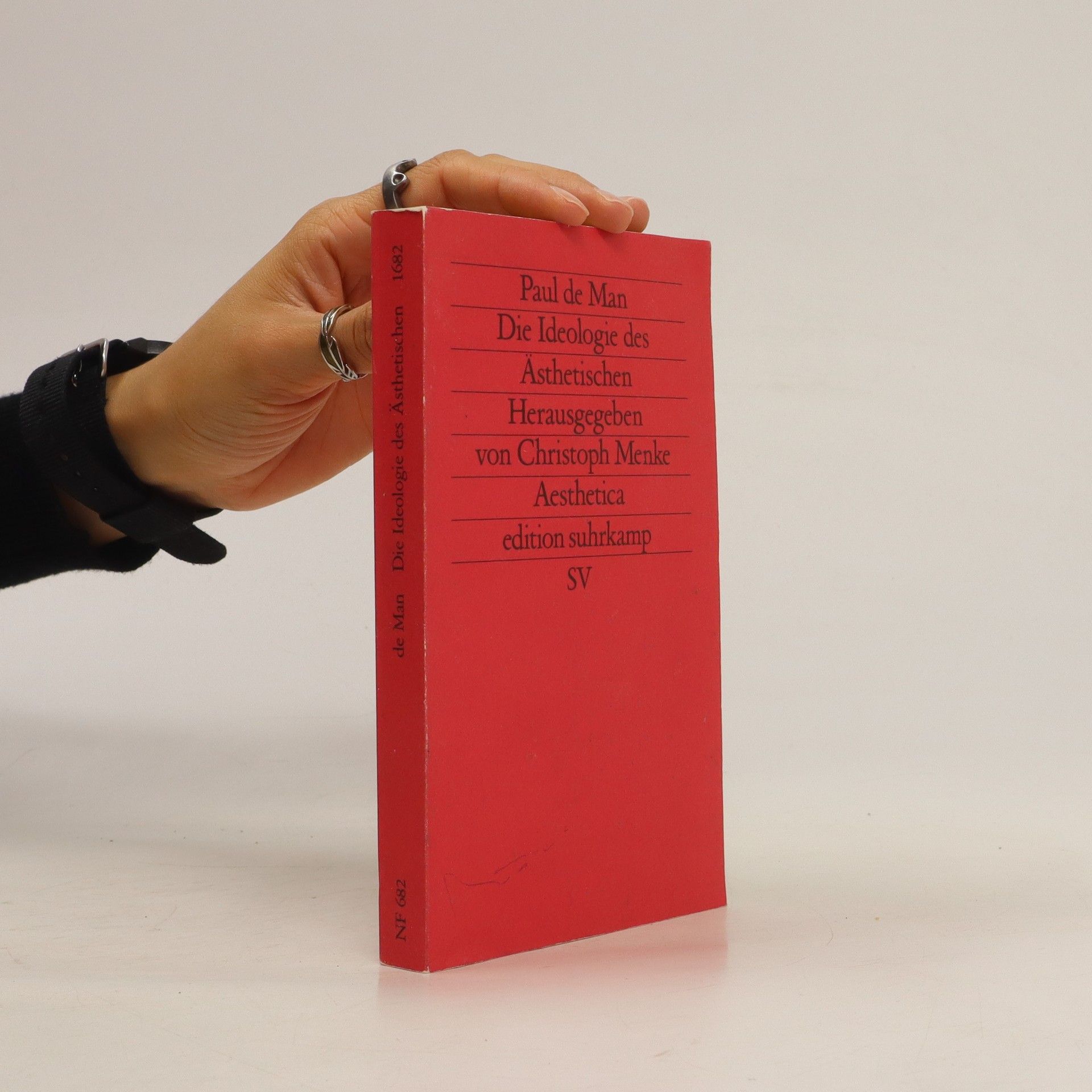
Die Ideologie des Ästhetischen
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Als Paul de Man 1983 starb, war er der wohl bekannteste und einflußreichste Vertreter einer Richtung der Literaturkritik und ihrer Theore, die allgemein als »dekonstruktiv« bezeichnet wird. Kennzeichnend für diese Richtung ist eine erneute Konzentration auf die innere Verfaßtheit der literarischen Texte. Eine erste Auswahl dieser methodisch vorbildlich wie brillant geschriebenen Texte ist 1988 unter dem Titel Allegorien des Lesens in der edition suhrkamp erschienen. Die vorliegende Auswahl konzentriert sich auf die methodologischen und theoretischen Prämissen dieses Vorhabens, wie sie die Abhandlungen über die Zeitlichkeit der Literatur, über Shelley und über die Autobiographie deutlich machen. Sich auf die immanente Verfaßtheit und Bewegung von Texten einzulassen ist nach de Man kein selbstzweckhaftes, folgenloses Unternehmen. De Man beansprucht vielmehr für seine »Rückkehr zur Philologie« eine allgemeine Bedeutung; die Literaturkritik ist zugleich philosophische und politische Kritik. Damit ist der zweite Schwerpunkt dieser Auswahl bezeichnet. De Man erläutert diese These zum einen in kritischer Auseinandersetzung mit der Philosophie Jacques Derridas. Zum anderen zeigt er an zentralen Texten der ästhetischen Tradition, an Kant und Hegel, daß ihr falsches – »ideologisches« – Verständnis literarischer Texte unter der Kategorie des »Ästhetischen« ebenso weitreichende philosophische wie politische Konsequenzen hat.
Romanticism and Contemporary Criticism
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
This volume assembles for the first time material written by Paul de Man between 1954 and 1981, including his previously unpublished Gauss Seminar lectures delivered at Princeton in 1967, three papers on romantic and postromantic issues, a commissioned essay on Roland Barthes, and two substantial responses to papers by Frank Kermode and Murray Krieger. Romanticism and Contemporary Criticism represents de Man's reflections on some of the major texts of English, German, and French Romanticism and their reception in twentieth-century literary criticism and theory. The Gauss Seminar lectures in particular convey de Man's consideration of Romanticism as a distinct form of historical consciousness, and illuminate his conviction that this romantic historical consciousness had been a powerful influence on our own development of a historical identity. De Man had planned to use the Gauss lectures as a basis for a major historical study of Romanticism, but the volume was never completed and de Man eventually abandoned the project. Drawn from four decades of de Man's career, these essays reflect the transition in the critic's work from the thematics and vocabulary of "consciousness" and "temporality" characteristic of his work in the 1960s, to the language-oriented concerns and terminology of his later writings.
Allegorien des Lesens
- 232 Seiten
- 9 Lesestunden
Im Falle Paul de Mans ist die begriffliche Charakterisierung seines Vorgehens zusätzlich erschwert dadurch, daß die Theorie nie losgelöst von den Texten, an denen sie gewonnen wird, betrachtet werden kann.
First published in 1983. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Through eleavorate & elegant close readings of poems by Rilke, Proust, Nietzsches and the major works of Rousseau, de Man concludes that all writing concerns itself with its own activity as language, & language, he says, is always unreliable, slippery, impossible...Literary narrative, because it must rely on language, tells the story of its own inability to tell a story.... De Man demonstrates, beautifully & convincingly, that language turns back on itself, that rhetoric is untrustworthy. -- Amazon.com