Ich kenne das Leben in Mexiko
Als Briefe an John Schikowski 1925 bis 1932 - Mit einem Essay von Karl S. Guthke
- 136 Seiten
- 5 Lesestunden
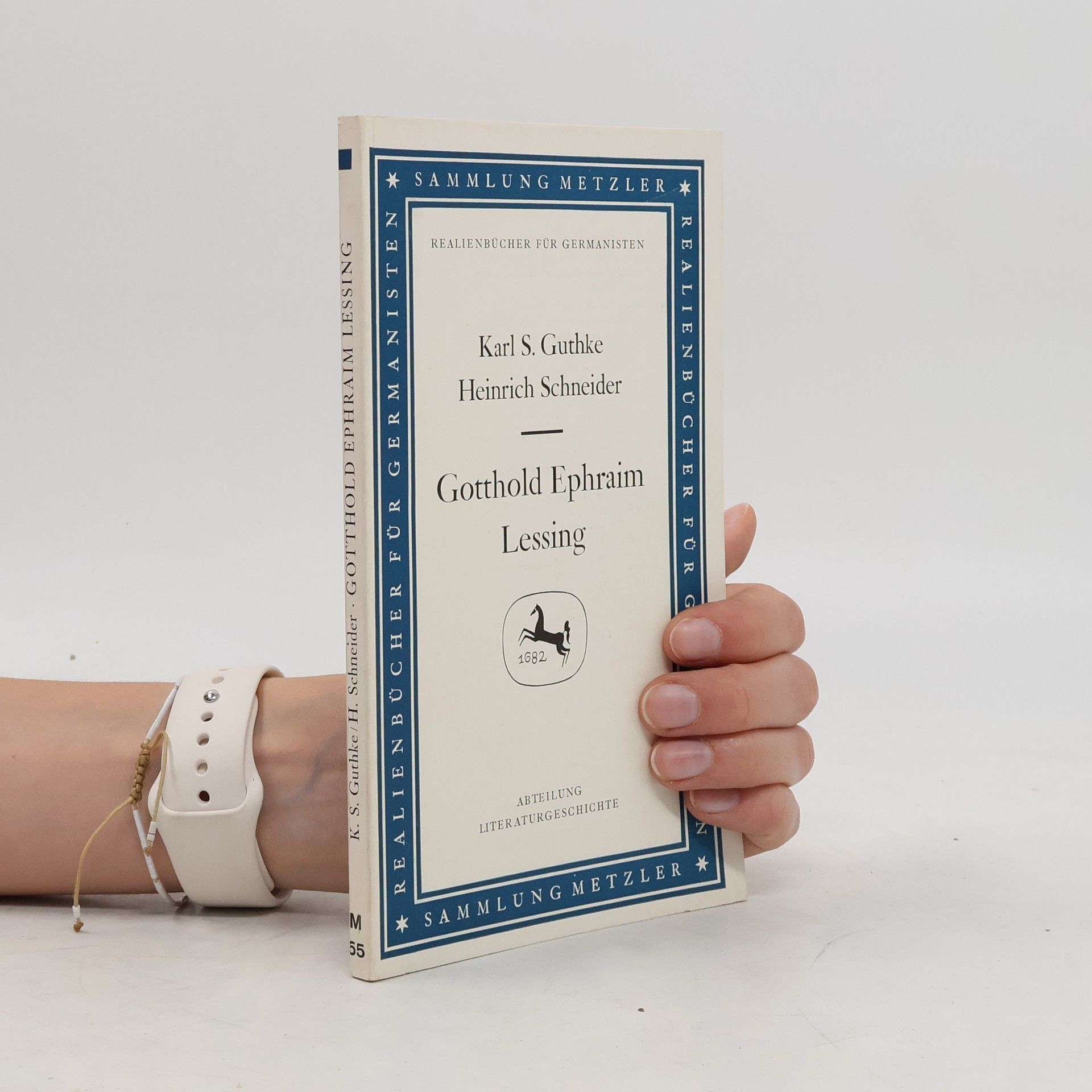


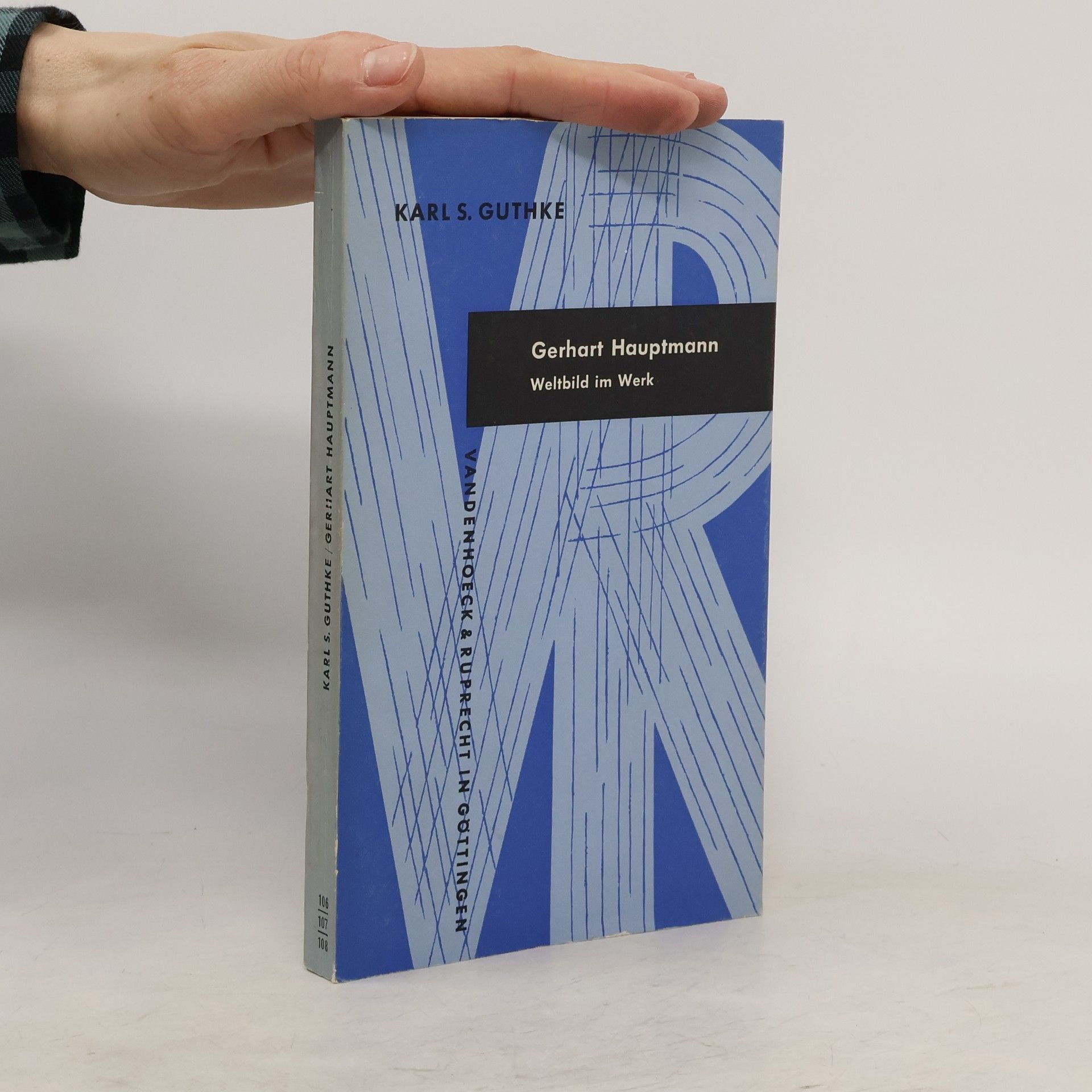


Als Briefe an John Schikowski 1925 bis 1932 - Mit einem Essay von Karl S. Guthke
Tod / Psyche / Kultur.
'Emilia Galotti', 'Kabale und Liebe', 'Miß Sara Sampson' und 'Maria Magdalena' gelten als Paradebeispiele für die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels. Doch was zeichnet die Gattung eigentlich aus? Wie wird das bürgerliche Trauerspiel in der Literaturkritik bewertet? Gibt es einen Kanon dieser Stücke? Der Autor liefert schlüssige Antworten und liefert einen Überblick über die Epoche von Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.