Annemarie Regensburger Bücher
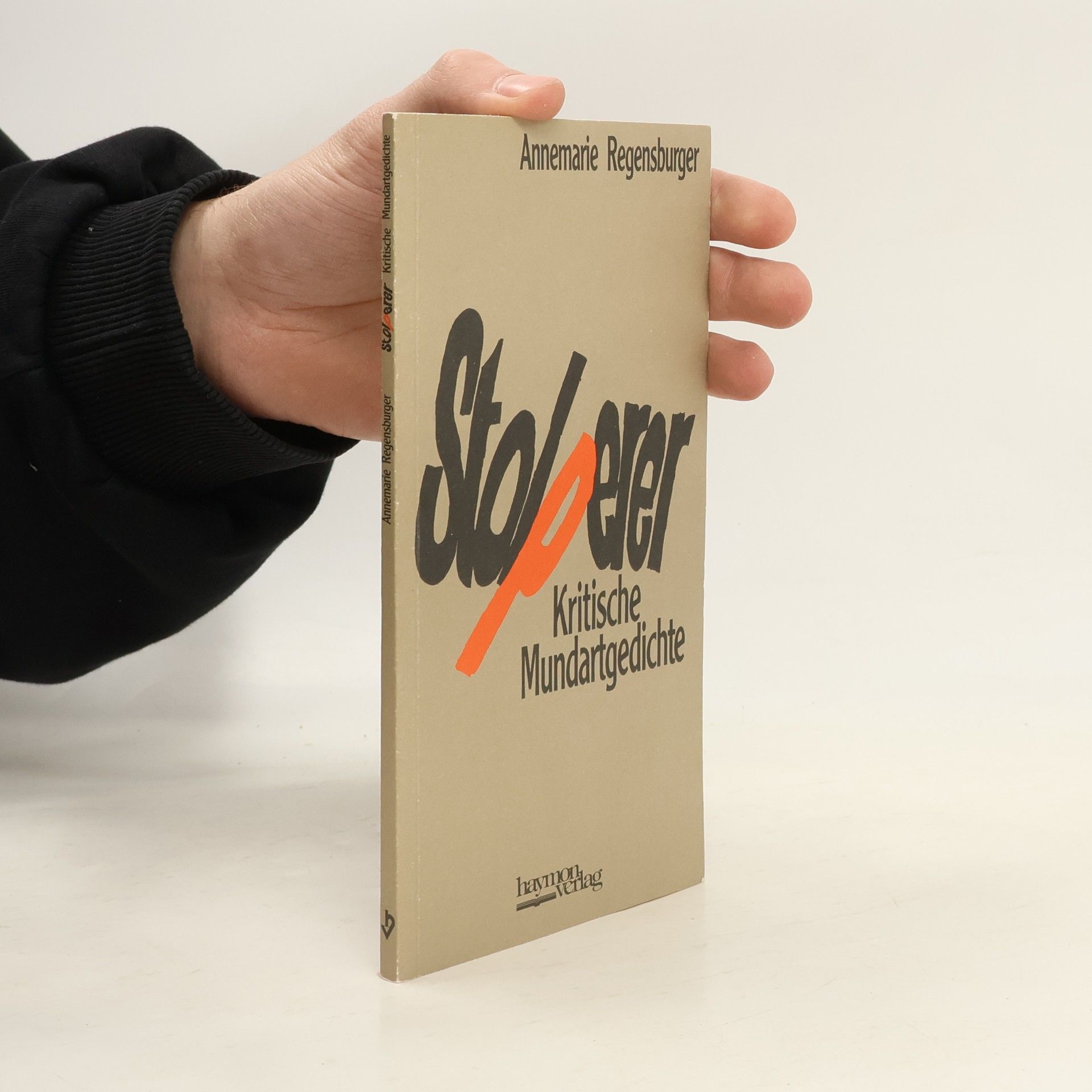
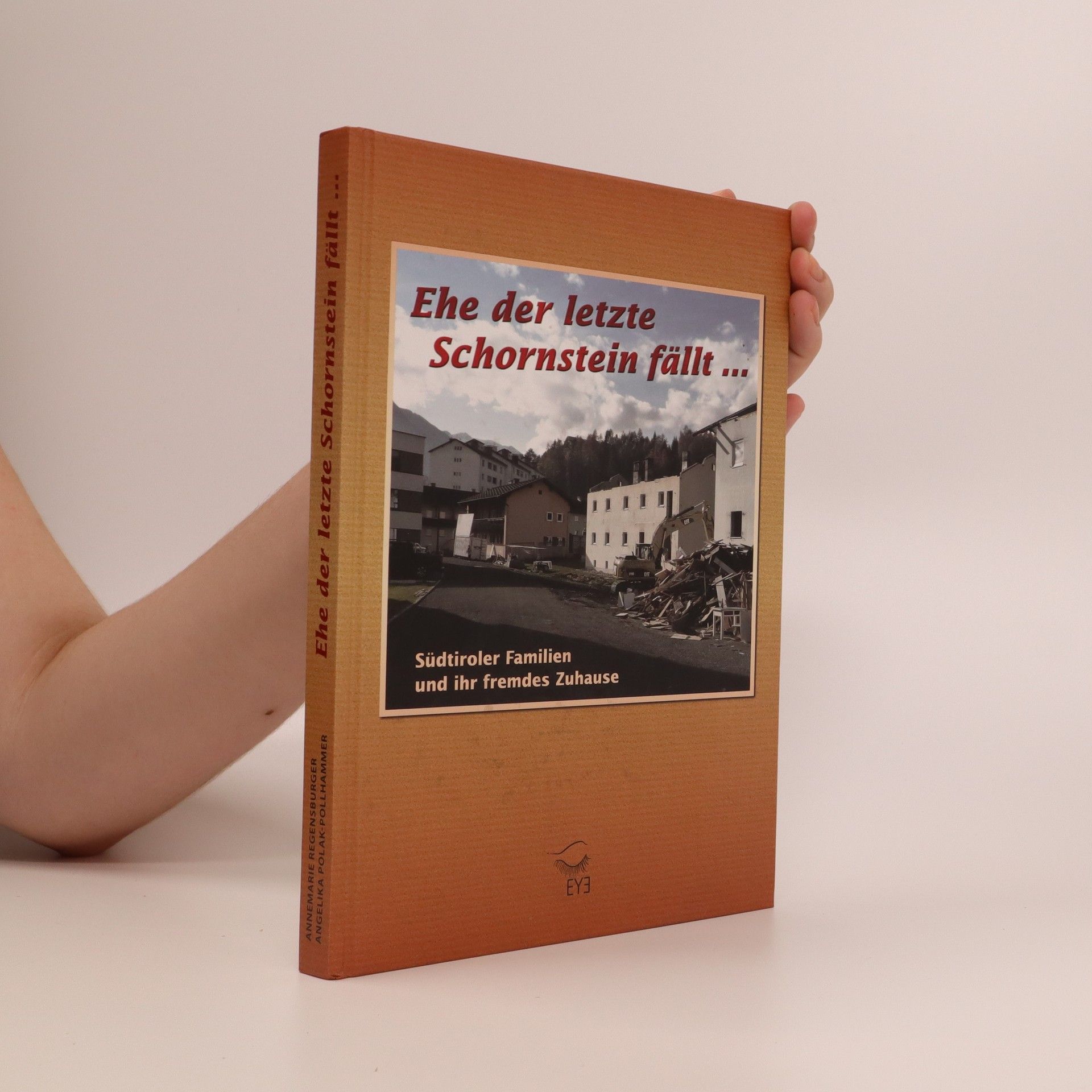
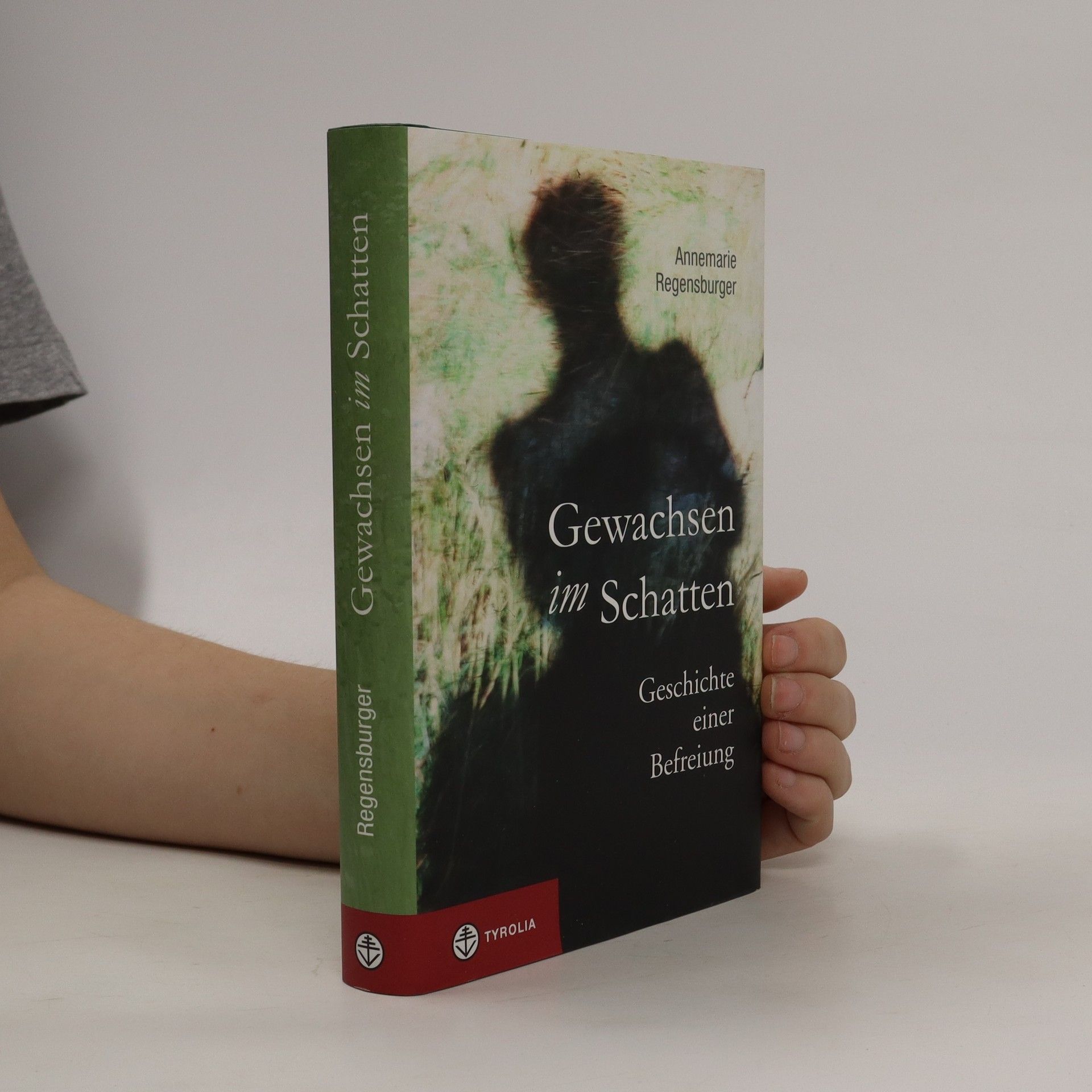
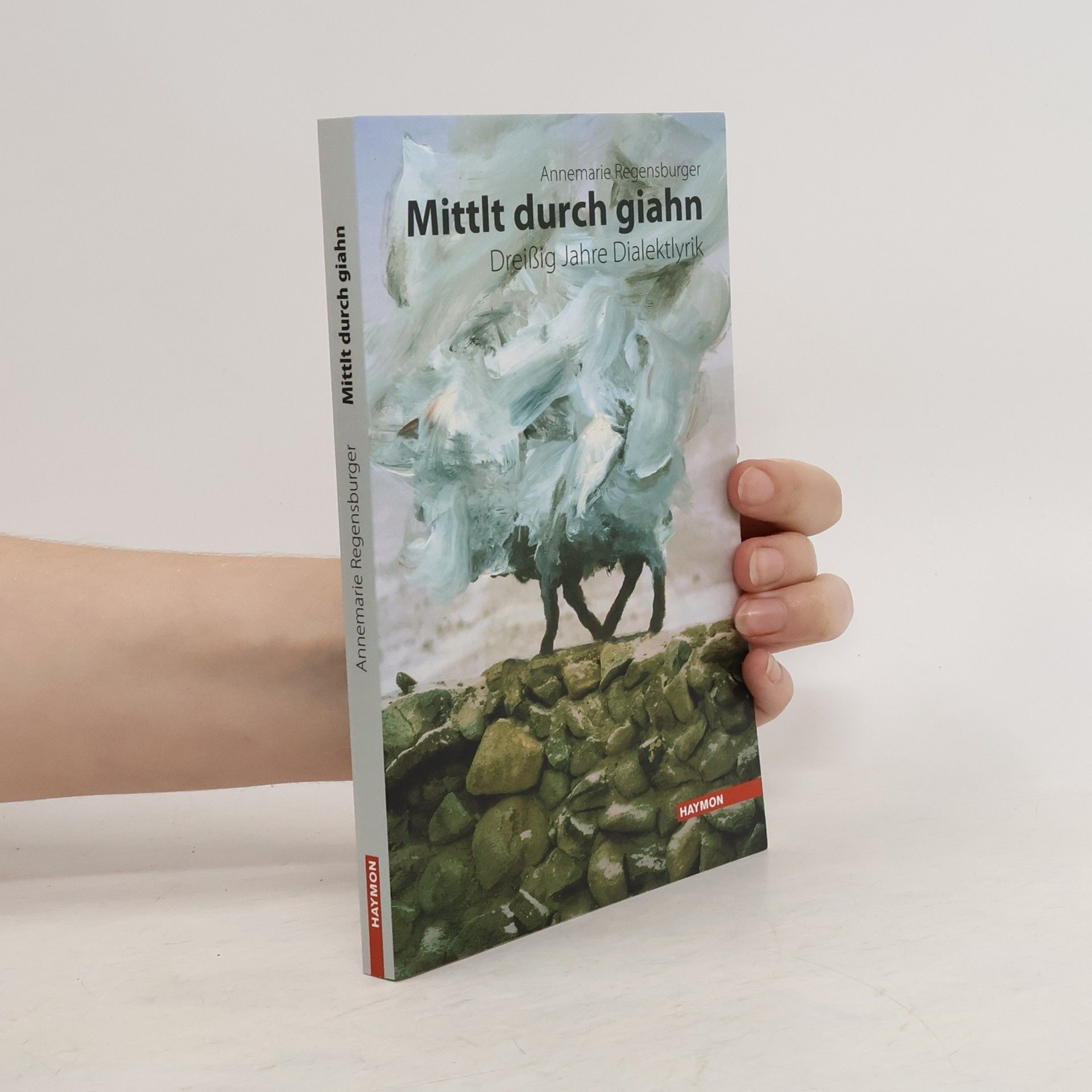

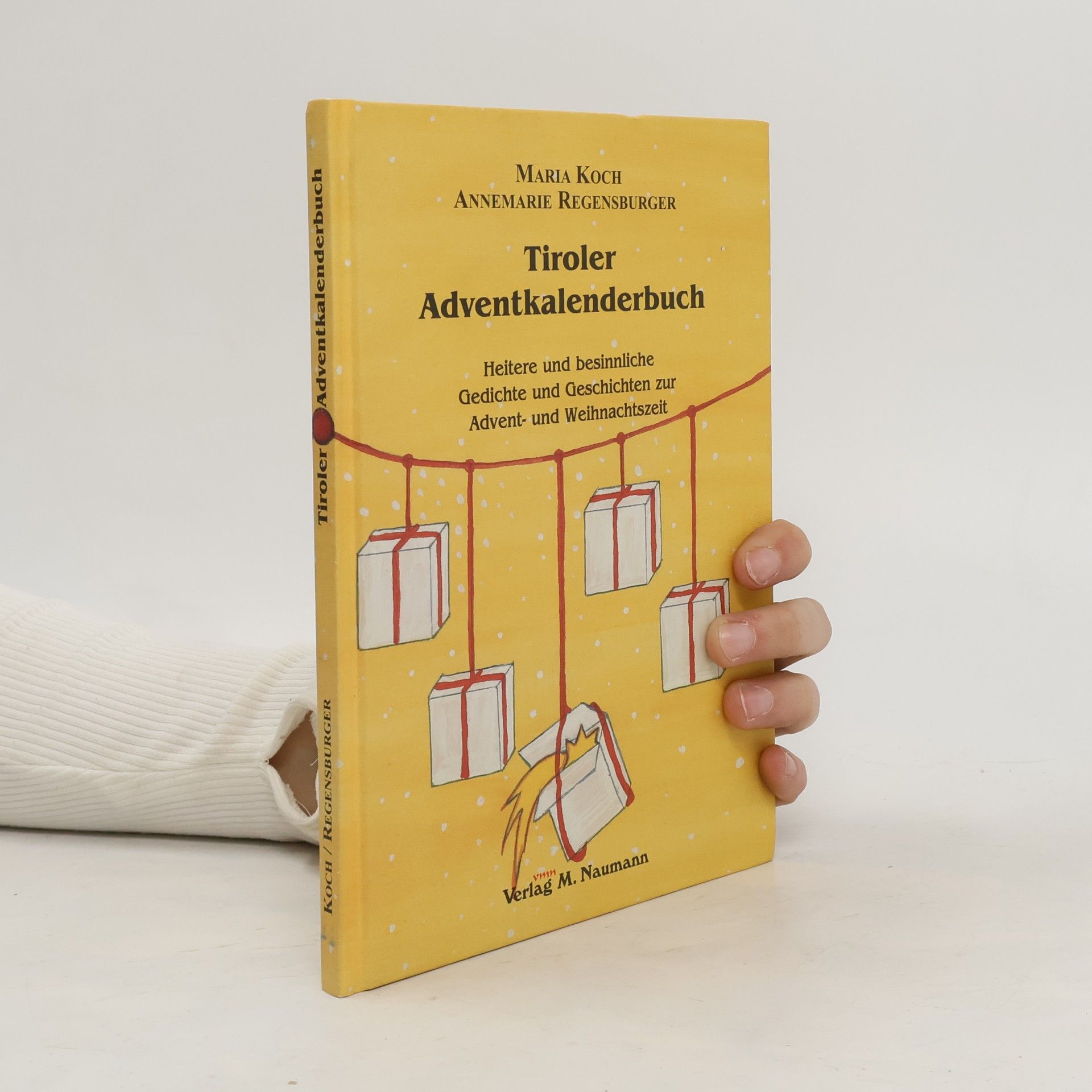
Ich bleibe bei euch
Begegnungen mit dem Auferstandenen
Jesus lebt Der Weg des Auferstandenen mit den Menschen In den biblischen Berichten von der Entdeckung des leeren Grabes durch Maria Magdalena bis zum Pfingstereignis verdichten sich zentrale Inhalte des Christentums: die Botschaft, dass der Tod nicht das Ende ist; die zentrale Rolle der Frauen als Botschafterinnen der Auferstehung; der Zweifel des Thomas und das Vertrauen auf Jesu Wort gegen alle Vernunft beim Fischgang – und über allem die Erfahrung seiner Jüngerinnen und Jünger: Jesus lebt, er ist mitten unter uns, er begleitet und stärkt uns mit seinem Geist. Die Holzschnitte von Siegfried Krismer lenken den Blick der Betrachtenden auf das Wesentliche dieser zwölf Stationen des Auferstandenen. Und die prägnanten Texte der Lyrikerin Annemarie Regensburger holen die bleibende Botschaft dieser Begegnungen ins heute, „mitten ins Ungewisse“, „mitten ins Trauern“, „mitten ins Hoffen“, wie sie formuliert. Mit diesem Werk leisten die Dichterin und der Künstler einen wichtigen Beitrag, um die Aufmerksamkeit mehr auf die Botschaft der Auferstehung zu lenken, nachdem über Jahrhunderte der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen im Zentrum stand. Tipps: Stilvolles Geschenk für Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten 2002 erschien von den beiden das in gleicher Weise gestaltete Werk „Durchkreuzte Wege. Erfahrungen mit Leid und Passion“.
Mittlt durch giahn
Dreißig Jahre Dialektlyrik
Mittlt durch geht Annemarie Regensburger mit ihren Gedichten – zart und eindringlich, kunstvoll gewebt und doch gerade heraus spricht sie von Freiheit, Gleichberechtigung und Toleranz. Ein Querschnitt durch das vielseitige lyrische Schaffen einer Tiroler Mundart-Poetin. Was trägt? Was isches dejs trejt dejs zommheppt uan mitanond verbindet was isches wirklig dejs uan sagn lasst da bin ih derhuem?
Dominierend im kleinen Oberländer Dorf ist das barocke Stift mit seinen markanten Zwiebeltürmen und der Reiterstatue Meinhards II., in das 1948 das Kind Annemarie hineingeboren wird. Die ärmlichen Verhältnisse sind geprägt von den Traumata der Nazizeit, die die Autorin eindrücklich schildert. Der ländliche Alltag wird von starkem Katholizismus und einem traditionellen Frauenbild bestimmt. Annemarie wächst hin- und hergerissen zwischen Faszination und Schrecken in diesem teils schützenden, teils einengenden Umfeld auf. Sie kämpft mit den Schicksalsschlägen des Lebens: dem frühen Tod der Mutter, der Aufteilung der Kinder auf Pflegefamilien, Geldsorgen, die ihren Träumen im Weg stehen, und vor allem mit der schweren psychischen Erkrankung des Vaters, dessen Aufenthalte im Haller Krankenhaus das Bild ihrer Kindheit prägen. Bekannt für ihre kritische Mundartdichtung findet Annemarie Regensburger auch in diesen berührenden autobiografischen Erinnerungen eine unmittelbare, vom Dialekt geprägte und klangvolle Sprache. Sie blickt auf ein entbehrungsreiches Leben zurück und erhebt das Wort gegen Sprachlosigkeit, gesellschaftliche Missstände und überkommene Moralvorstellungen.
Geschichten von Umsiedlerinnen und Umsiedlern der Imster Südtirolersiedlung am Grettert Südtiroler Familien, die Haus und Hof verließen, um ein vermeintlich lebenswerteres Daheim zu finden: Die beiden Autorinnen beleuchten das Schicksal dieser Menschen in einer Südtirolersiedlung in Imst im Tiroler Oberland. Vor 75 Jahren wurde die Südtiroler Bevölkerung zur Option gerufen. Die von zwei faschistischen Regimen erzwungene Abstimmung stellte deutschsprachige Südtiroler und Ladiner vor die \"Wahl\": Italianisierung oder Auswanderung ins damalige Deutsche Reich. 1939 kamen die ersten Südtiroler Familien im Zuge dieser Option nach Imst. In der Siedlung am Grettert fanden die unvermittelt Heimatlosen einen neuen Wohnort, in dem sich viele, lange nicht, zuhause fühlen sollten. Die historischen Bauten der Südtirolersiedlung weichen derzeit neuen, modernen Wohnblöcken. Mit dem Verschwinden dieser baulichen Zeugnisse schließt sich zugleich ein Kapitel Südtiroler und Imster Geschichte. Die Autorinnen haben die letzten persönlich betroffenen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt und ihre Lebenserinnerungen an die Zeit der Option und die Jahre danach niedergeschrieben. Aus unzähligen Interviews entschlüsselten sich 21 Familiengeschichten ...
Durchkreuzte Wege. Erfahrungen mit Leid und Passion.
- 48 Seiten
- 2 Lesestunden
