Magie
Die verborgenen Grundmuster unseres Denkens und Handelns
Klaus E. Müllers akademischer Weg wurde von der Anthropologie geprägt, was ihn dazu veranlasste, sich auf Ethnologie und Afrikastudien zu konzentrieren. Seine Arbeit befasst sich mit den Komplexitäten der Kultur- und Sozialanthropologie und etablierte seine Professur. Müllers Beiträge liegen in seiner engagierten Forschung und Lehre im Bereich der Anthropologie.
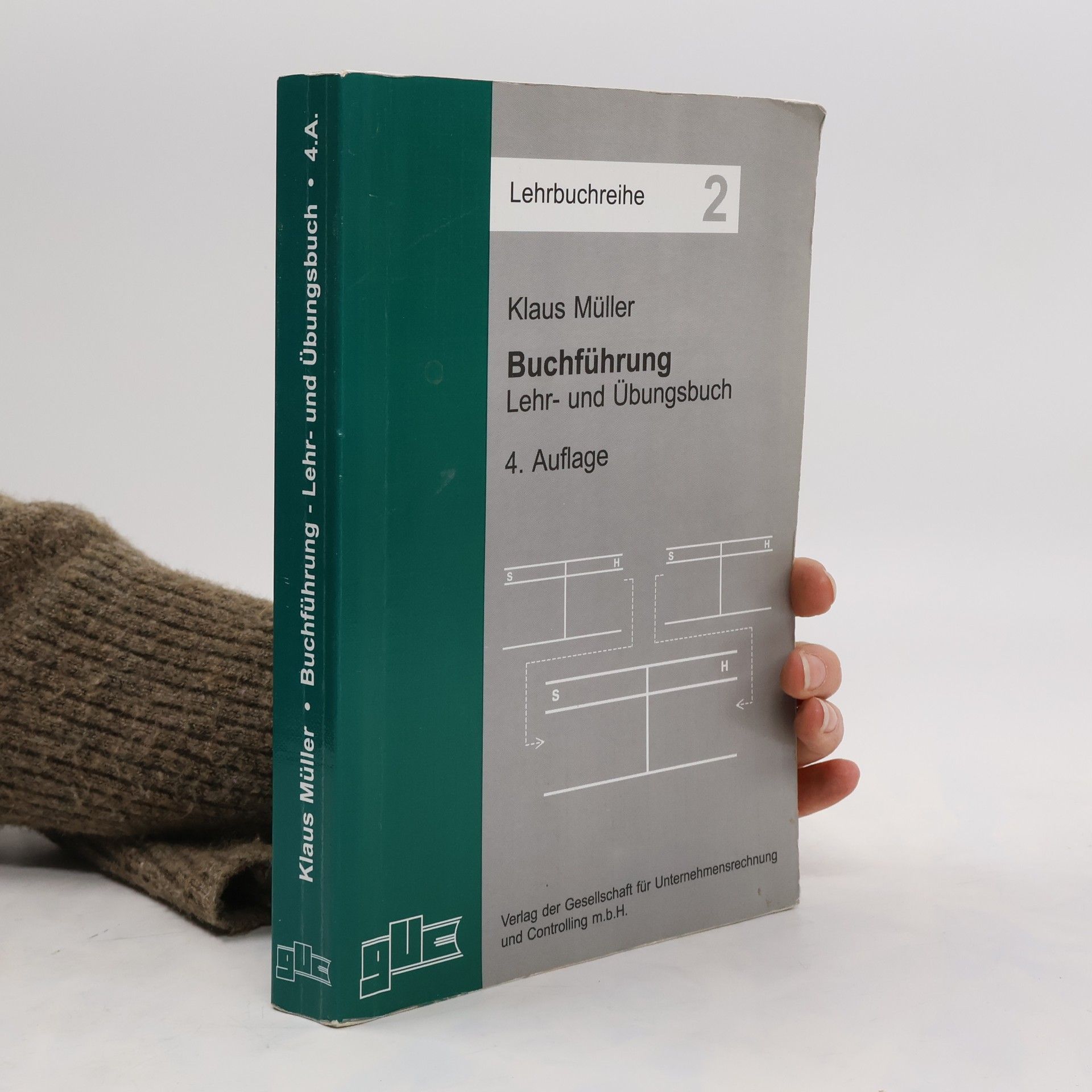
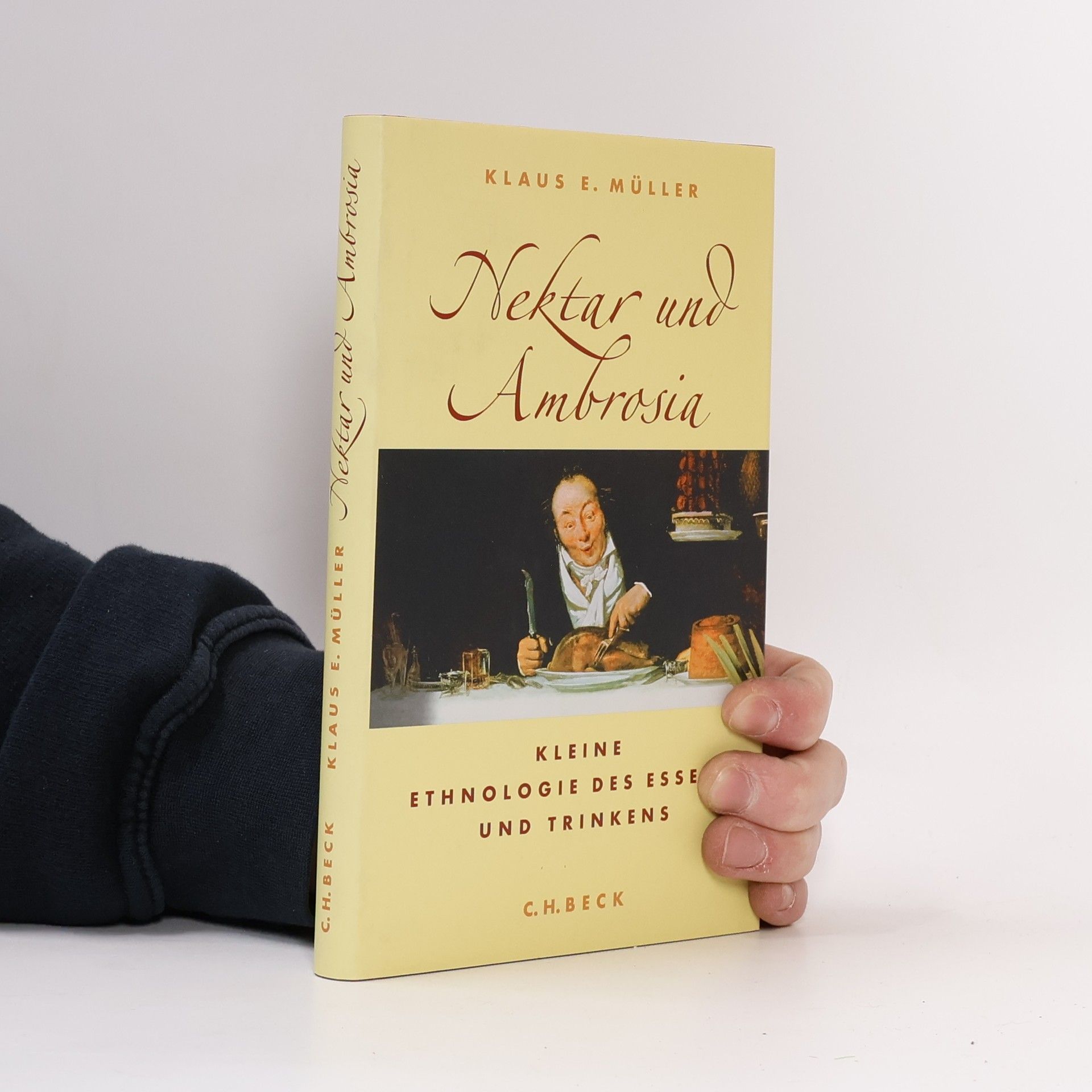
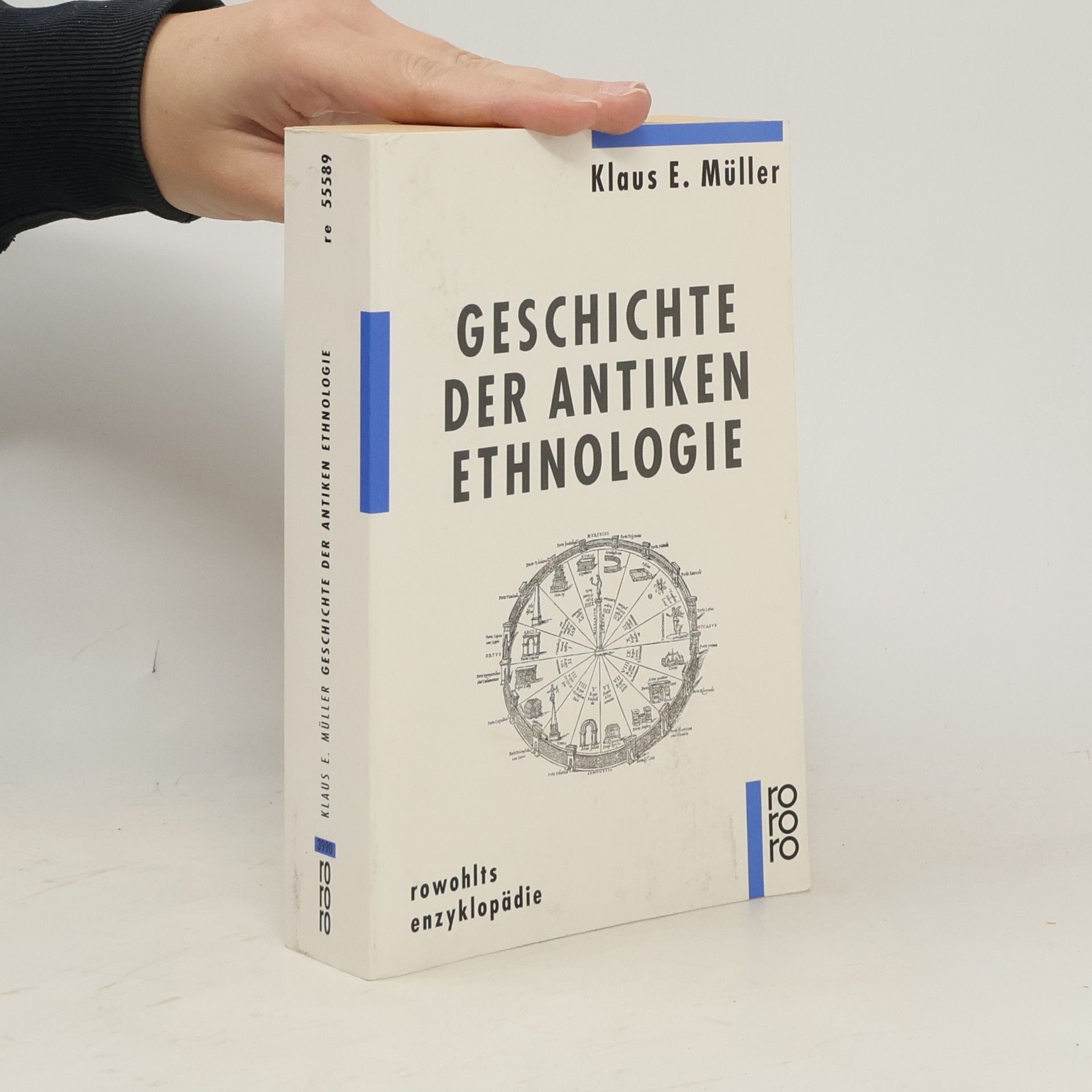
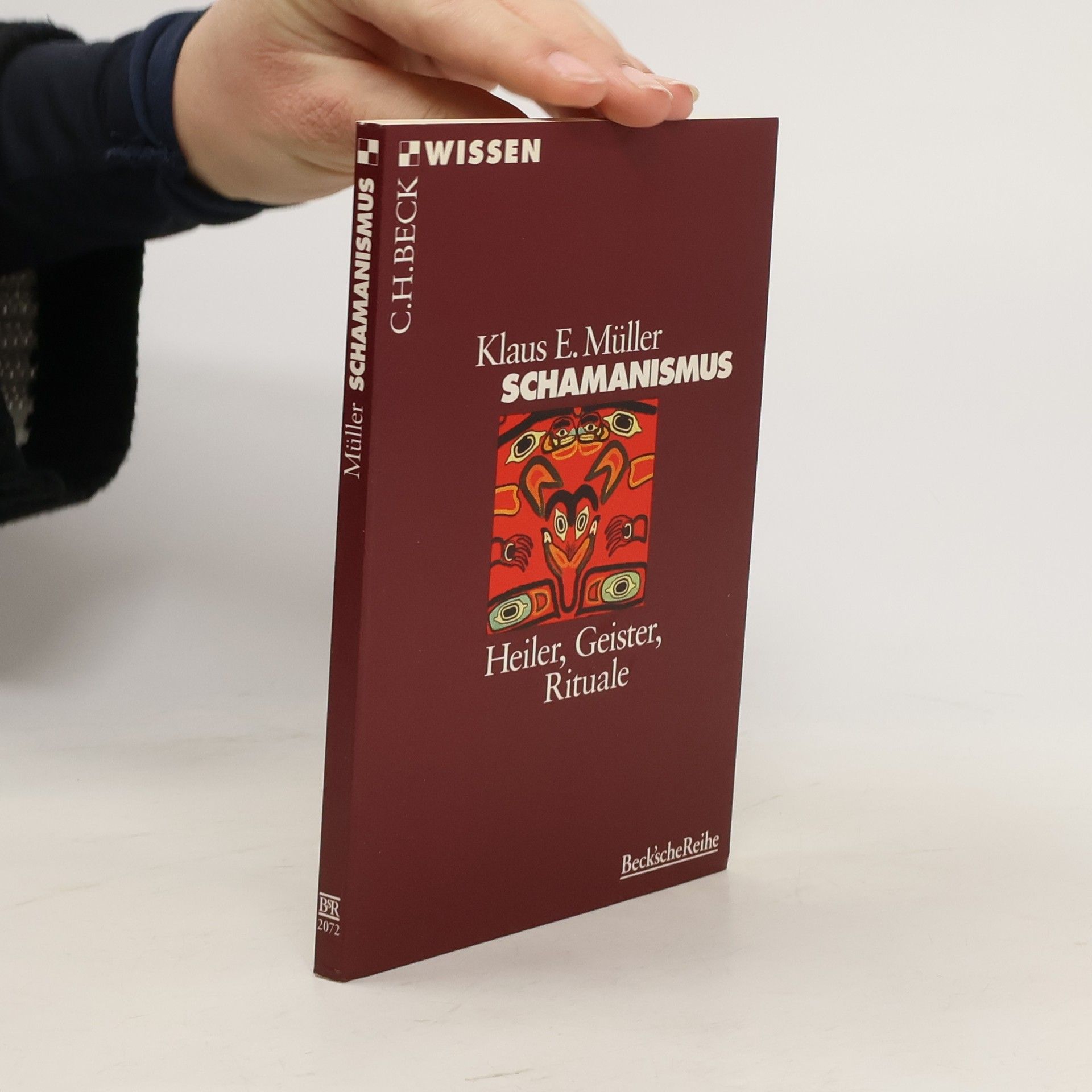

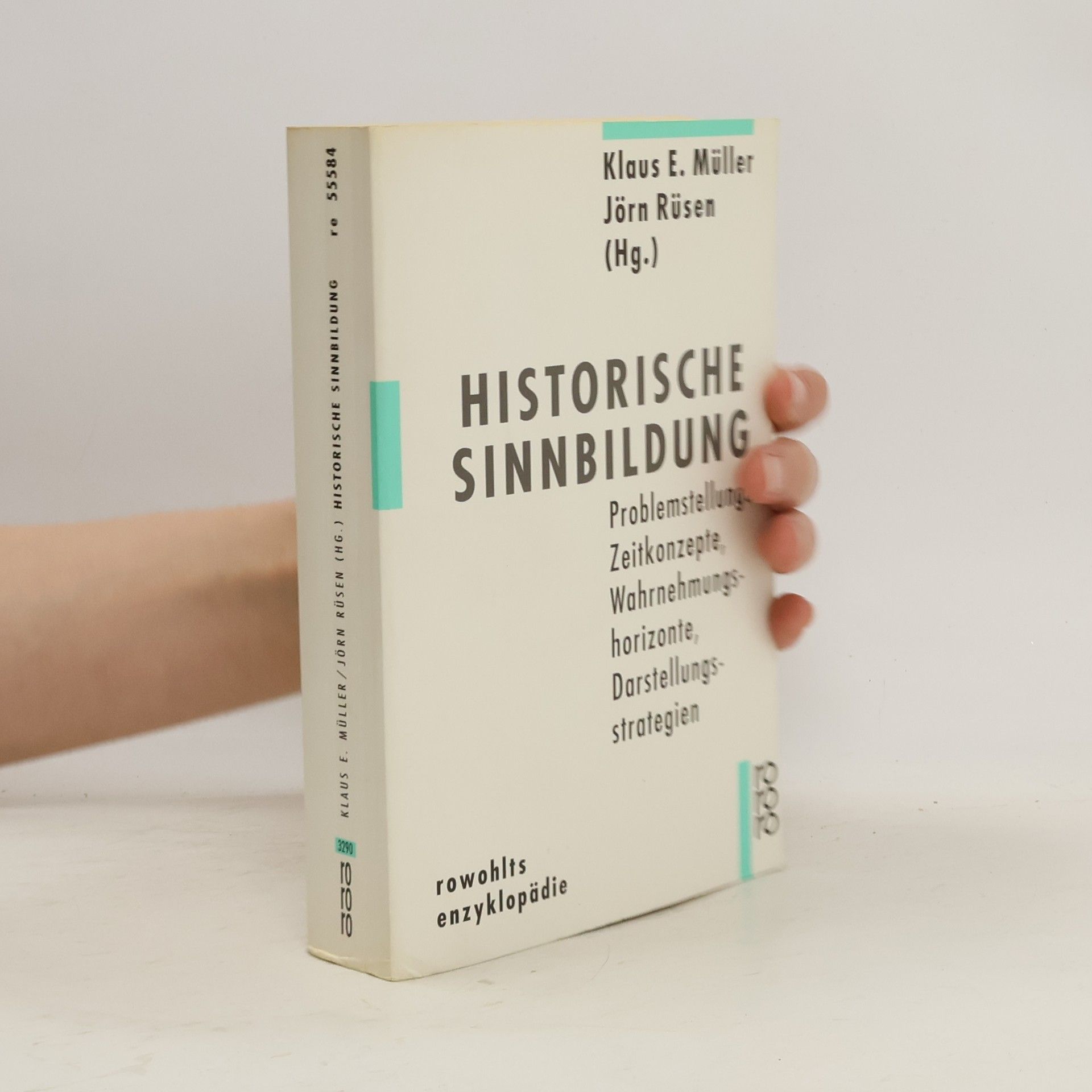
Die verborgenen Grundmuster unseres Denkens und Handelns
Die meisten Völker der Welt begreifen die Schöpfung als unvollkommen und die Kultur als den Versuch, ihre Mängel auszugleichen. Jedes sieht sich dabei an der Spitze der Entwicklung, so dass alles Andersartige als Ausdruck der Abartigkeit erscheint (Nostrozentrismus). Ein Schlüsselproblem im Zusammenleben der Menschen bilden teils biographische, mehr aber noch durch Kontakte ausgelöste Zustandswechselprozesse, da sie zu abweichenden Entwicklungen führen können. Dem sucht man durch Kanonisierung und Ritualisierung des Prozessverlaufs zu begegnen.
Inhalt: Das Lehr- und Übungsbuch will Studierenden an Universitäten, Hochschulen, Fachschulen und Berufsakademien ein Vorlesungsbegleiter sein und die erste Begegnung mit dem Fach "Finanz-" oder "Geschäftsbuchführung" erleichtern. Ausführliche Beispiele, Zusammenfassungen, viele Aufgaben und Lösungen zu allen Abschnitten helfen, sich dieses grundlegende Teilgebiet des betrieblichen Rechnungswesens auch autodidaktisch zu erschließen. Im ersten Teil werden allgemeine buchhalterische Grundlagen vermittelt: - Inventar, Inventur, Bilanz - Bestandskonten, Erfolgskonten - Umsatzsteuer, Zahllast - Privatkonto, Eigenverbrauch. Mit spezielleren Buchungen in wichtigen betrieblichen Bereichen, wie: Personalwesen, Beschaffung, Absatz, Finanzen, Sachanlagen und Steuern beschäftigt sich der zweite Teil. Die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluß (Gewinn- und Verlustrechnung, Schlußbilanz) anfallenden Buchungen sind Gegenstand des dritten Teils: - Transitorische Posten - Antizipatorische Posten - Rückstellungen - Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Forderungen - Betriebsübersicht. Komplex- und Klausuraufgaben sowie Lösungen zu allen Aufgaben beschließen die Arbeit. Sie ermöglichen dem Leser, sein buchhalterisches Wissen und Können zu überprüfen und zu vertiefen.
Bestimmte Ideen, Erfindungen, Offenbarungen, Entdeckungen und Konfliktsituationen haben in der Geschichte teils dramatische Umwälzungen ausgelöst, die der ökonomischen, technologischen, geistigen, künstlerischen oder politischen Entwicklung eine entscheidende Wende verliehen und oft zur Herausbildung neuer Gesellschaftsformen, Religionen, politischer Ideologien, wissenschaftlicher Theorien und Weltbilder führten. Analysen zeigen, dass derartige Prozesse meist eine übereinstimmende Genese und Verlaufsstruktur besitzen. Typische Beispiele mit weitreichenden Konsequenzen stellen die Entstehung des Monotheismus, des Christentums, des Islam, die Reformation, der Cartesianismus, die Französische Revolution, der Darwinismus, nativistische Heilserwartungsbewegungen in der so genannten „Dritten Welt“ und der Holocaust dar, die neben anderen den Gegenstand des Buches bilden.
Nahrungsgewinn und Ernährung stellen für die Menschen seit frühesten Zeiten ein elementares Problem dar. Seine Lösung entscheidet wesentlich mit über Gesundheit, sozialen Frieden, Fortpflanzung und gesellschaftlichen Einfluß. Nahezu alle Lebensbereiche werden in vormodernen Gesellschaften von der Kultur des Essens und Trinkens geprägt. Klaus E. Müller beschreibt in diesem Buch unter anderem die soziale Funktion gemeinsamer Mahlzeiten mit ihren Sitzordnungen und Tischmanieren, die Bedeutung sakraler Festessen und Trinkrunden, den Unterschied zwischen Volks- und "Hochküche" sowie den symbolischen Zusammenhang von "Tisch und Bett" (Ehe und Sex). Zur Sprache kommen auch Mythen von der paradiesischen Kost, der "Götterspeise", sowie die magische Kraft, die manchen Speisen und Getränken bis heute zugeschrieben wird. Anhand vieler ebenso lehrreicher wie unterhaltsamer Beispiele führt der Autor die ethnologische Tiefendimension vieler bis heute praktizierter Rituale rund ums Essen vor Augen und trägt so zu einer "bewußten" Ernährung bei
Frühe Kulturen entwickelten ein ausgeprägtes Geschichtsbild, das sie in ihre Umgebung übertrugen. Markante Landschaftspunkte wie Felsen, Quellen und Bäume erhielten eine eigene Bedeutung, wodurch die Umwelt zu einem „historischen Atlas“ wurde, an dem die Geschichte des Stammes abgelesen werden konnte. Mündliche Erzählungen und Rituale an Gedächtnisorten hielten die Erinnerung an den Ursprung und den Weg des Stammes lebendig und bewahrten sie im „kollektiven Gedächtnis“. Die gesamte Kultur einer Gruppe, von alltäglichen Dingen über Fest- und Priestertrachten bis hin zu Brauchtum, kann als lebendiges Freilichtmuseum verstanden werden. Klaus E. Müller illustriert diese Aspekte der Geschichtsauffassung traditioneller Gesellschaften anhand zahlreicher Beispiele, wie den nordamerikanischen Indianern oder mongolischen Nomaden, und zieht Parallelen zu modernen Lebenswelten. Das Kulturwissenschaftliche Institut im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, gegründet 1988, erforscht Probleme einer durch Wissenschaft, Technik und industrielle Produktion geprägten Gesellschaft und Kultur. Es richtet temporäre Studiengruppen mit wechselnden Gastwissenschaftlern ein, die interdisziplinäre Forschungsprojekte zu aktuellen Fragestellungen realisieren. Die Reihe der Essener Kulturwissenschaftlichen Vorträge (EKV) präsentiert ausgewählte Beispiele aus dem Vortragsprogramm des Instituts.
Der Schamanismus ist eines der ältesten Heilrituale der Menschheit. In seinem Zentrum steht der Schamane, der zwischen den Menschen und den Geistmächten eine Vermittlerfunktion einnimmt, um die gestörte Harmonie zwischen Mensch, Natur und Geistern wiederherzustellen. Dazu muß er eine Initiation durchlaufen, die ihn zu einem Doppelwesen, halb Mensch, halb Geist, macht. Dieses Buch will zur Versachlichung eines okkultistischen Modethemas beitragen und informiert knapp und kompetent über alle wichtigen Aspekte des Schamanismus.