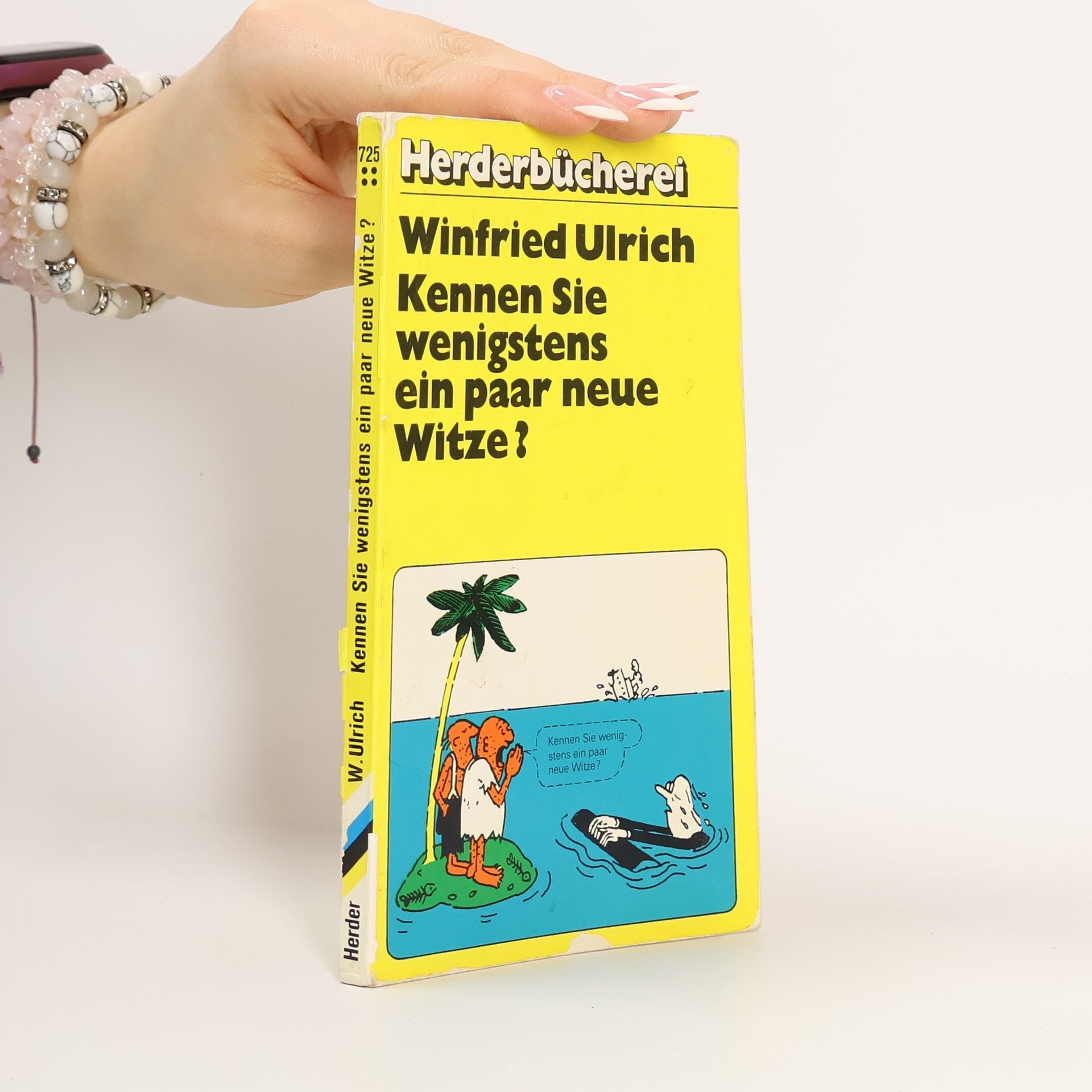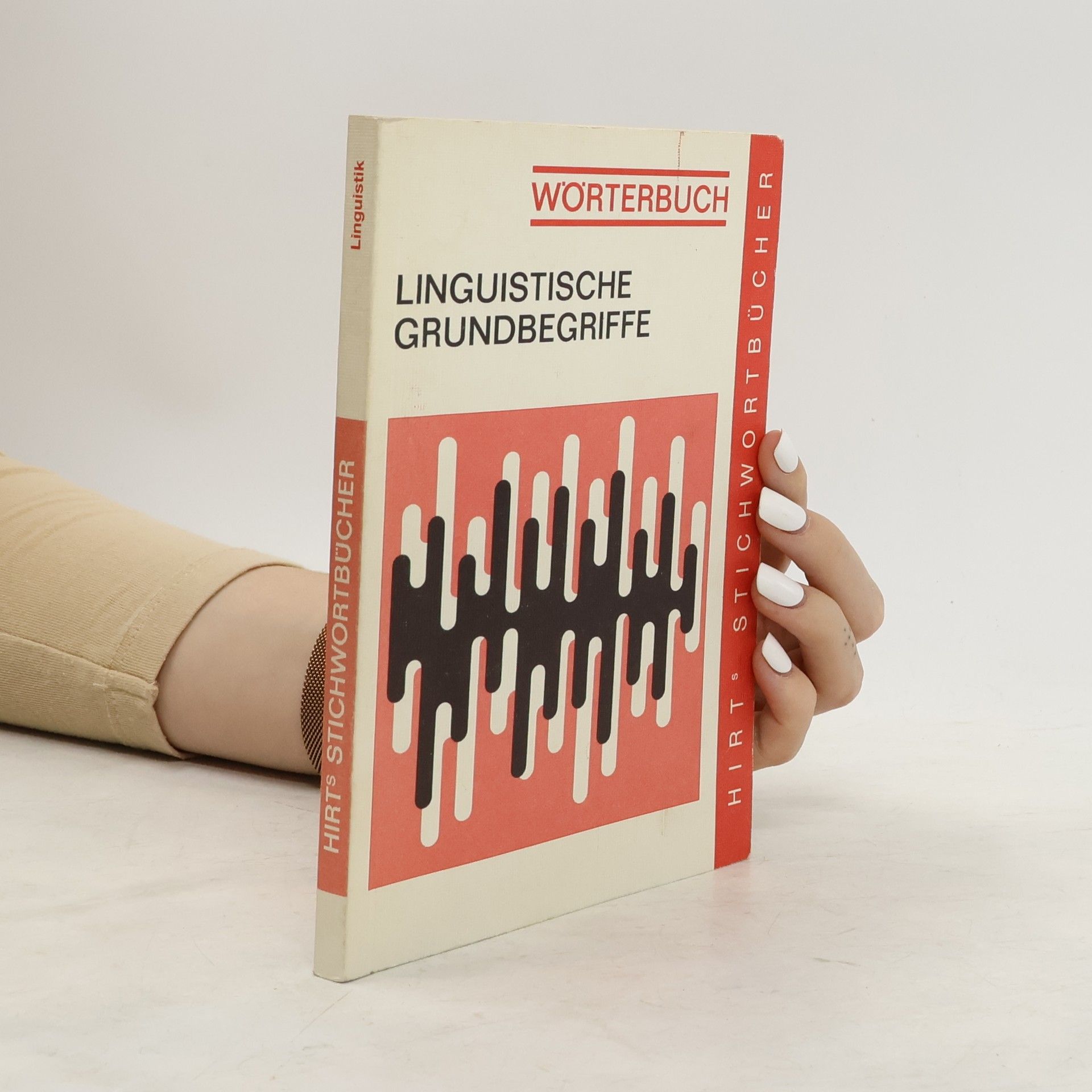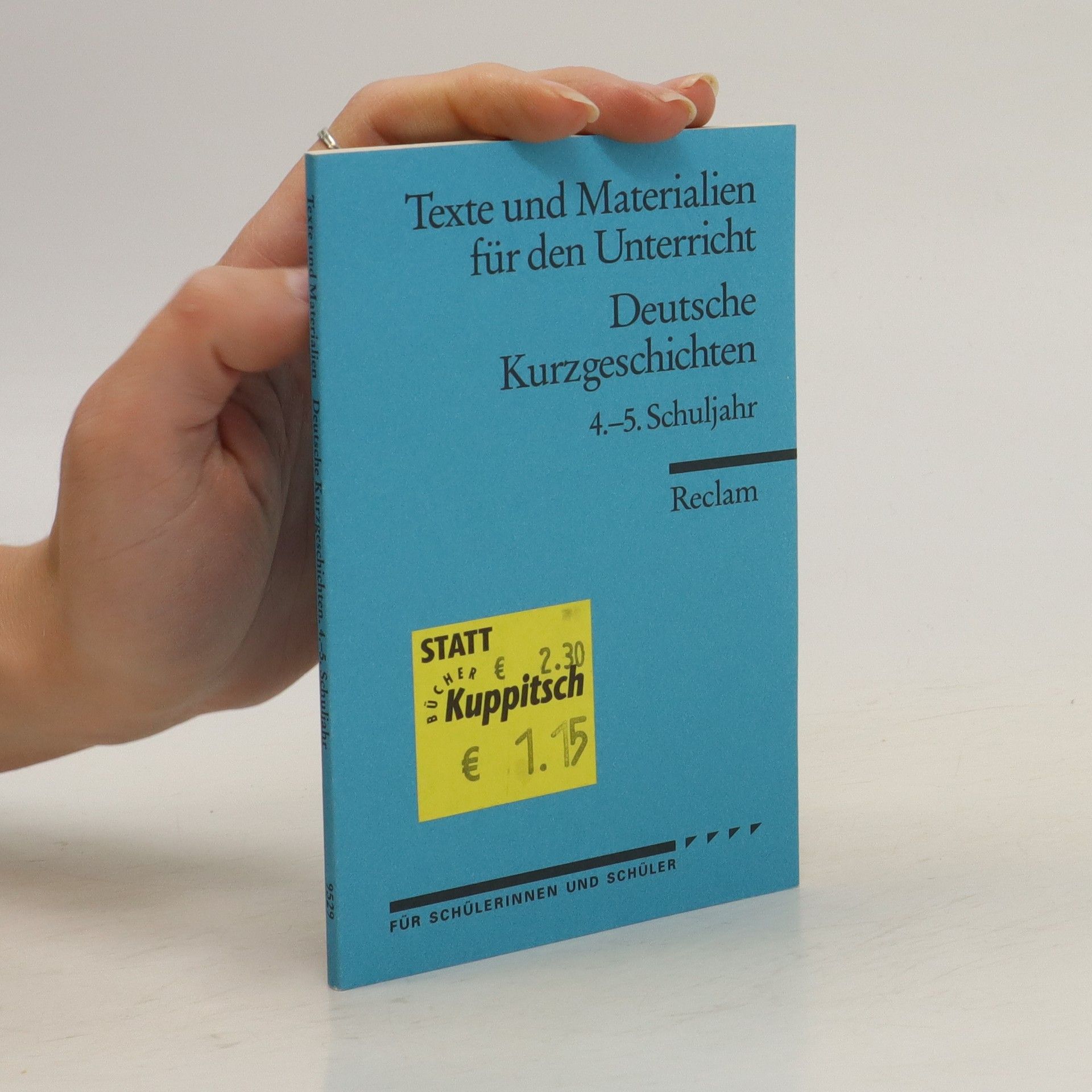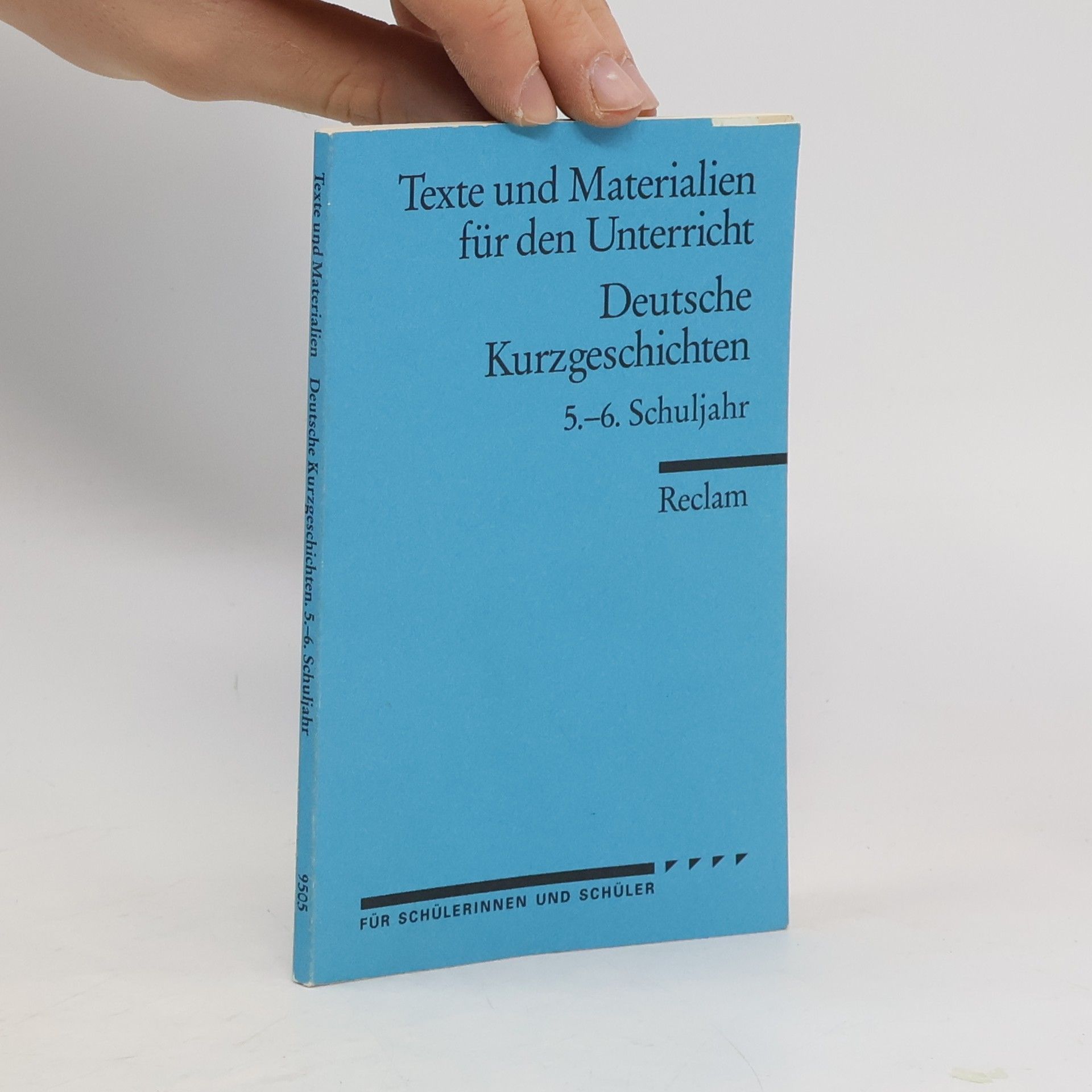Wörterbuch linguistische Grundbegriffe
- 217 Seiten
- 8 Lesestunden
Seit der ersten Auflage dieses Wörterbuches 1972 sind fast dreißig Jahre vergangen, und seit der vierten Auflage 1987 mehr als zehn Jahre. In dieser Zeit hat sich das Nachschlagewerk für Studierende und Lehrkräfte bewährt und wurde immer wieder neu aufgelegt oder unverändert nachgedruckt. Angesichts der rasanten Entwicklung der Linguistik und neuer Forschungsergebnisse ist das bemerkenswert. Ein Wörterbuch muss aktuell sein und Veränderungen sowie Erweiterungen berücksichtigen. Die ersten vier Auflagen wurden mehrfach überarbeitet, doch zuletzt gab es nur unveränderte Nachdrucke, was zu einem Verlust an Aktualität führte. Um diesem entgegenzuwirken, liegt nun die fünfte Auflage vor, die an der bewährten Konzeption festhält, aber inhaltlich ein neues Buch ist. Die Anzahl der Stichwörter hat sich nahezu verdoppelt, und viele sind neu geschrieben sowie durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt worden. Dieses Buch entstand aus den praktischen Anforderungen des Lehrbetriebs an Universitäten und Hochschulen mit sprachwissenschaftlichen Studiengängen. Der Verfasser hat über Jahre in Vorlesungen und Seminaren festgestellt, wie wichtig ein Arbeitsmittel ist, das Grundbegriffe der Sprachwissenschaft prägnant erläutert und mit Beispielen veranschaulicht.