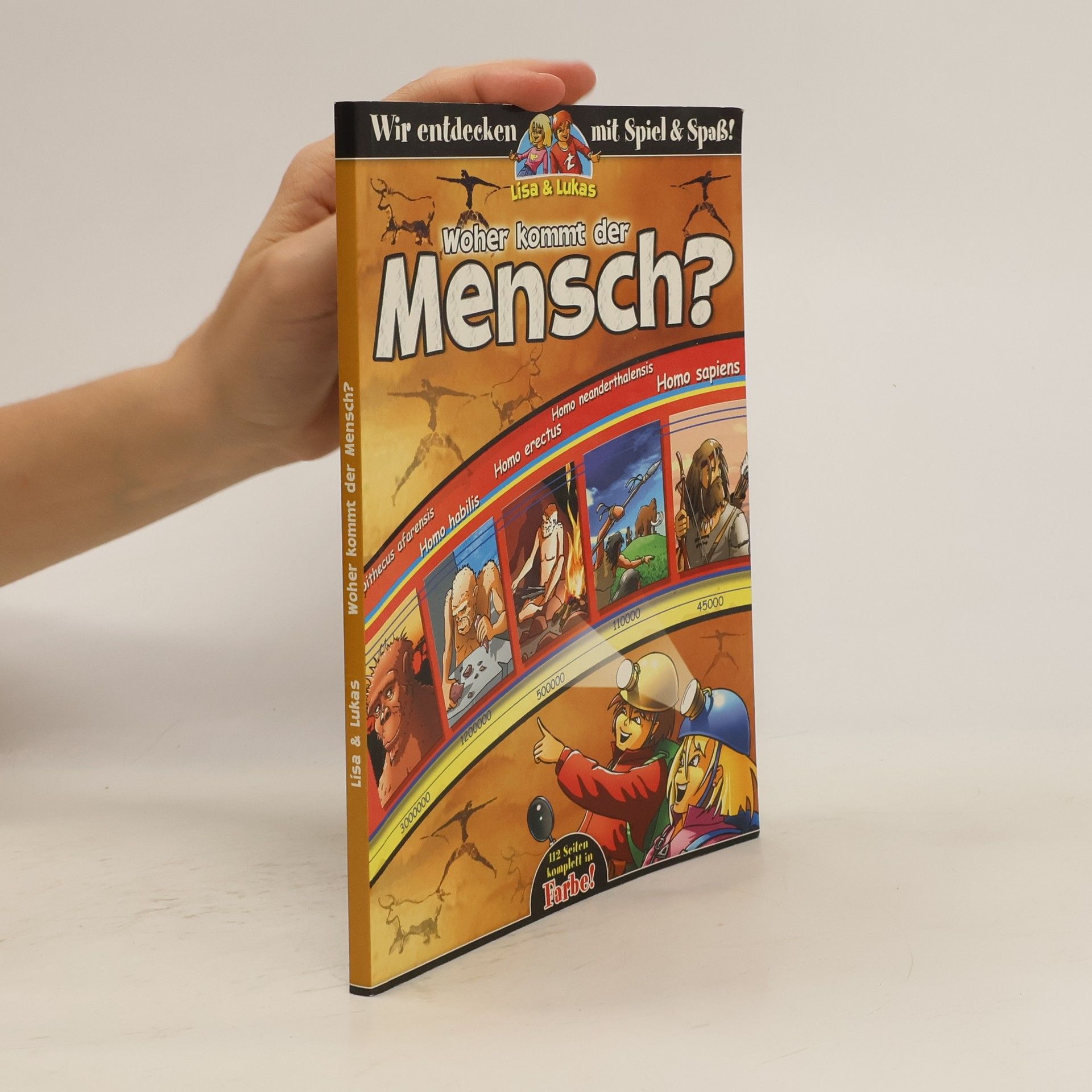Werte, Ängste, Hoffnungen
Das Erleben der Digitalisierung in der erzählten Alltagswelt
Das Thema Digitalisierung hat die kulturellen, sozialen und politischen Diskurse der letzten Jahre wesentlich geprägt. Die vorliegende, qualitative Studie geht der Frage nach, wie die Menschen über die Digitalisierung denken, welche Geschichten und Erlebnisse sie mit ihr verbinden und welche Haltung sie ihr gegenüber einnehmen. Methodisch wird ein narrativer Ansatz verfolgt und mit Einzel- und Gruppeninterviews gearbeitet. Von besonderem Interesse ist, wie die Erzählpersonen mit jenen Wertekonflikten umgehen, die sie im Zusammenhang mit der Digitalisierung erfahren. Besondere Berücksichtigung erfährt die Frage nach einem Wertewandel und wie dieser das Leben der Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft transformiert.