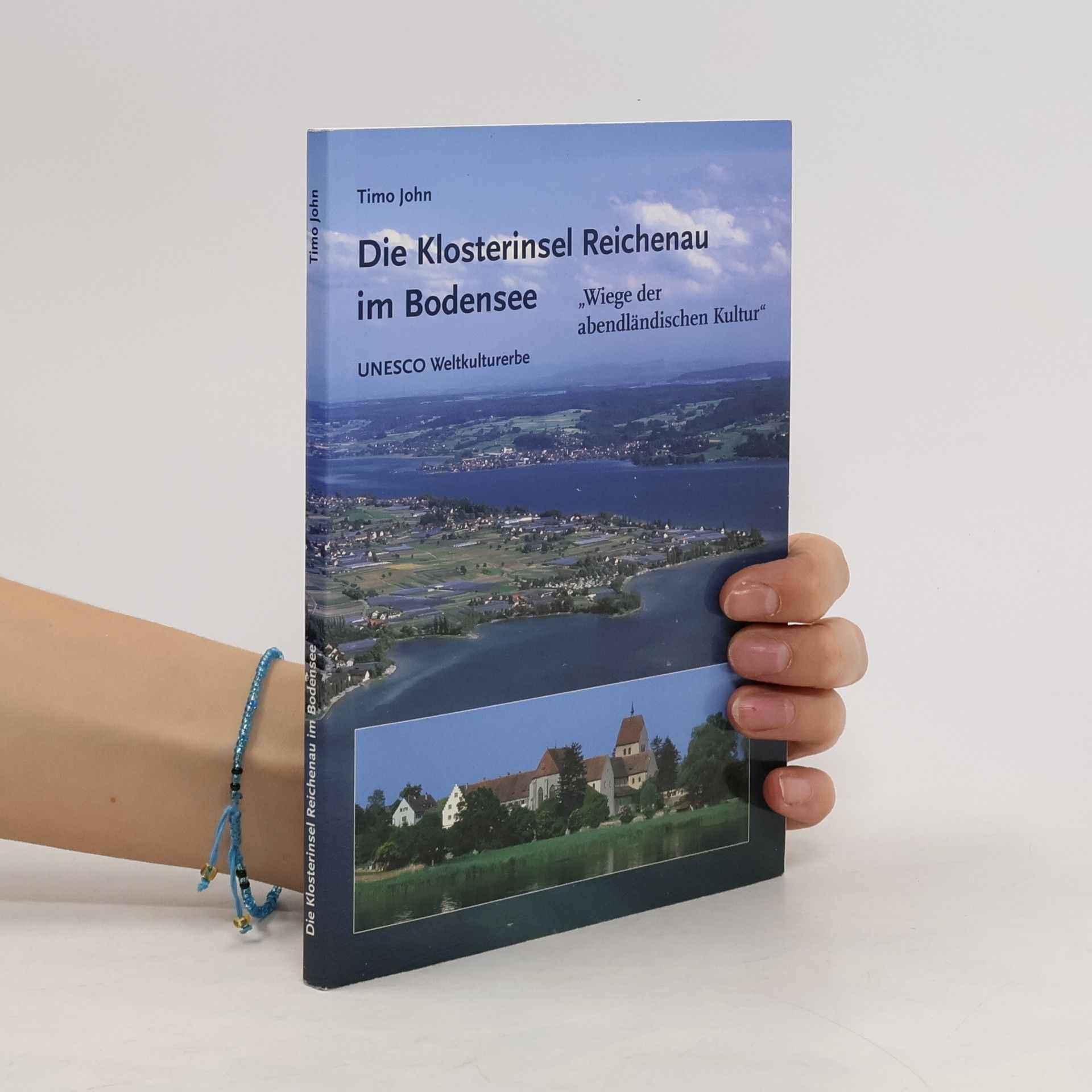Verwicklungen des Betrachters
Zur rezeptionsästhetischen Temporalität in den Werken von On Kawara, Roman Opalka, Bernd und Hilla Becher, Richard Prince, Cindy Sherman und Sophie Calle unter Berücksichtigung psychodynamischer Perspektiven
- 775 Seiten
- 28 Lesestunden
Die Analyse der zeitlichen Dimension der Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk wird in diesem Buch neu beleuchtet, indem kunstwissenschaftliche Rezeptionsästhetik mit psychodynamischen Perspektiven kombiniert wird. Es wird argumentiert, dass visuelle Wahrnehmung und ästhetische Emotionen nur in einem zeitlich erweiterten Kontext vollständig zur Geltung kommen. Durch Neubetrachtungen von Kunstwerken aus den 1960er bis 1980er Jahren wird die Relevanz dieser transdisziplinären Herangehensweise aufgezeigt, die eine differenzierte Analyse der ästhetischen Erfahrung ermöglicht.