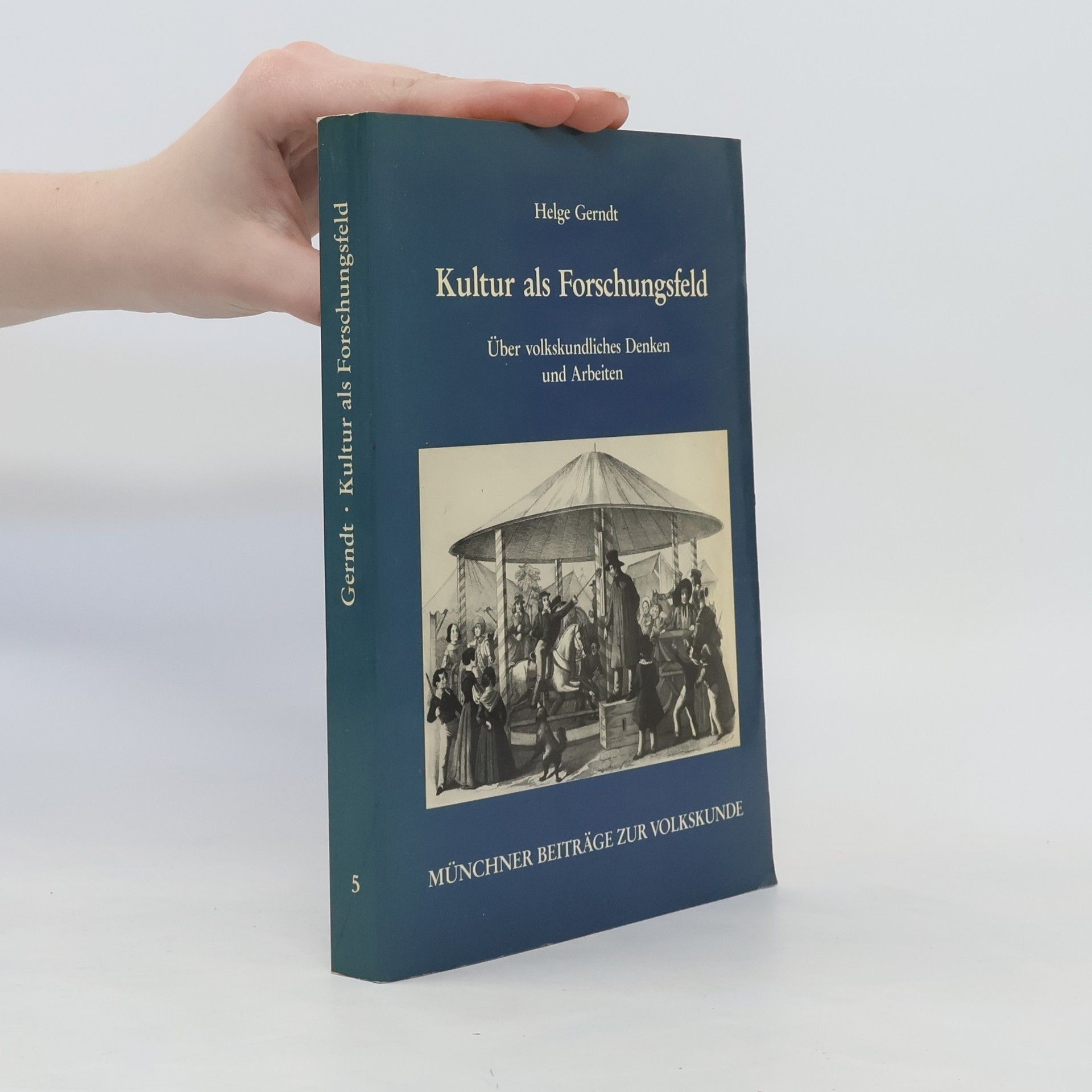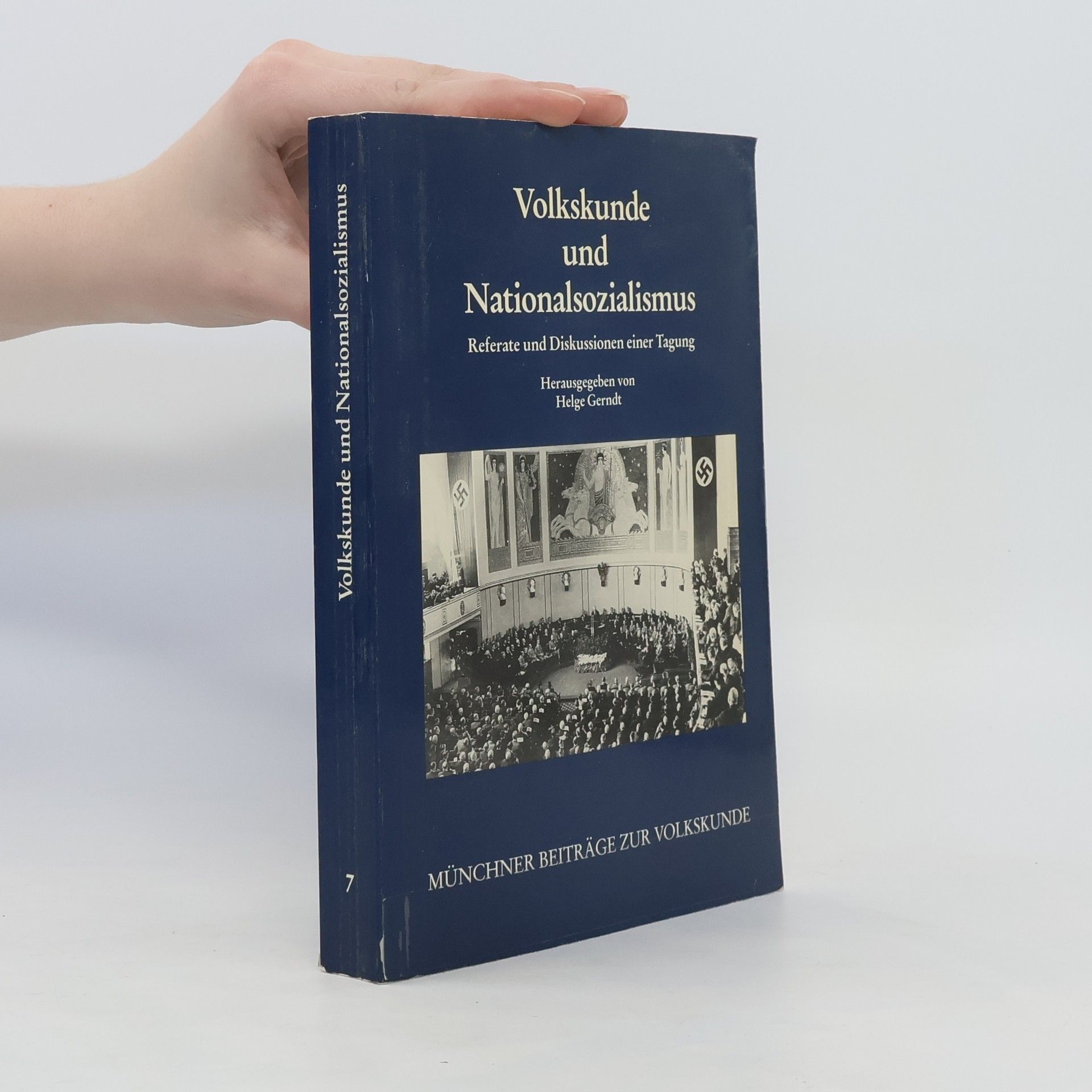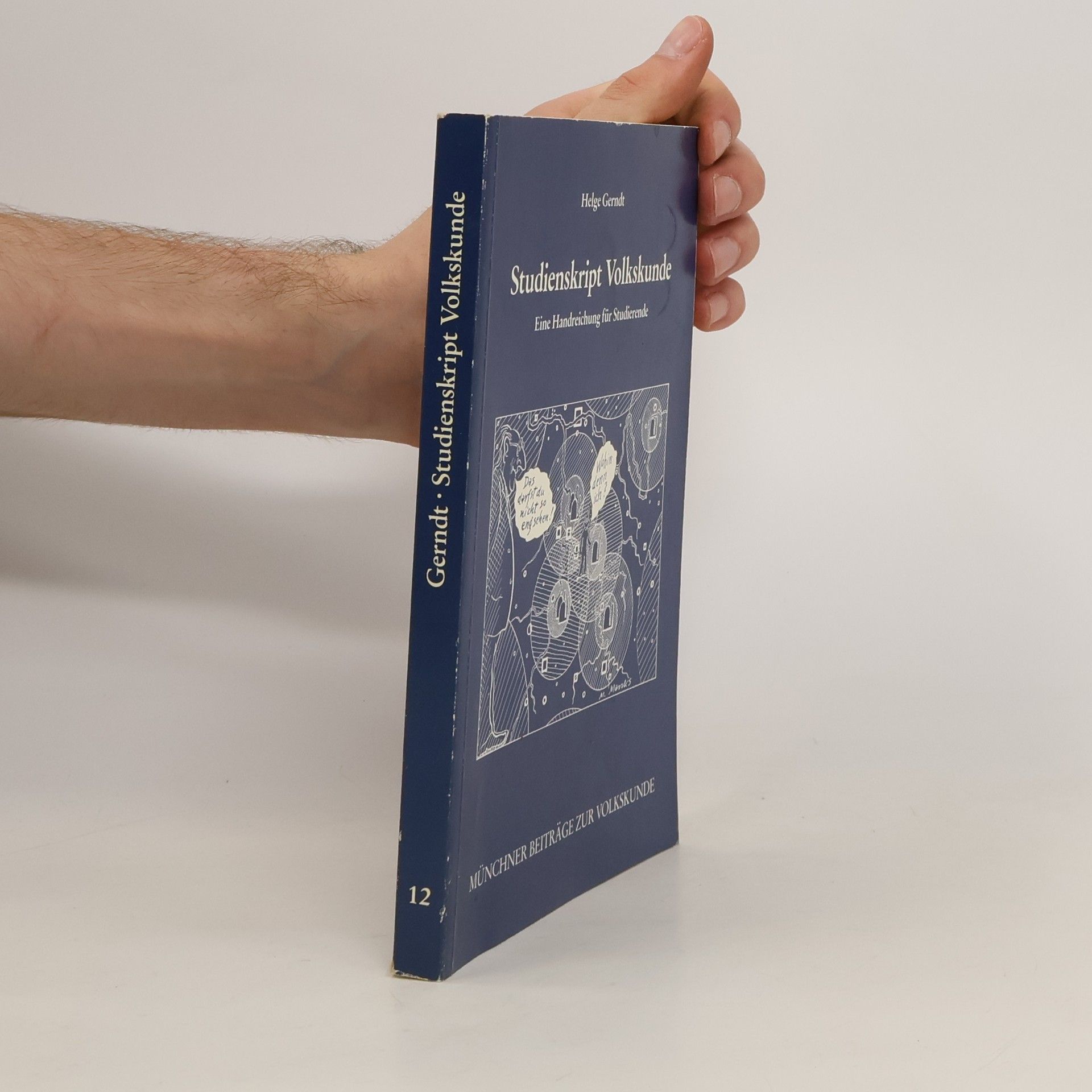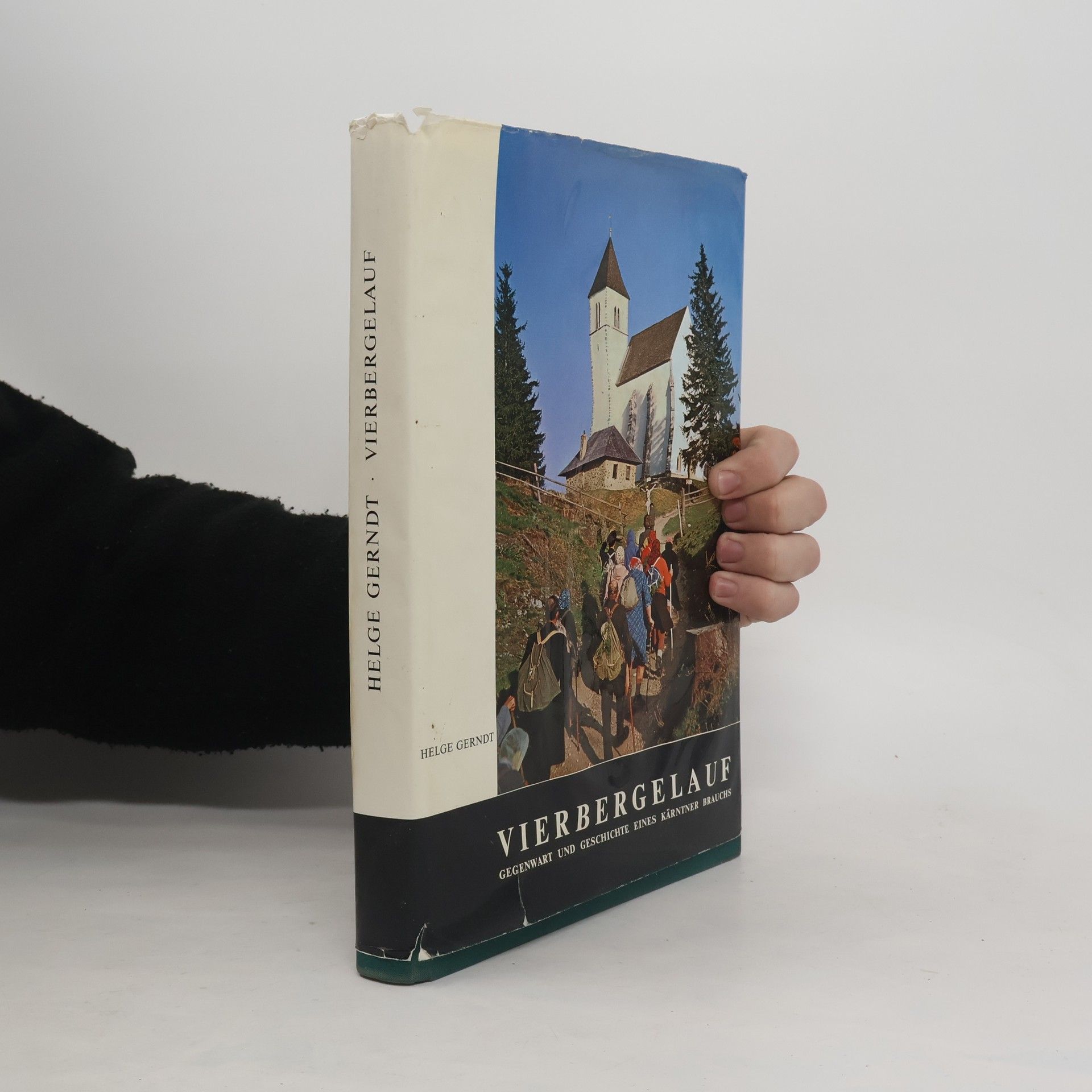Studienskript Volkskunde
- 199 Seiten
- 7 Lesestunden
Was ist Volkskunde? Warum und wozu Volkskunde studieren? Welcher Methoden, Techniken und Quellen bedient sich das Fach? Eine exemplarische Auswahl an Untersuchungsfeldern, anhand derer unterschiedliche theoretisch-methodische Ansätze erläutert werden, spiegelt - von der traditionsreichen Erzählforschung bis hin zu aktuellen Themen wie „Tschernobyl als kulturelle Tatsache“ - das weitreichende Spektrum dieses Faches. Das Buch bietet Studienanfängern elementare Hilfe an (Arbeitstechnik, Adressen). Es will darüber hinaus mit pointierten Aussagen und einer konzentrierten Literaturauswahl Orientierung ermöglichen und eine für gesellschaftliche Probleme der Gegenwart offene Grundhaltung kulturwissenschaftlichen Denkens nahebringen.