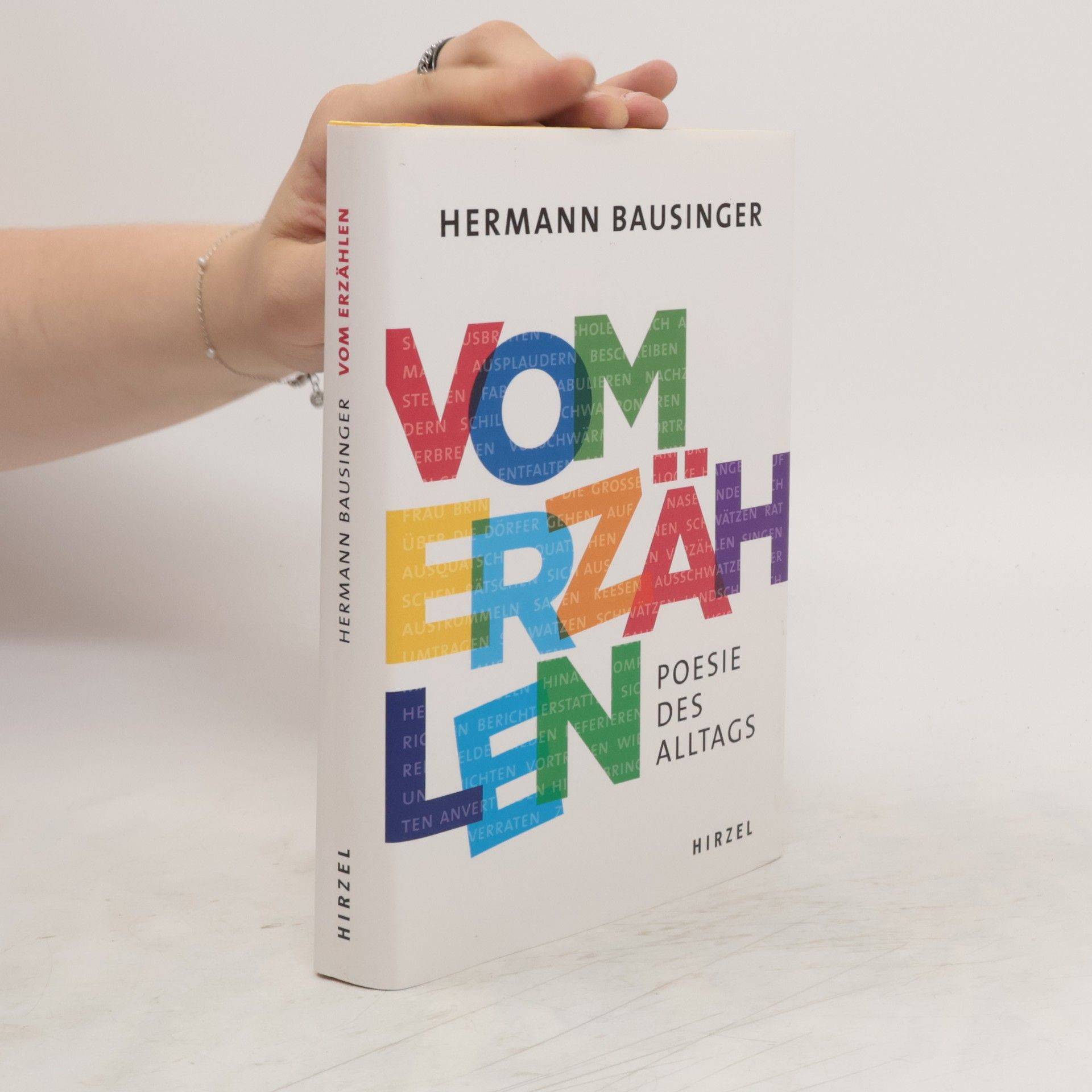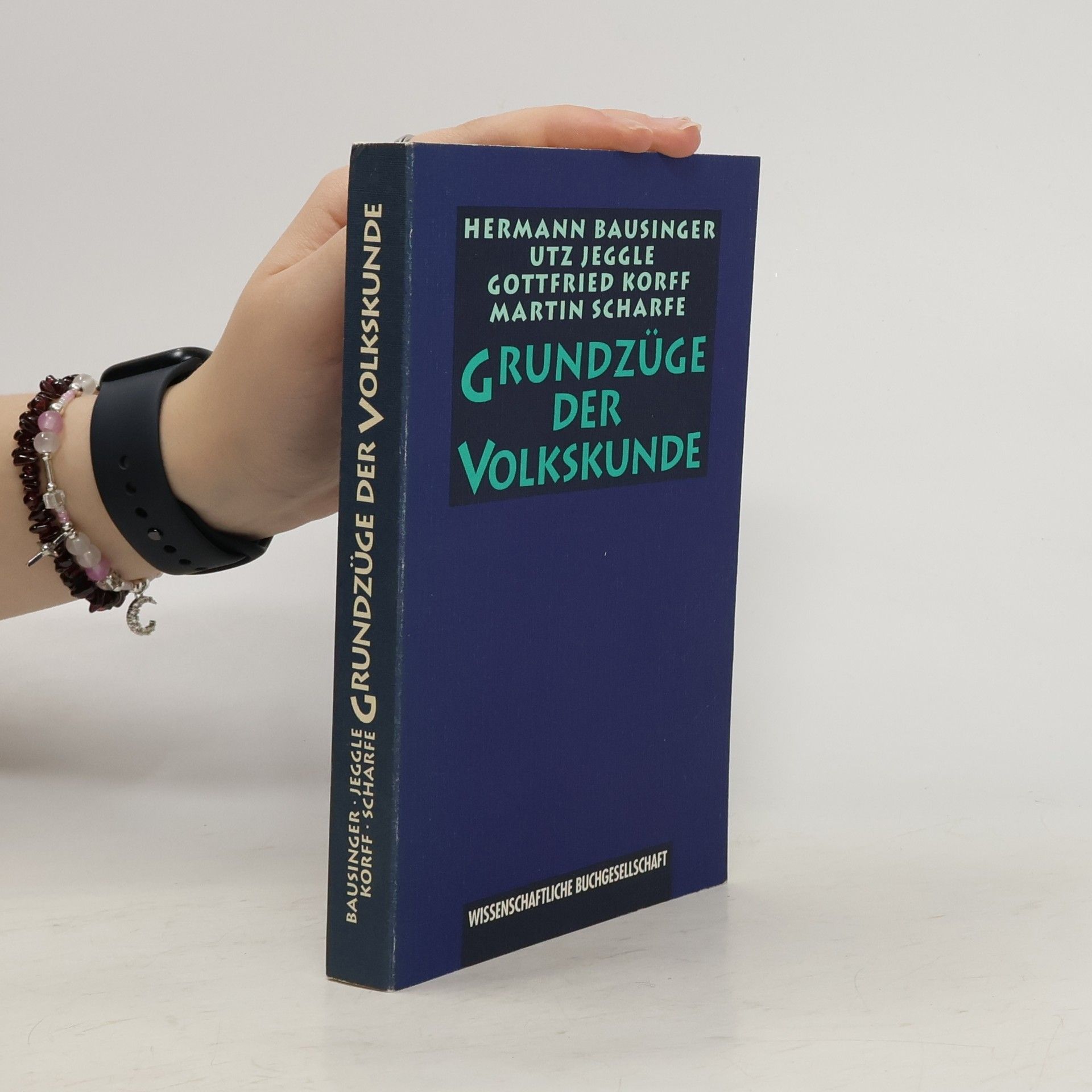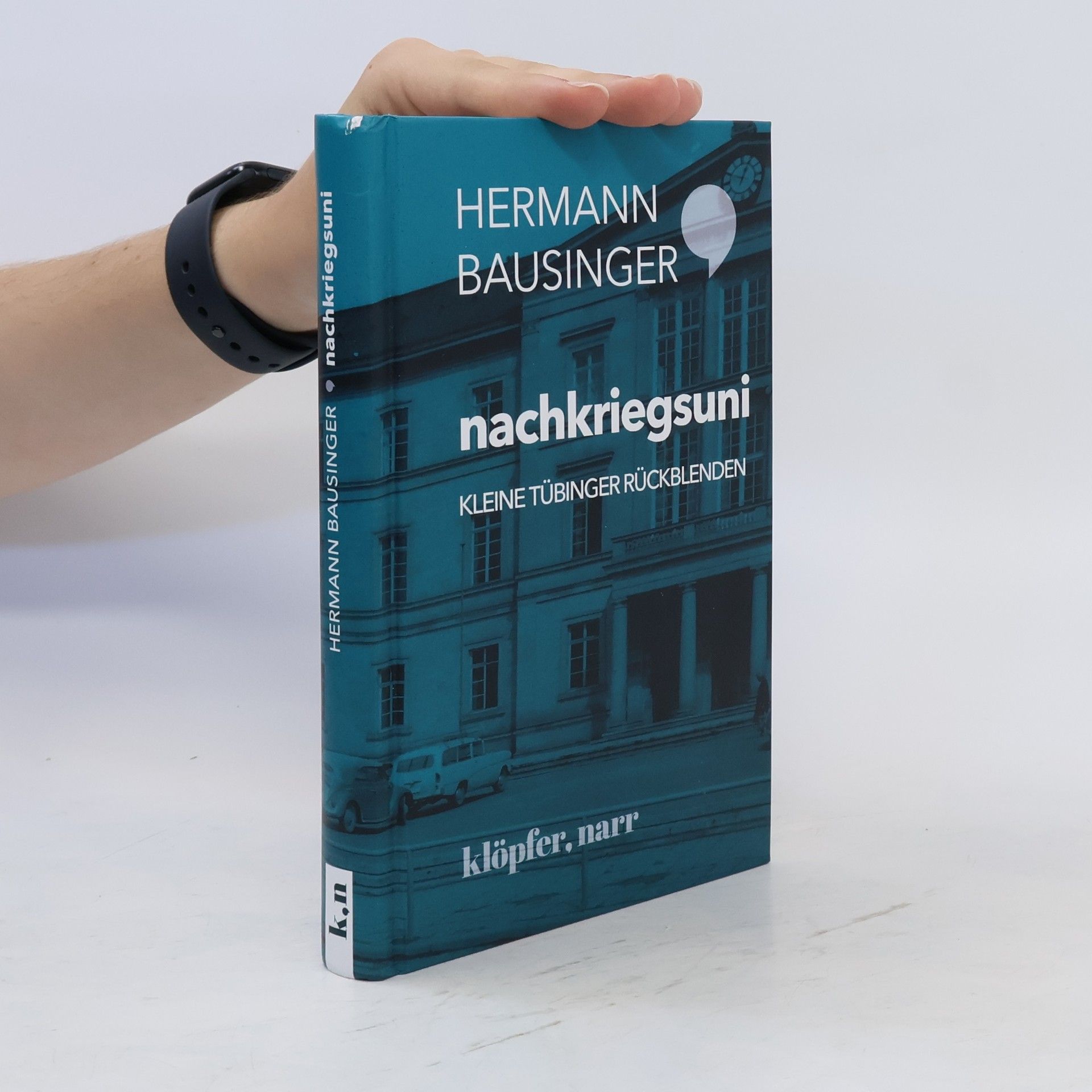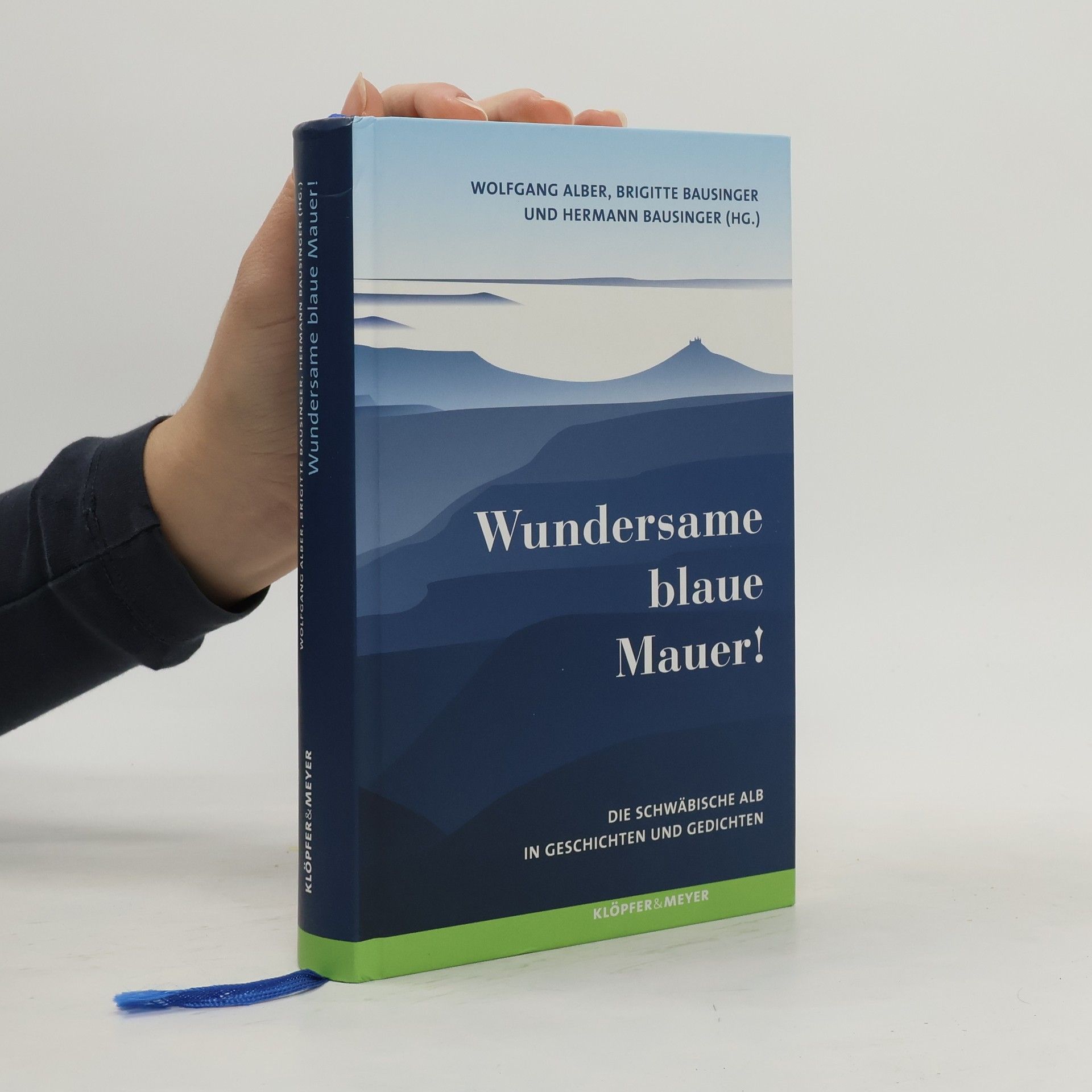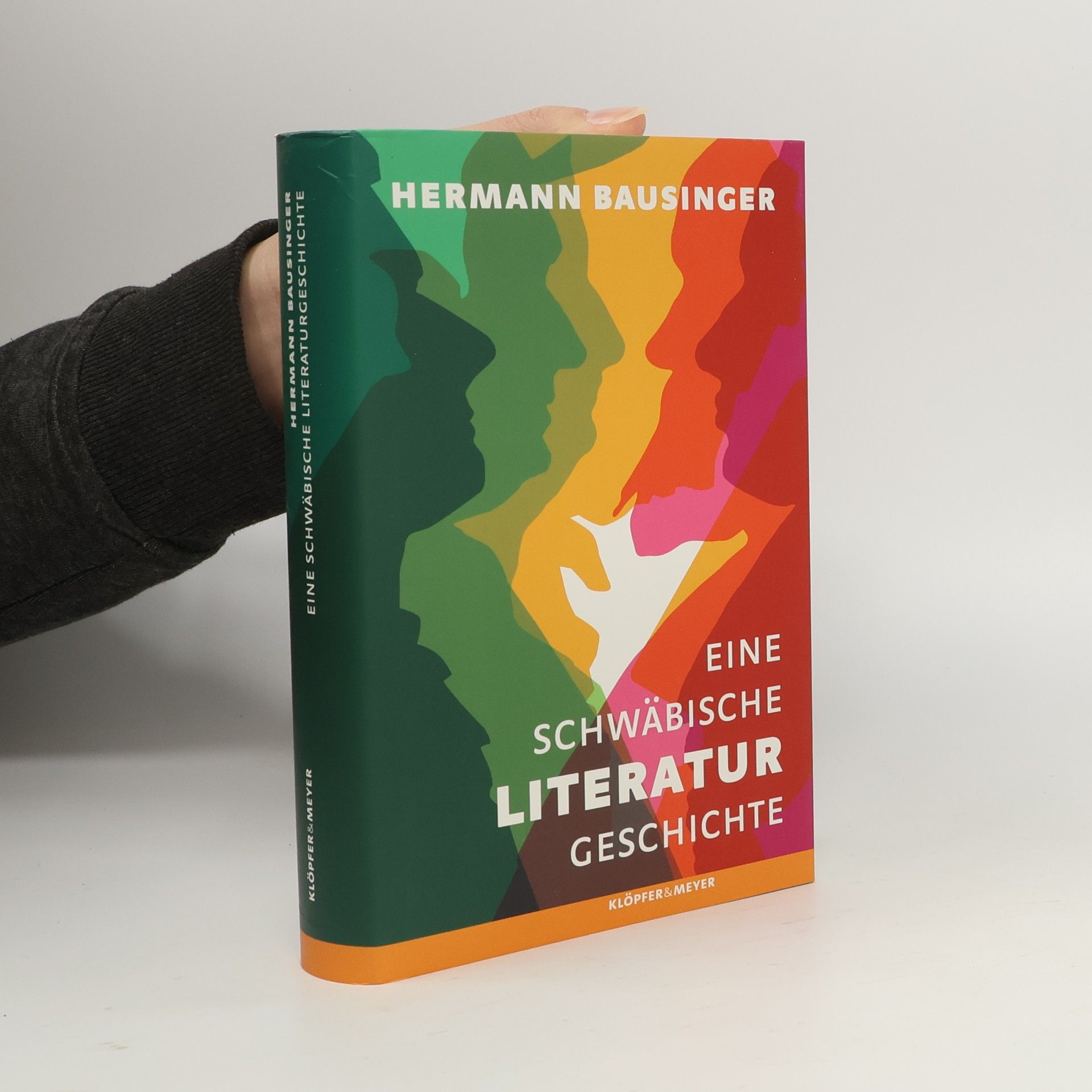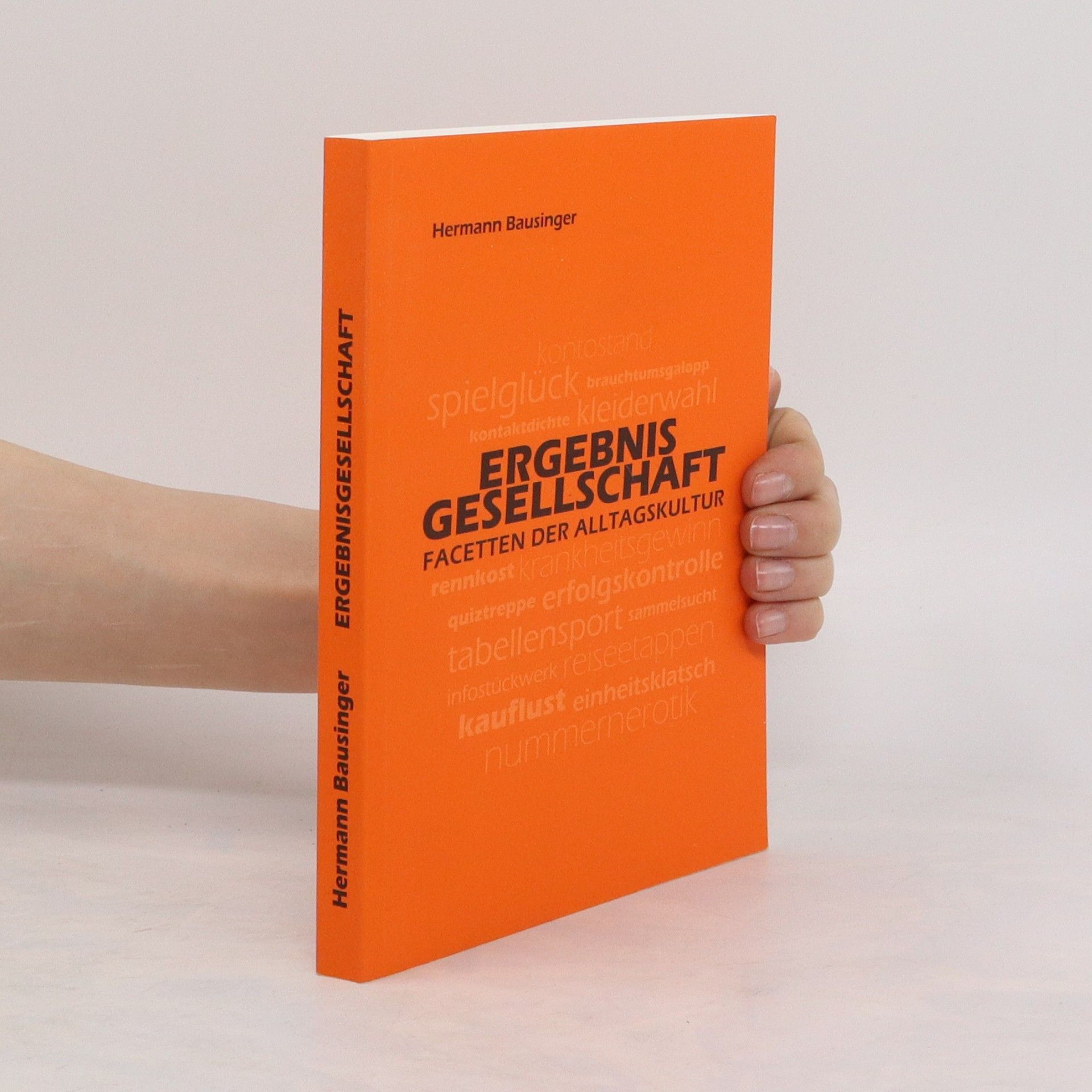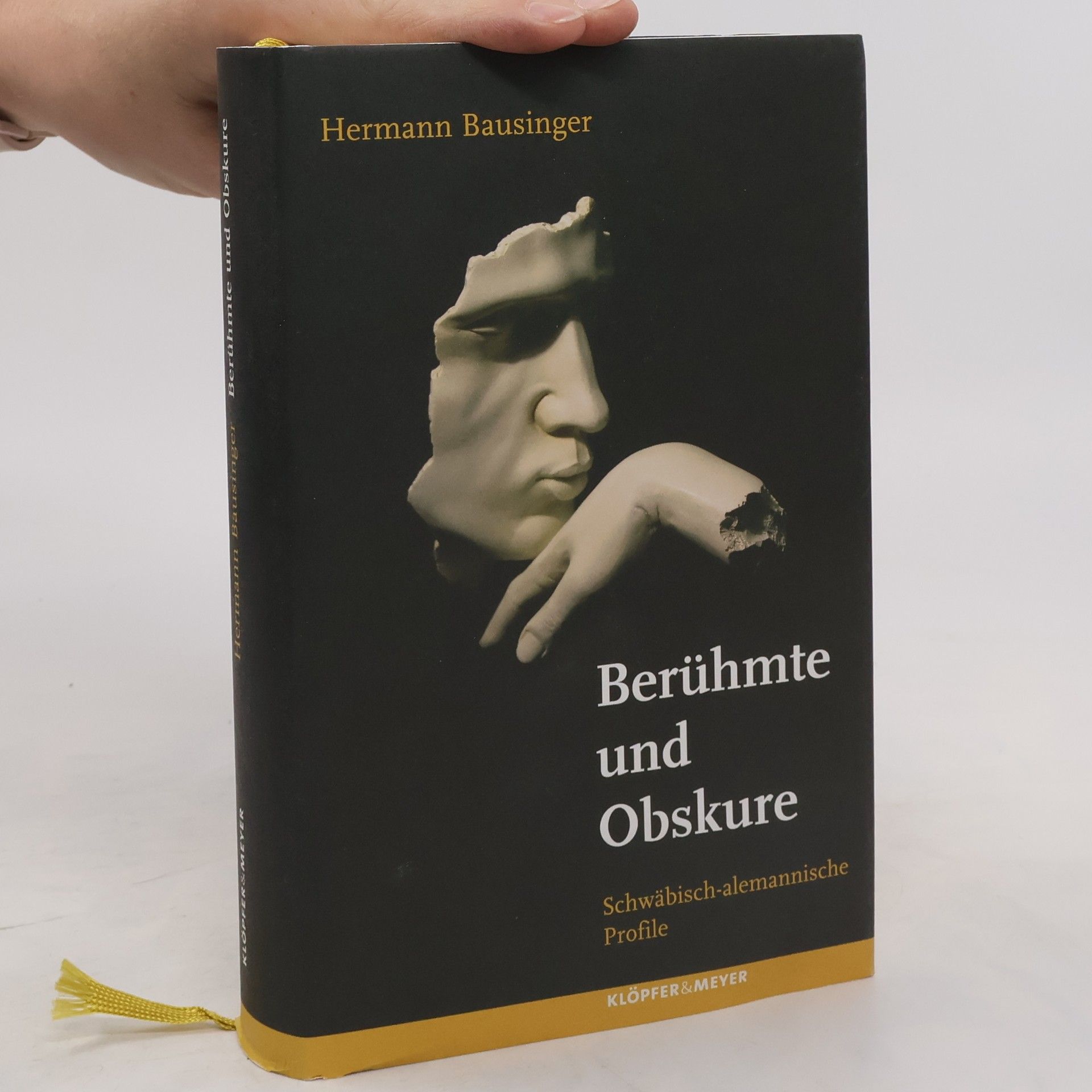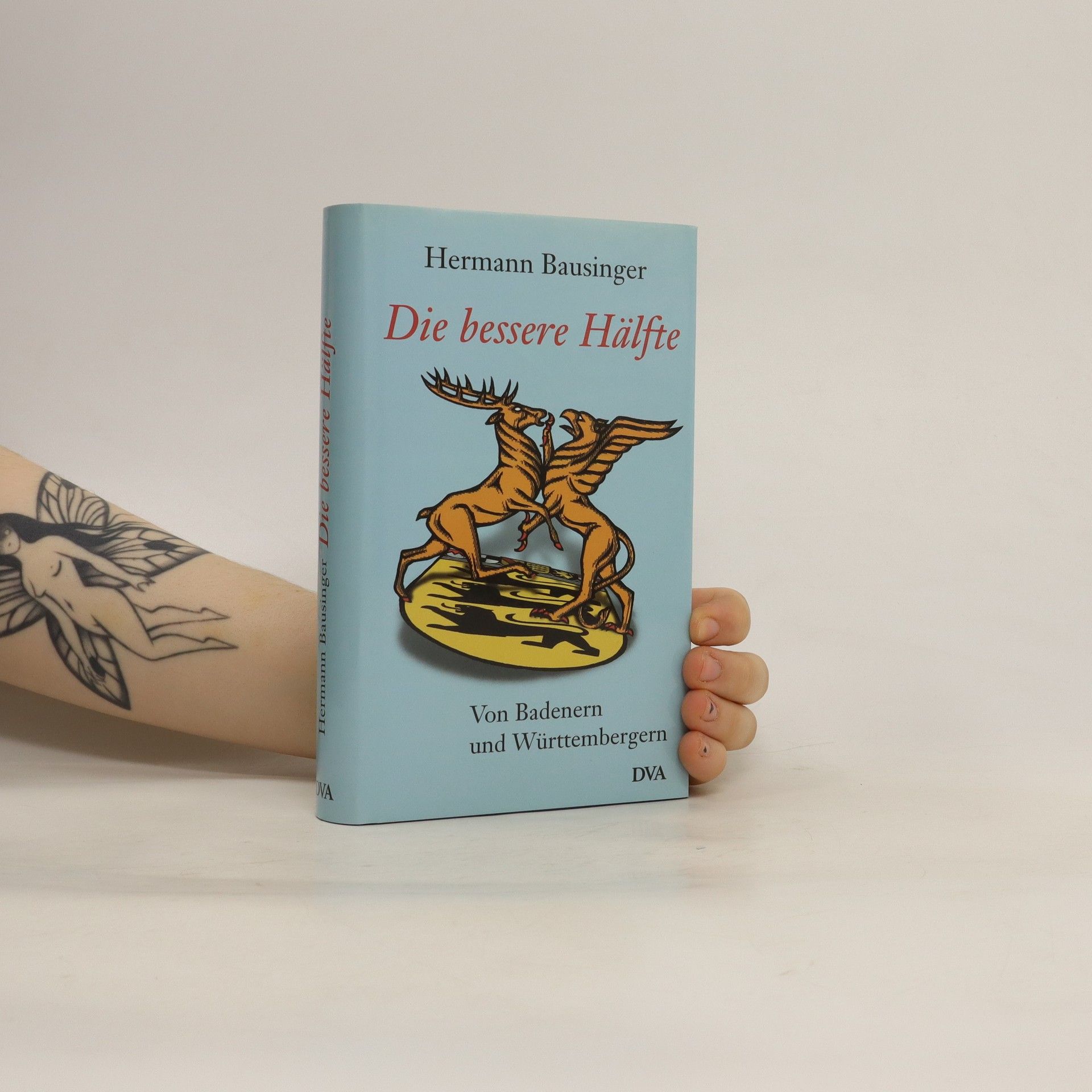Typisch deutsch
Wie deutsch sind die Deutschen?
Typisch deutsch? Diese Frage, die Hermann Bausinger vor gut 20 Jahren stellte, ist heute nicht weniger aktuell. Sie hat eher an Aktualität gewonnen. Deutschland war schon immer ein Land der Vielfalt. Viele Länder, viele Dialekte, viele Regionen. Man hat sogar behauptet, deutsch gäbe es nicht außer der Sprache. Unseren Nachbarn dagegen fällt einiges ein. Es dürfte sich nicht zufällig mit den Ausführungen in diesem Band überschneiden. Sandburgen sind in Dänemark unbekannt. Der deutsche Fußball allgemein hoch angesehen, ebenso die Autos. Den deutschen Wald stellte man im 19. Jahrhundert der englischen Freiheit gegenüber. Während der Gartenzwerg eher zurücktritt, erobert sich das Windrad einen unübersehbaren Platz. Die Beschreibung des Alltäglichen dieser fundierten Studie bietet überraschende Einsichten in die Befindlichkeit der Deutschen.