Manche Romane entfalten, obwohl vor fast 200 Jahren geschrieben, erst heute ihre ganze Wirkung. Waren zeitgenössische Leser von Die Elixiere des Teufels -- erstmals 1815 und 1816 in zwei Bänden erschienen -- eher überfordert, steht der Roman heute als ein Meisterwerk der Fantastik in zahlreichen Bücherschränken. Auf den ersten Blick erzählt Hoffmann eine nicht eben neue Schauergeschichte: Der Bruder Medardus ist ein hoch angesehenes, für seine feurigen Predigten bekanntes Mitglied der Klostergemeinde. Als ihm die Aufsicht über die Reliquienkammer übertragen wird, beginnt jedoch sein Niedergang. Unter den Schätzen befindet sich auch eine Flasche der Elixiere des Teufels, mit denen der Satan vor Jahrhunderten den heiligen Antonius verführen wollte. Ein Schluck aus der Flasche besiegelt seinen Abstieg. Obgleich seine Predigten feuriger denn je werden, verliert er sich in Selbstverliebtheit und entsagt so dem Göttlichen. In der Hoffnung, Medardus Seele zu retten schickt ihn der Prior des Klosters auf die Reise nach Rom. Einmal frei von den Mauern des Klosters, beginnt Medardus Kampf gegen den den Verführer. Seine Reise ist gegprägt von Lügen, Diebstahl und Mord. Immer wieder begegnet er Personen, die ihm erstaunlich ähnlich sind. In diesen findet er all seine Schwächen wieder, er schlüpft in ihre Rollen, versucht ihr Leben und findet letztlich doch wieder zu sich selbst zurück.
Hartmut Steinecke Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

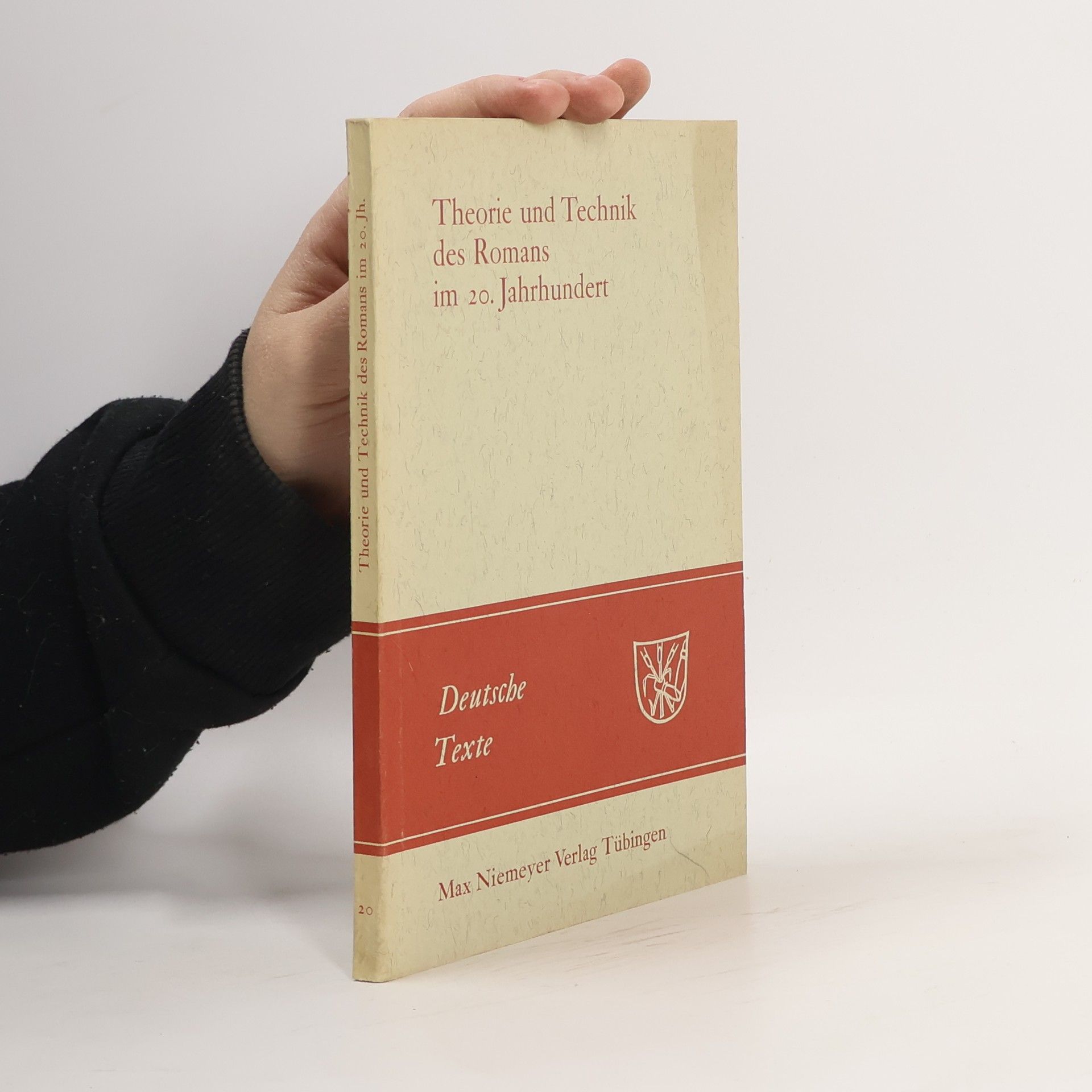
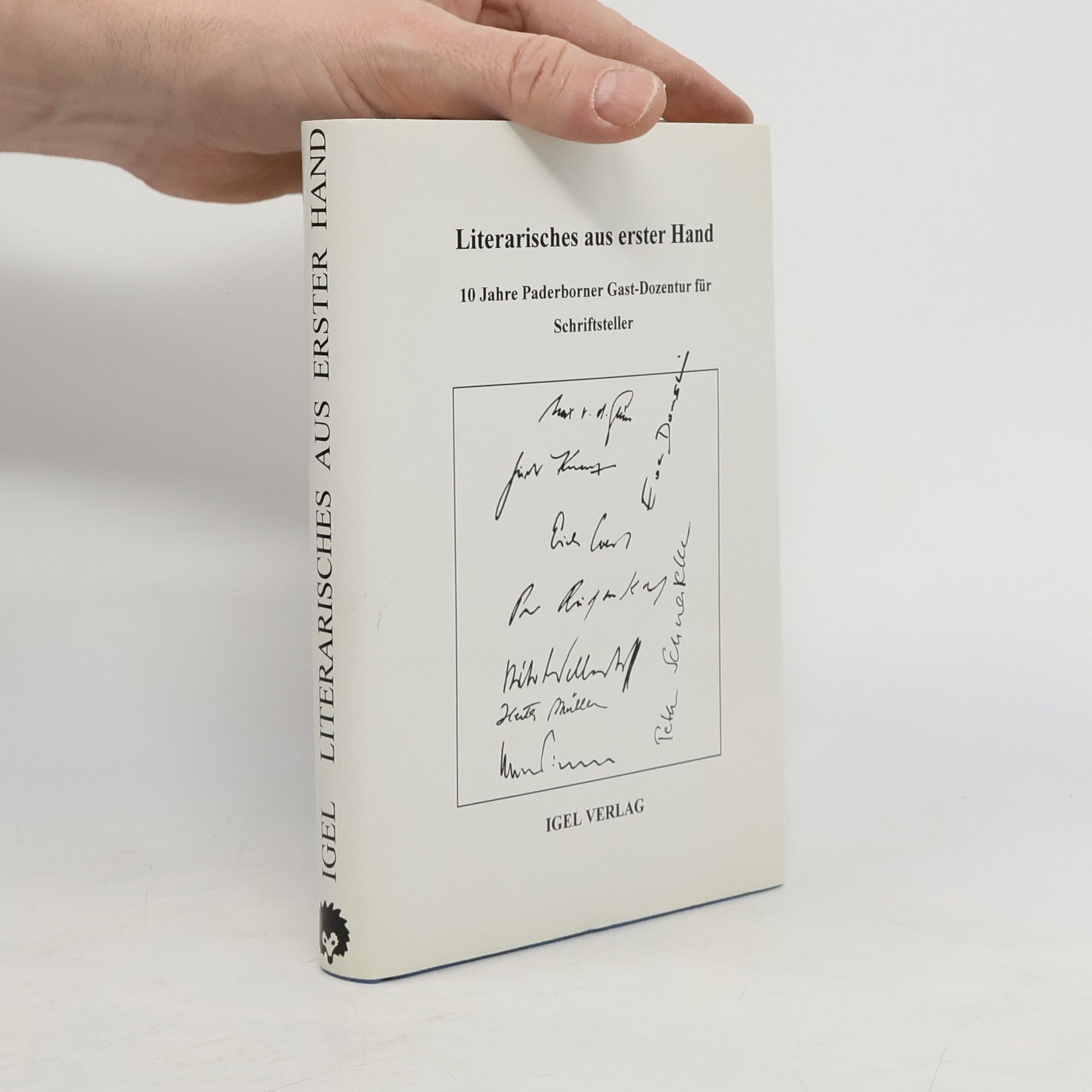
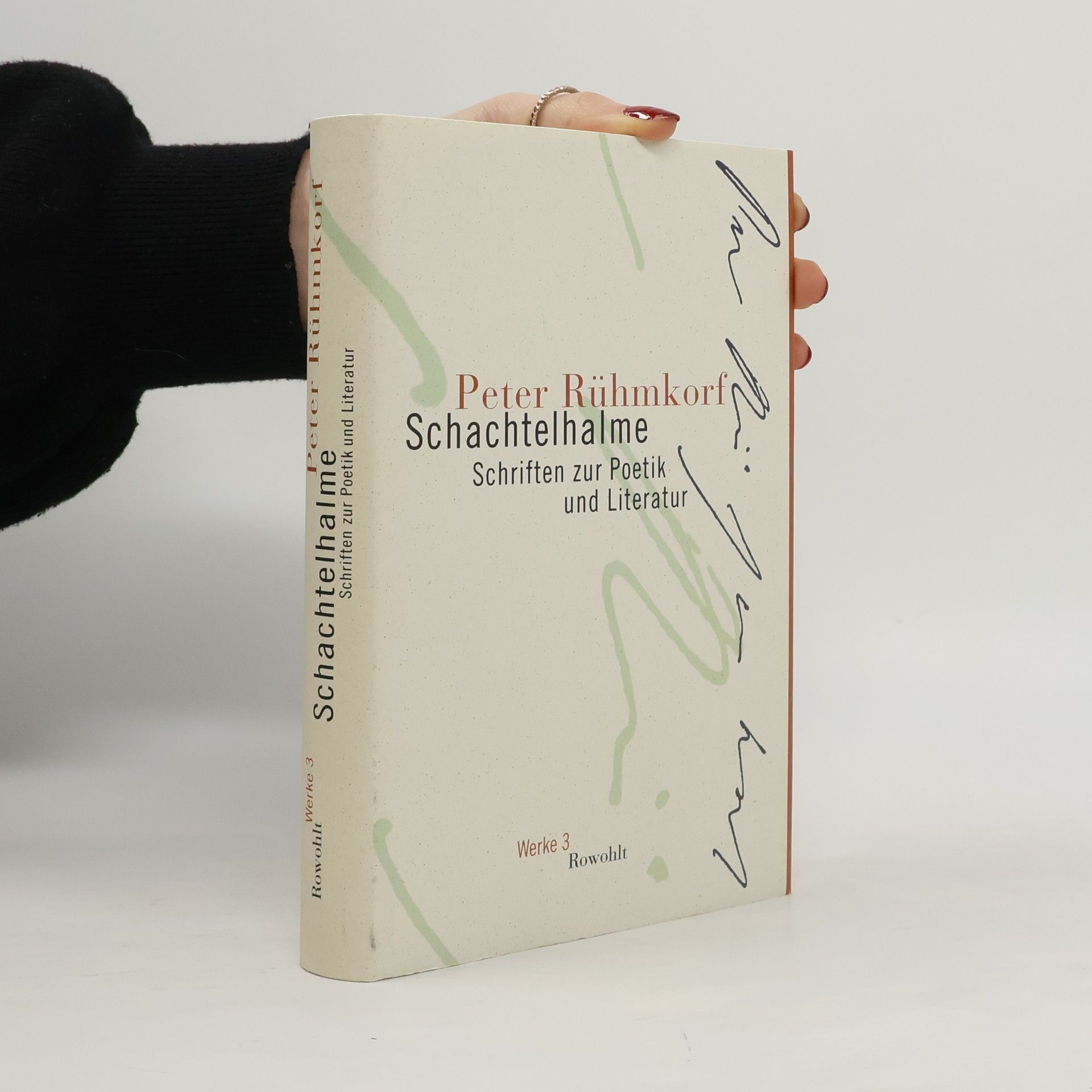
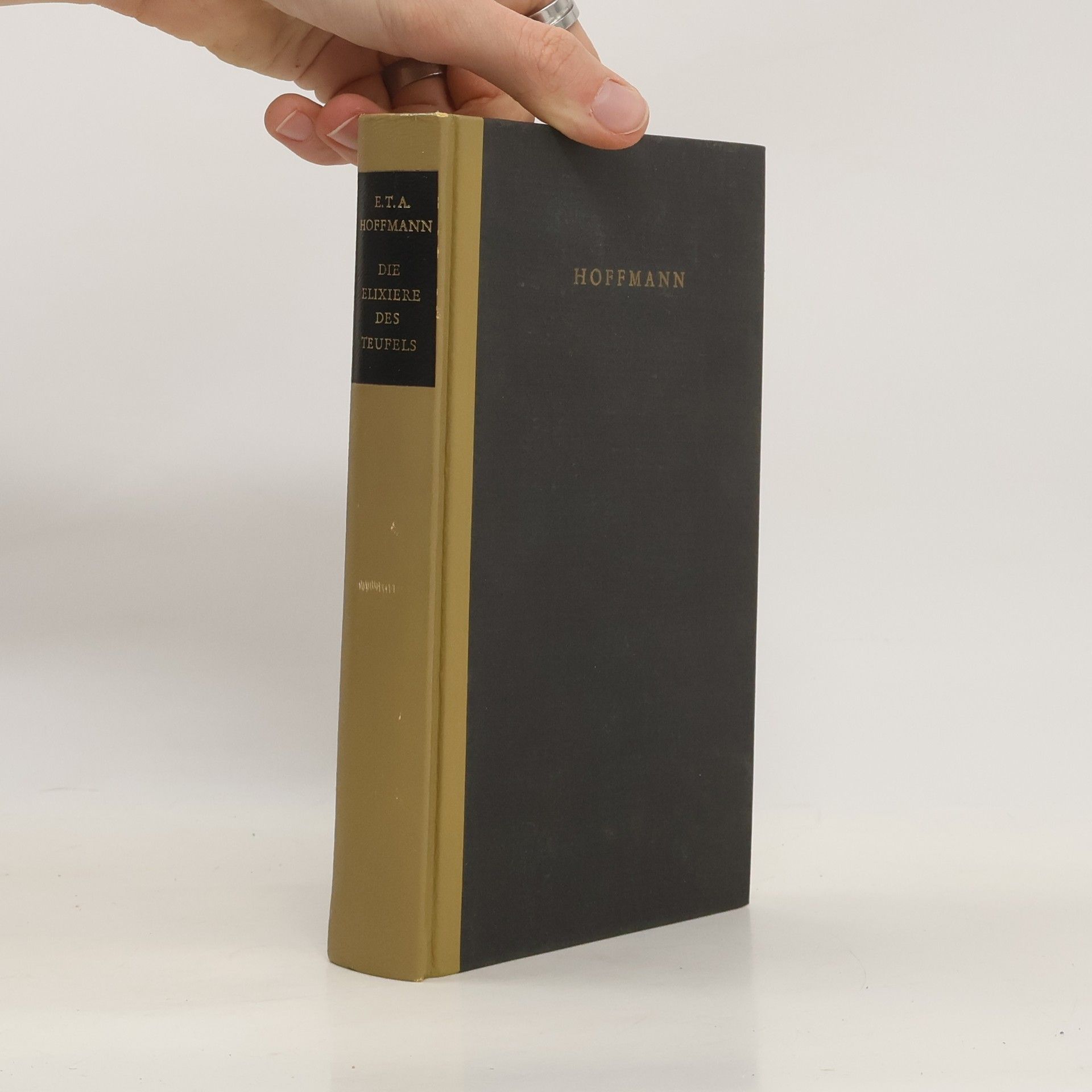
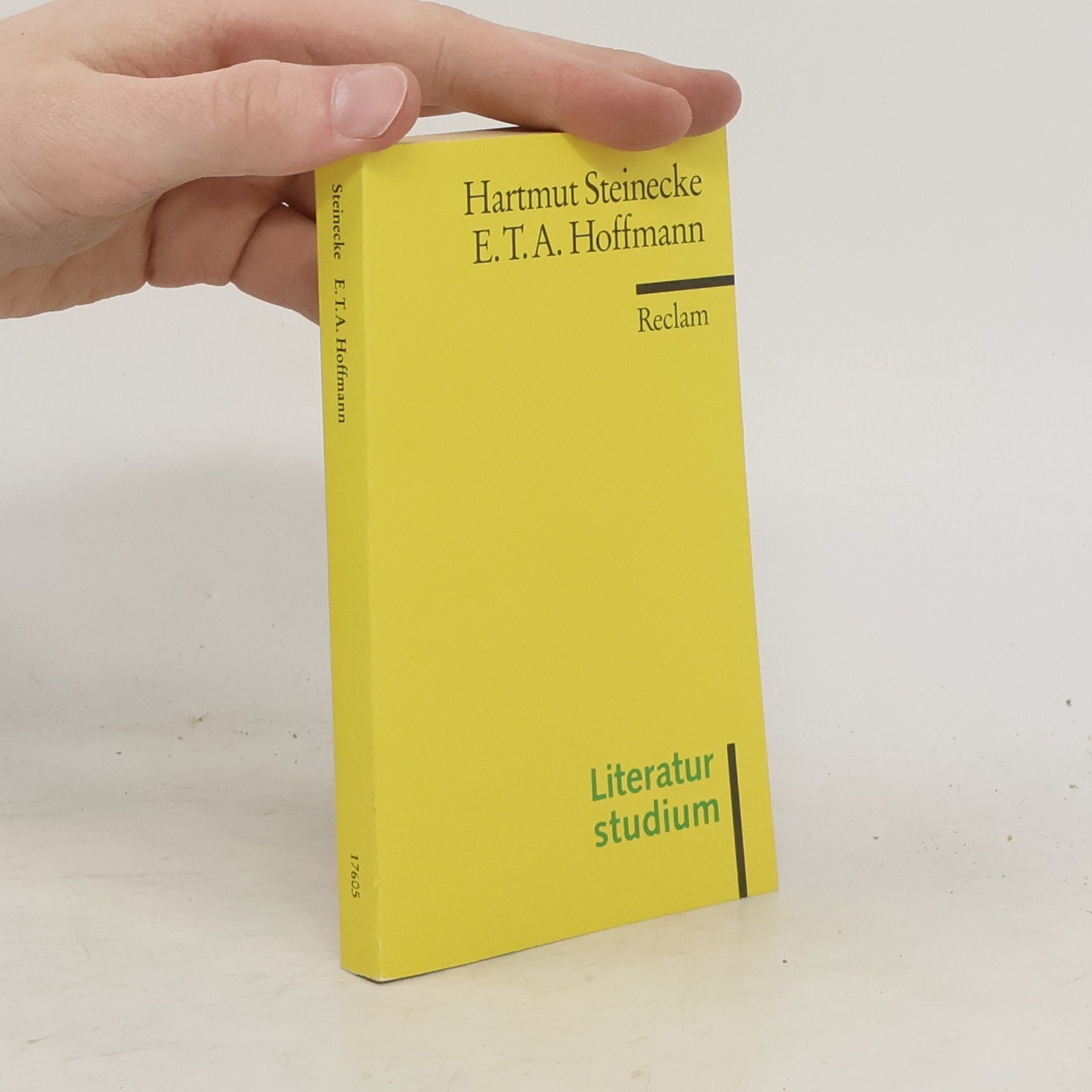
Schachtelhalme. Werke 03
- 410 Seiten
- 15 Lesestunden
E. T. A. Hoffmann (1776-1822) war Erzähler, Romancier, Kritiker, Komponist, Zeichner und hauptberuflich auch noch Jurist. In seinem Werk steht die Künstlererzählung neben der Oper, das Märchen neben der politischen Karikatur, der Schauerroman neben der Gesellschaftssatire. Und zur Vielfalt tritt die Vielschichtigkeit: Hoffmann verstand es, das scheinbar Leichte mit dem künstlerisch Komplexen zu verbinden, zugleich ein breites Lesepublikum zu unterhalten und Künstlerkollegen zu faszinieren. Der Band erzählt die Stationen von Hoffmanns nur 46 Jahre dauerndem Leben nach, gibt einen Überblick über das vielgestaltige Werk und widmet sich einlässlich interpretierend den beiden Romanen und den wichtigsten Erzählungen.
Serie Piper Materialien: Hanns-Josef Ortheil, im Innern seiner Texte
Studien zu seinem Werk
- 260 Seiten
- 10 Lesestunden
Literarisches aus erster Hand
10 Jahre Paderborner Gast-Dozentur für Schriftsteller
- 241 Seiten
- 9 Lesestunden