Die Diskurswerkstatt im DISS (Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung) hat ein Begriffslexikon zur Kritischen Diskursanalyse erarbeitet. Dieses Lexikon enthält über 200 Definitionen zentraler Begriffe, die sich letzen Endes auf die Arbeiten von Michel Foucault beziehen. In einer Einleitung wird das zentrale Netz von Diskurstheorie und Diskursanalyse entfaltet, in dem sich diese Begriffe verorten lassen.
Siegfried Jäger Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
17. April 1937 – 16. August 2020

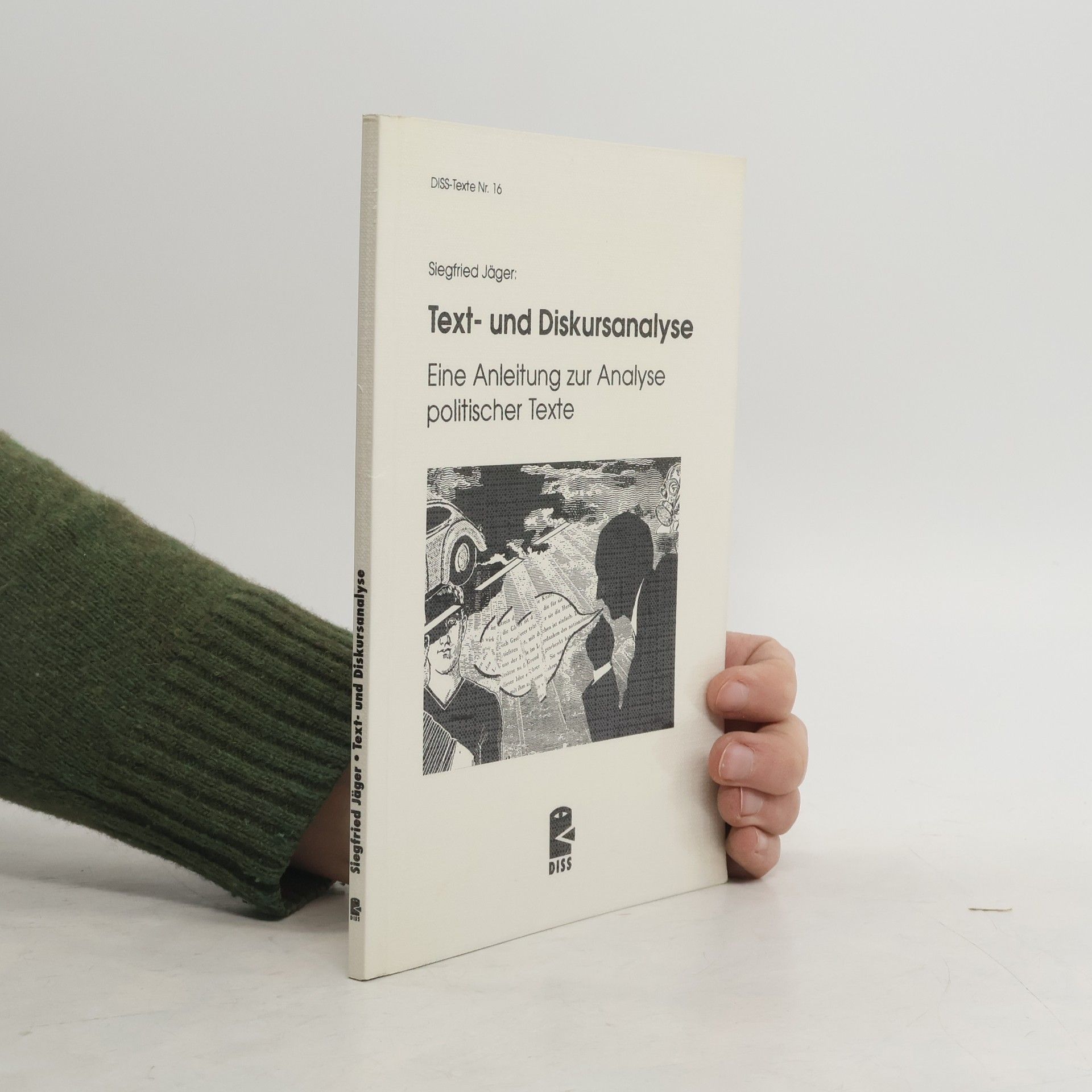
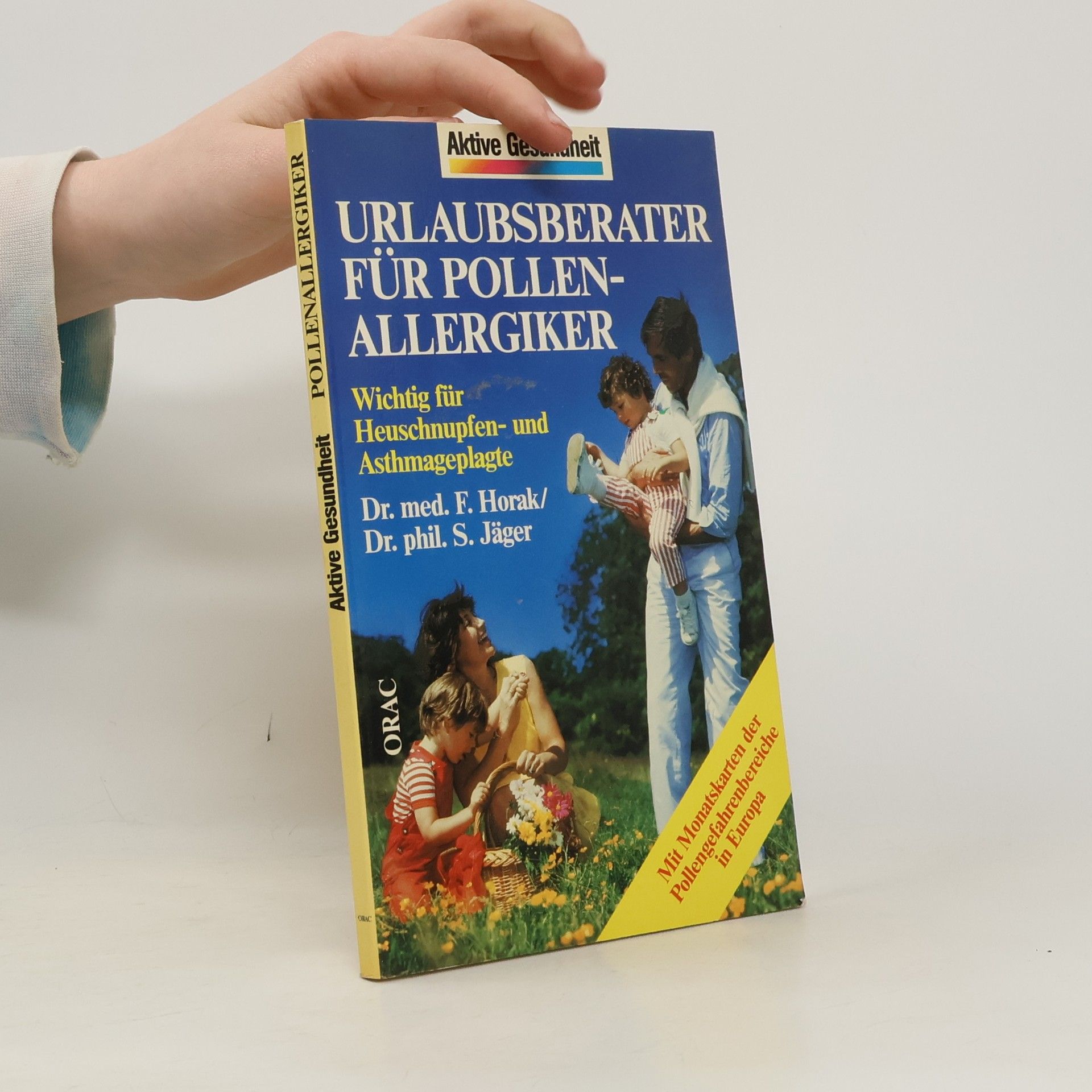
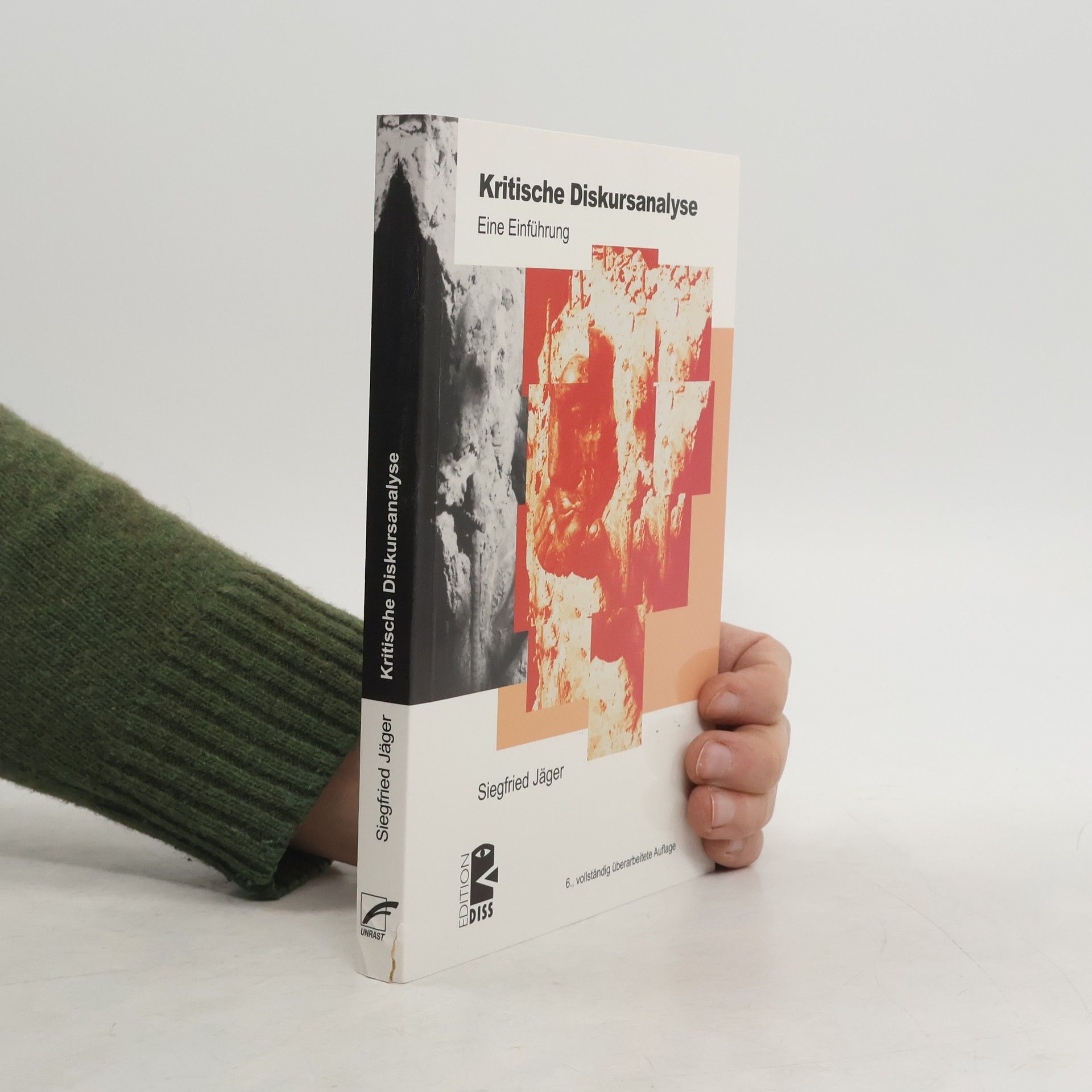
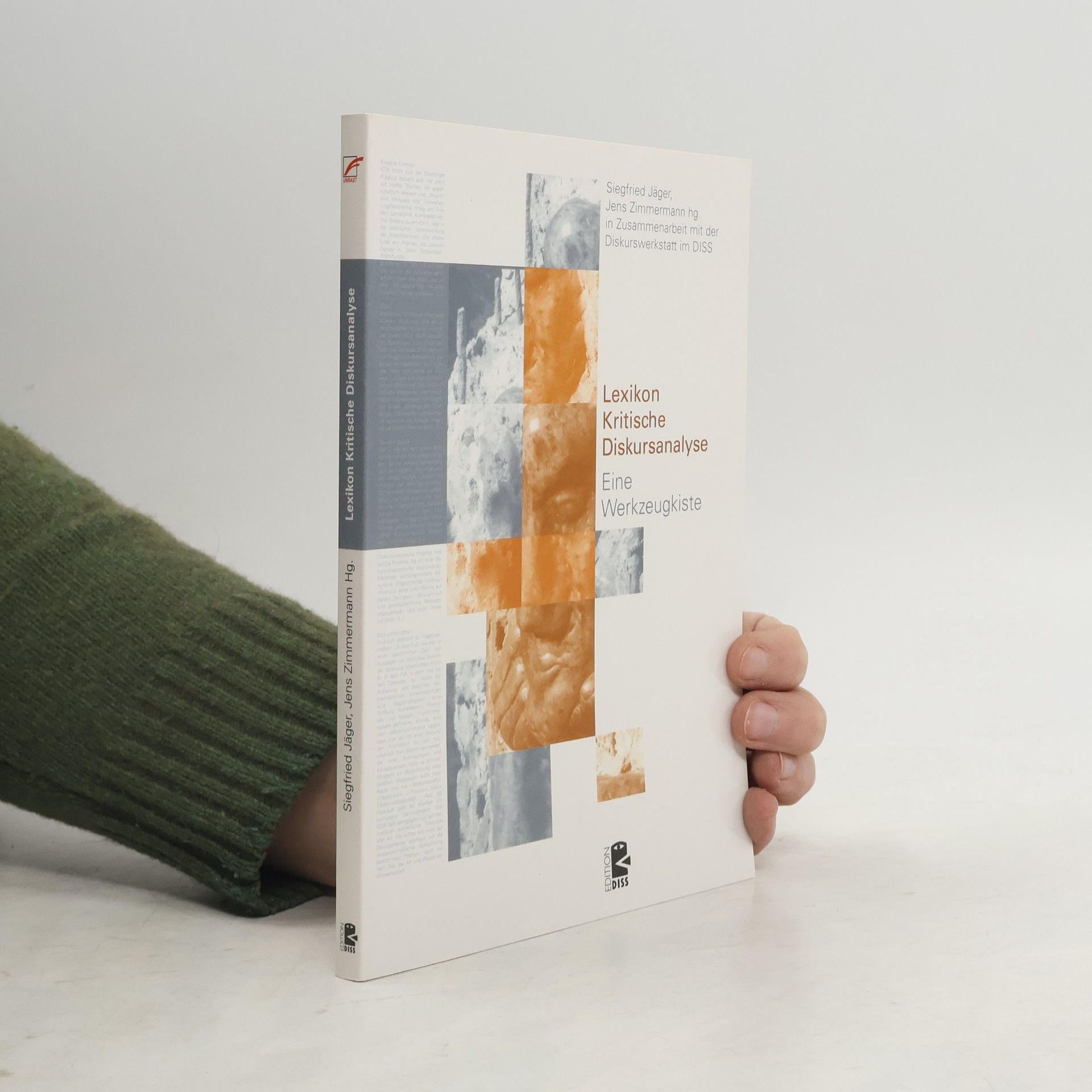
Entlarvung einer Mogelpackung. Wenn man in Vorträgen, Seminaren oder bei Rundfunk- und Fernsehgesprächen die Wochen-Zeitschrift 'Junge Freiheit' als rechtsextrem bezeichnet, erntet man häufig Widerspruch und Erstaunen. Die 'Junge Freiheit' sei doch eine interessante Zeitung, ein niveauvolles Blatt, wohl ein wenig konservativ, aber doch vielfältig und ausgewogen. Auch wird man darauf hingewiesen, dass es viele prominente Schriftsteller und Politiker gebe, die hier publizierten oder sich von ihr interviewen lassen.
Enth.: "Bestimmt Hitler die Richtlinien unserer Politik?"... / Siegfried Jäger. "Der irre Saadam setzt seinen Krummdolch an meine Gurgel".../ Jürgen Linke.
Urlaubsberater für Pollenallergiker
- 85 Seiten
- 3 Lesestunden