Ernst Pitz Bücher
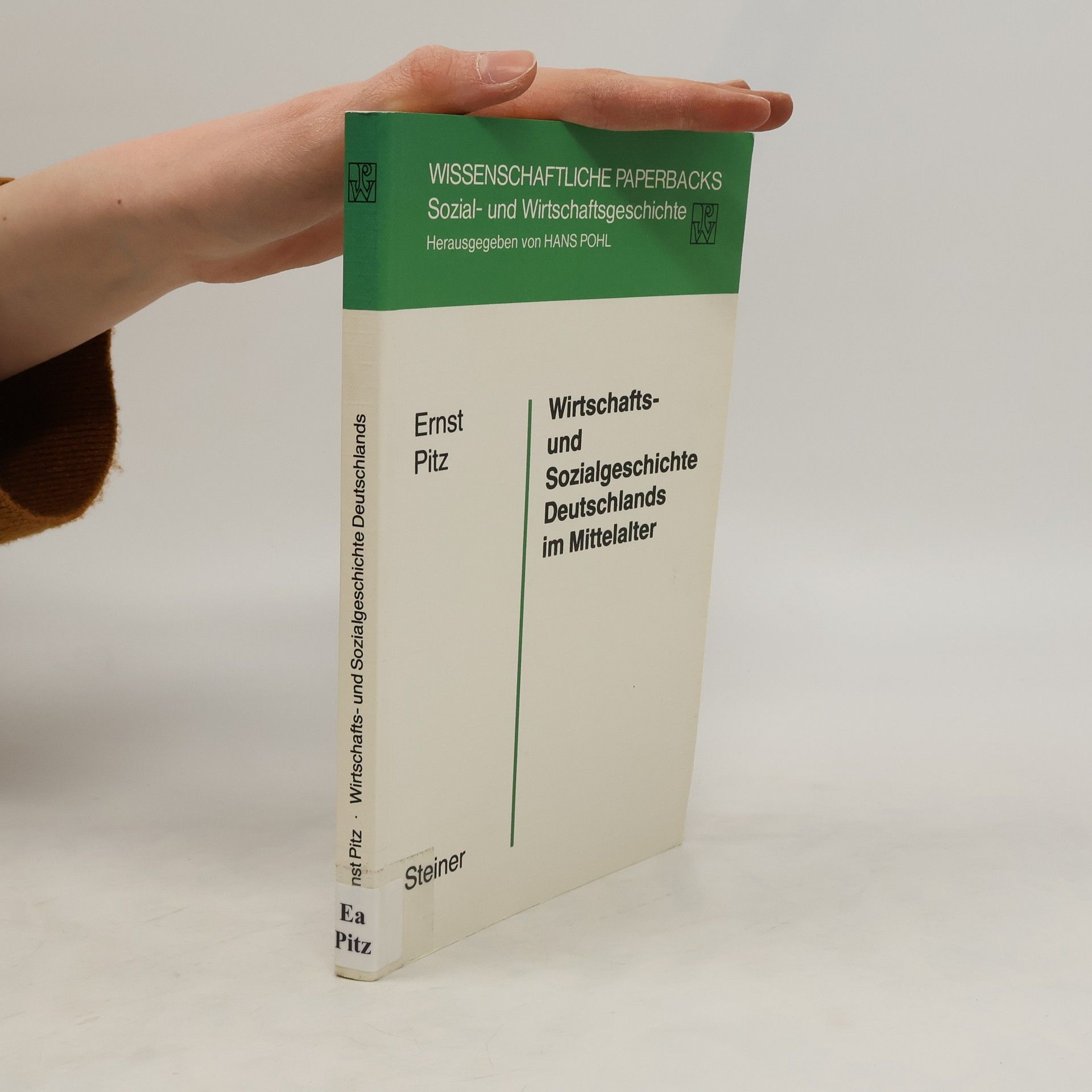
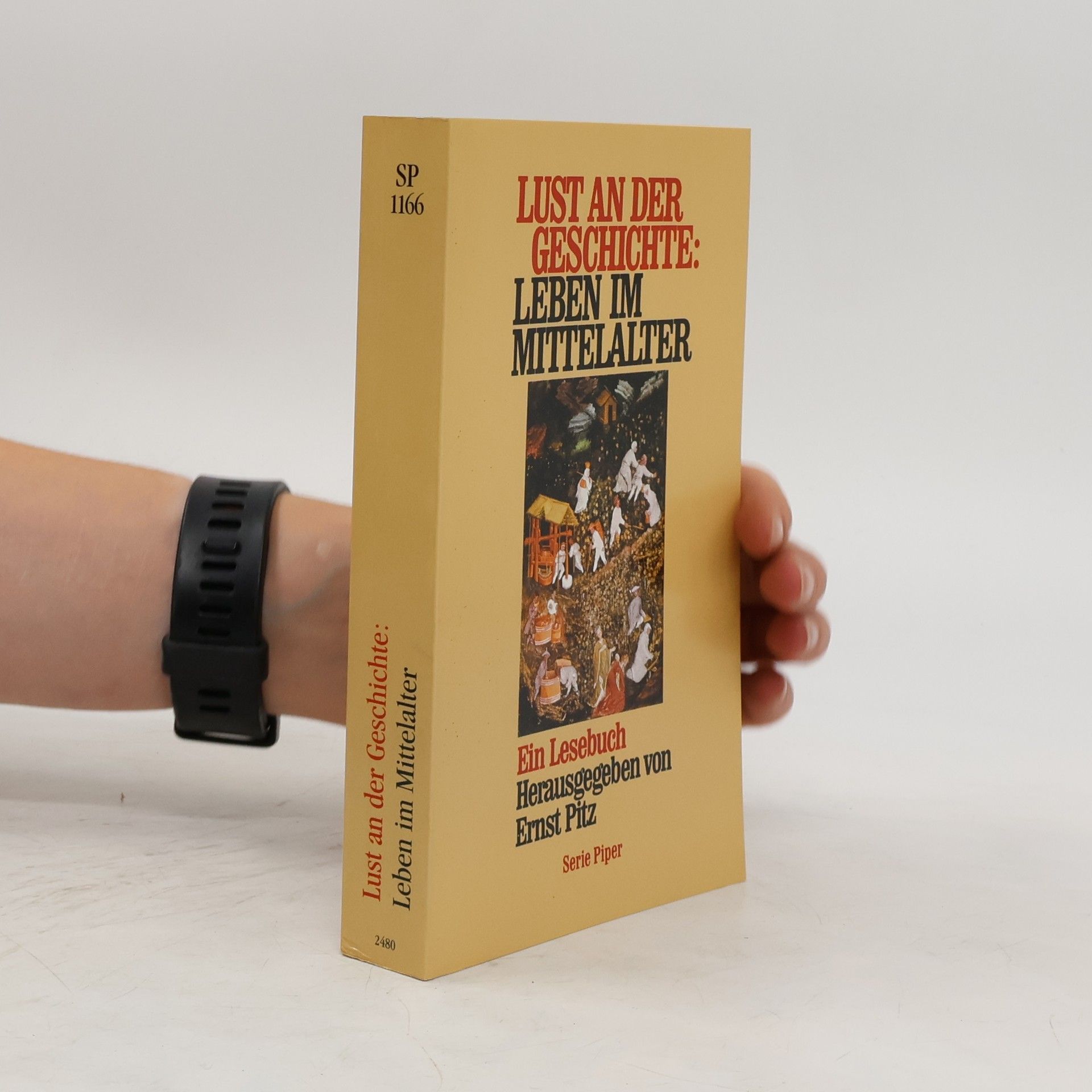
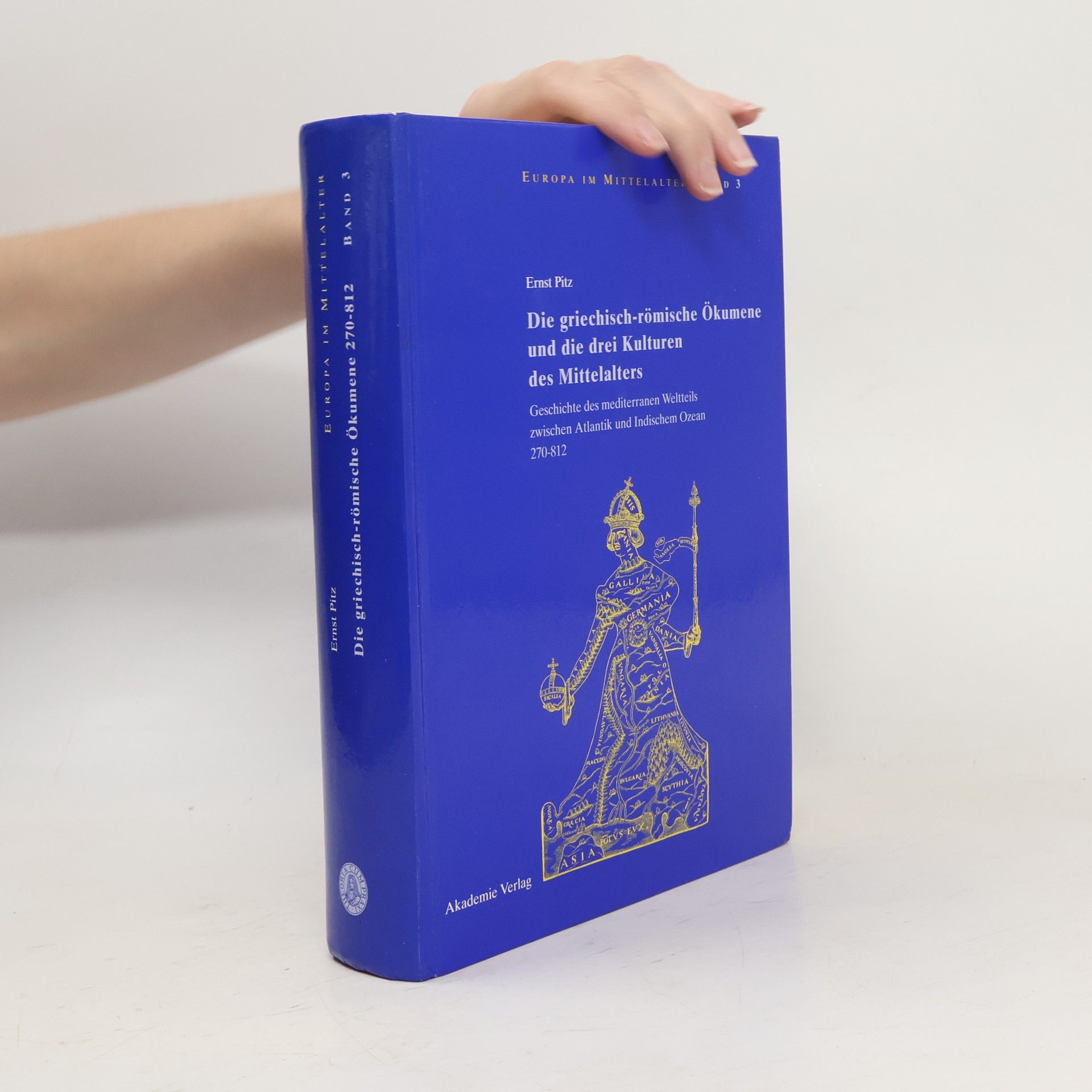
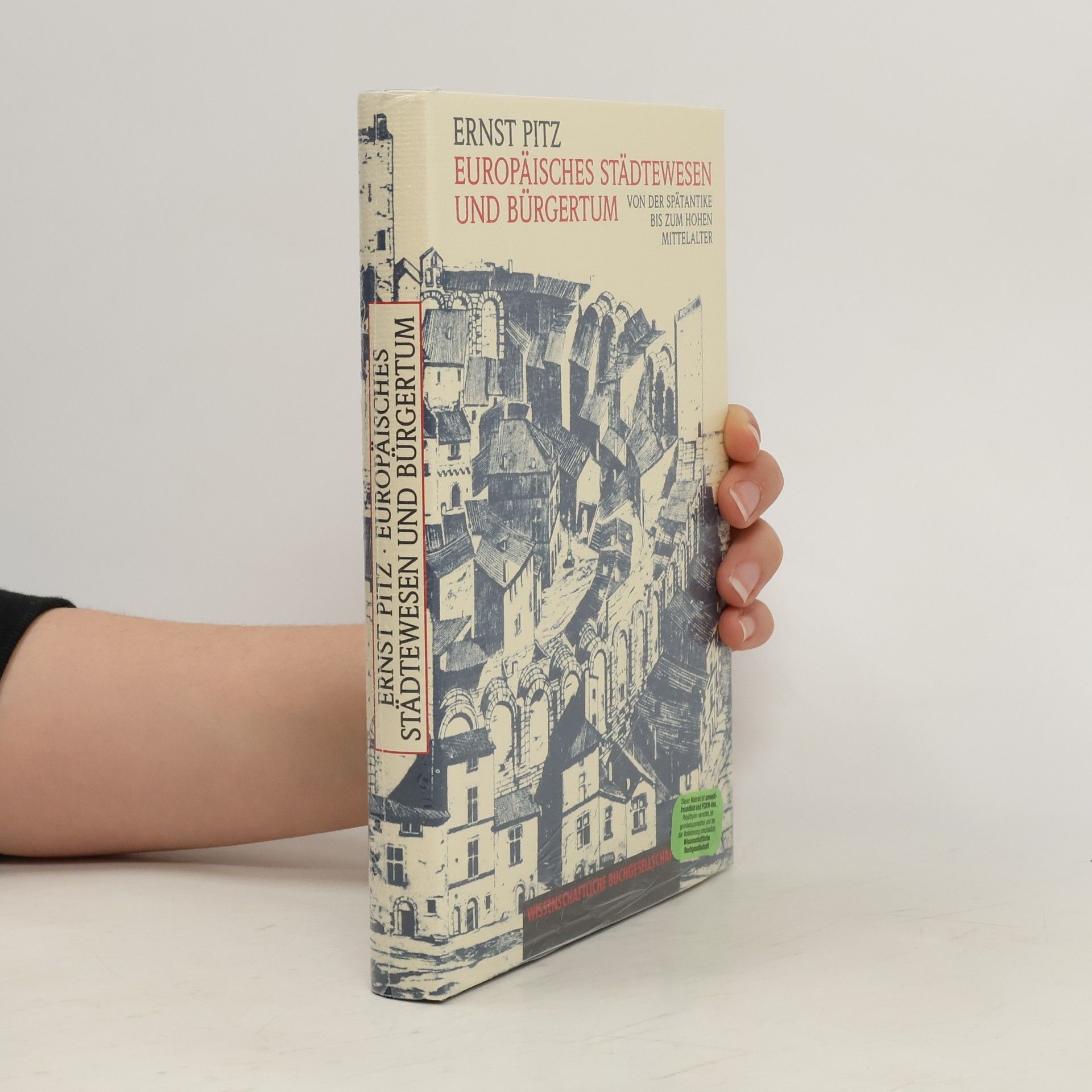

4. Geschichte; Stadtgeschichte; Spätantike; Frühmittelalter; Mittelalter; Hochmittelalter
Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters
- 571 Seiten
- 20 Lesestunden
Das halbe Jahrtausend, dessen Geschichte in diesem Buch behandelt wird, zeigt bedeutende Verschiebungen der geographischen Grenzen des Welttheaters. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung einer Weltordnung, in der Orient und Okzident durch das persische und römische Großreich geprägt waren. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts zeichnete sich die bis heute gültige Gliederung Europas in westeuropäisches Abendland, griechisch-osteuropäische Mitte und die muslimische Welt ab. Der Inhalt gliedert sich in mehrere Abschnitte: I. Politische Grundgedanken des Altertums II. Innere Verhältnisse des Römischen Reiches III. Diokletian und Konstantin und die Entstehung des byzantinischen Staates IV. Die gefährdete Reichseinheit (337-395) V. Die zerbrochene Reichseinheit (395-511) VI. Die verlorene Reichseinheit (491-565) VII. Abendland und Byzanz: Die zweigeteilte Mittelmeerwelt (565-610) VIII. Byzantiner und Araber: Die Spaltung des Morgenlandes (610-689) IX. Die dreigeteilte Mittelmeerwelt (680-718) X. Erneuerung der Flügelmächte (714-795) XI. Das Ende des antiken Weltsystems (768-812). Ein Literaturverzeichnis und ein Nachwort über die Möglichkeit, vergleichend europäische Geschichte zu schreiben, runden das Werk ab. Der Autor, geboren 1928, habilitierte 1967 an der Universität Gießen und war von 1968 bis 1971 am Deutschen Historischen Institut in Rom tätig. Seit 1971 ist er Professor für mittelalterliche Geschichte an der Technischen U
Lust an der Geschichte: Leben im Mittelalter
- 442 Seiten
- 16 Lesestunden
Ein dichtes Bild aus der Zeit von 364 bis 1387 vom städtischen, ländlichen und höfischen Leben, von der Organisation der Gesellschaft, sowie von Kirche und Kloster
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands im Mittelalter
- 182 Seiten
- 7 Lesestunden