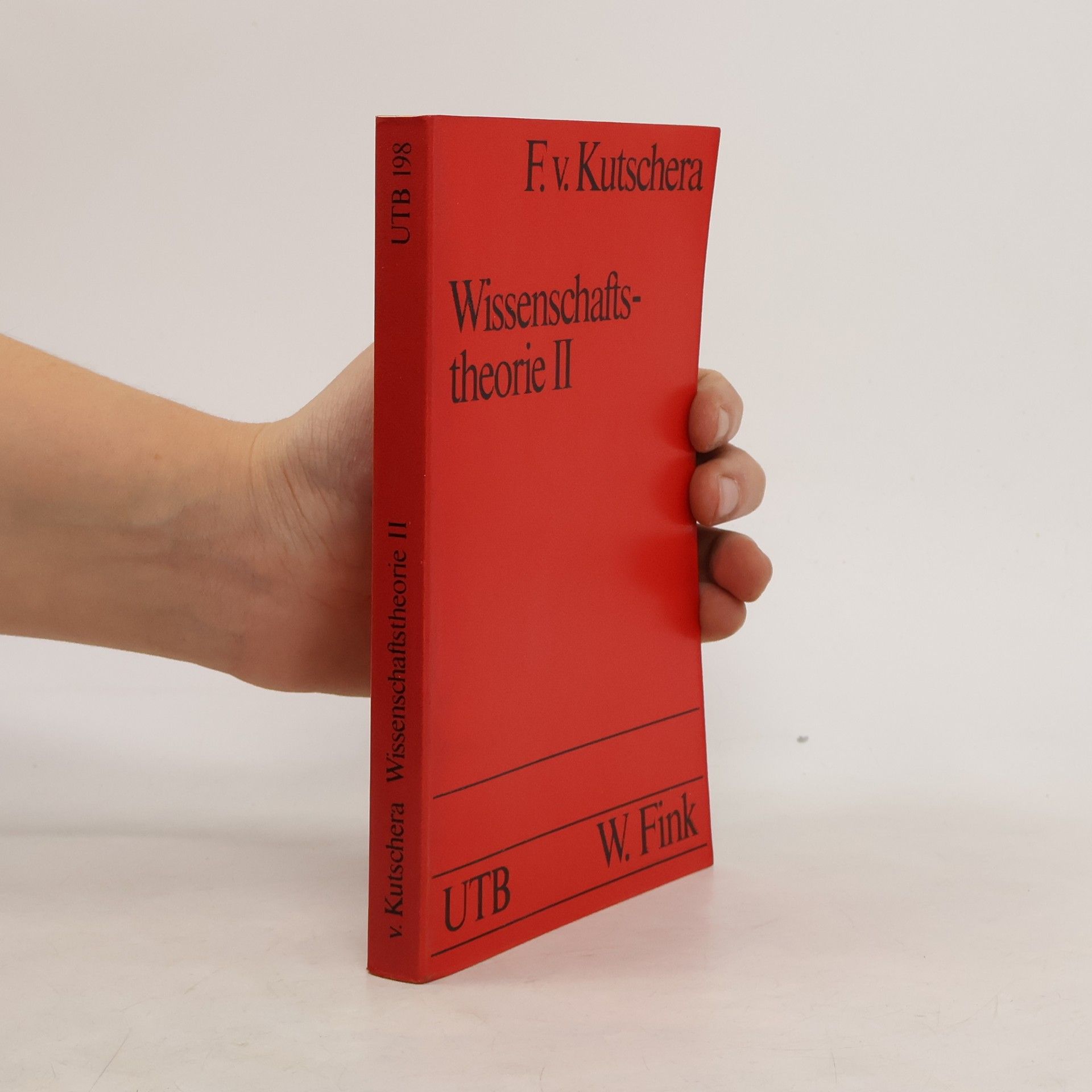Das Buch enthält fünf unveröffentlichte Aufsätze von Franz von Kutschera, die zentrale Gedanken seiner Philosophie darstellen. Es thematisiert die Rolle der Philosophie des Geistes und untersucht die Grenzen des intentionalen Denkens sowie überintentionale Erfahrungen, während es auch auf die Krise des christlichen Glaubens eingeht.
Franz von Kutschera Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
3. März 1932
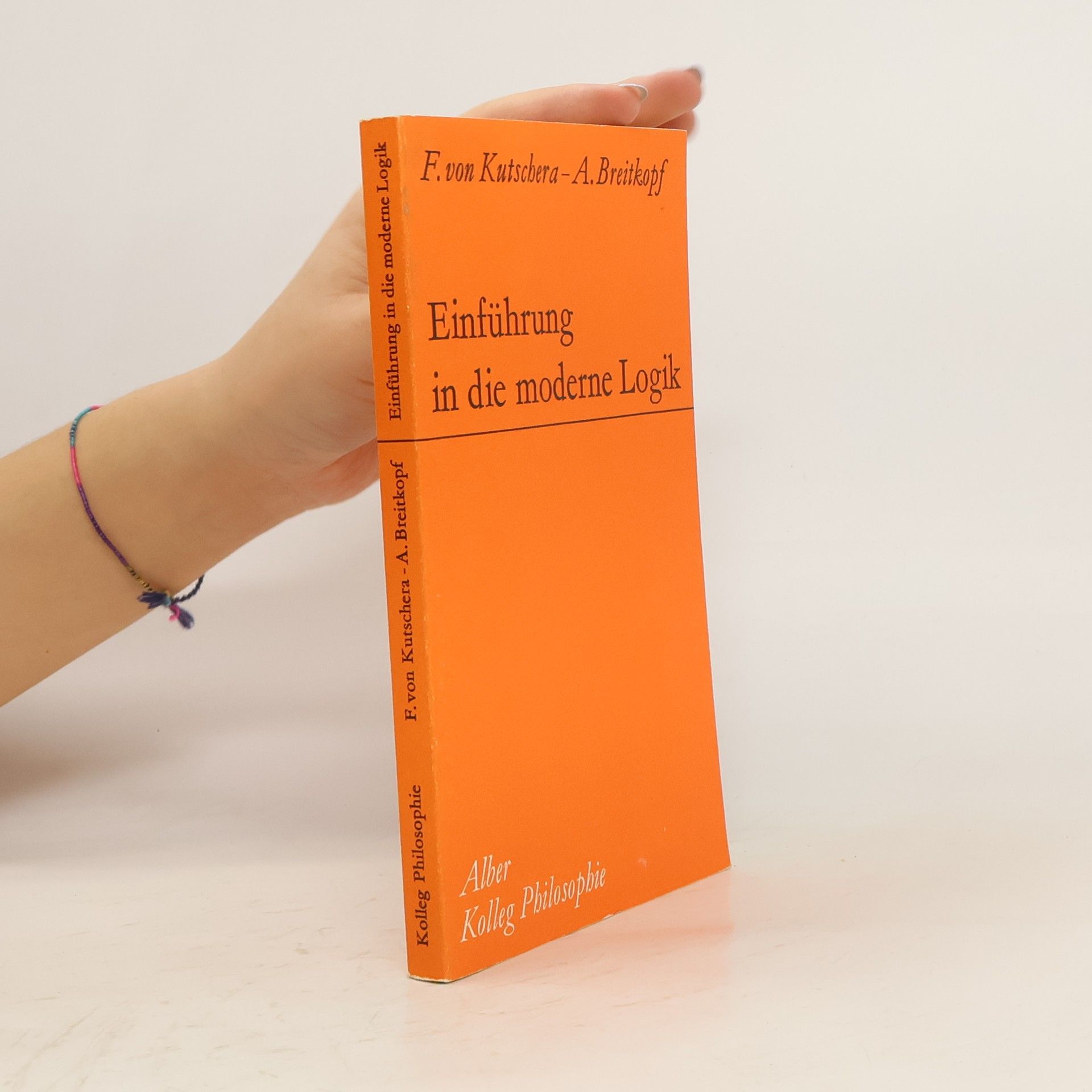

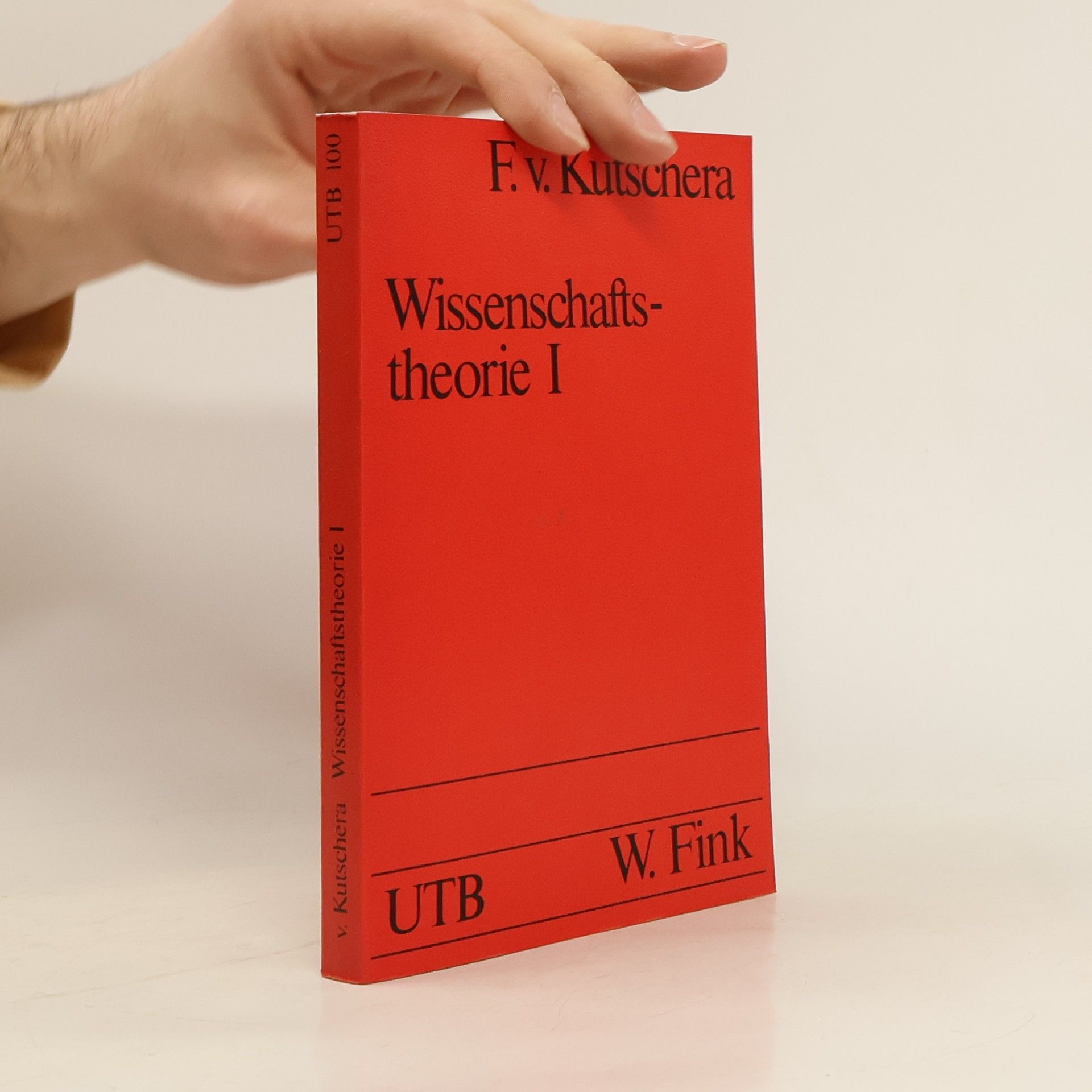



Gottlob Frege
Eine Einführung in sein Werk
Dieses Buch ist aus diesen Vorlesungen entstanden und wendet sichprimär an Studenten. Sein Ziel ist es, ihnen das Werk Freges zu erschließen und sie zum Studium der Originaltexte anzuregen.
German
UTB - 2: Wissenschaftstheorie
Grundzüge der allgemeinen Methodologie der empirischen Wissenschaften
German