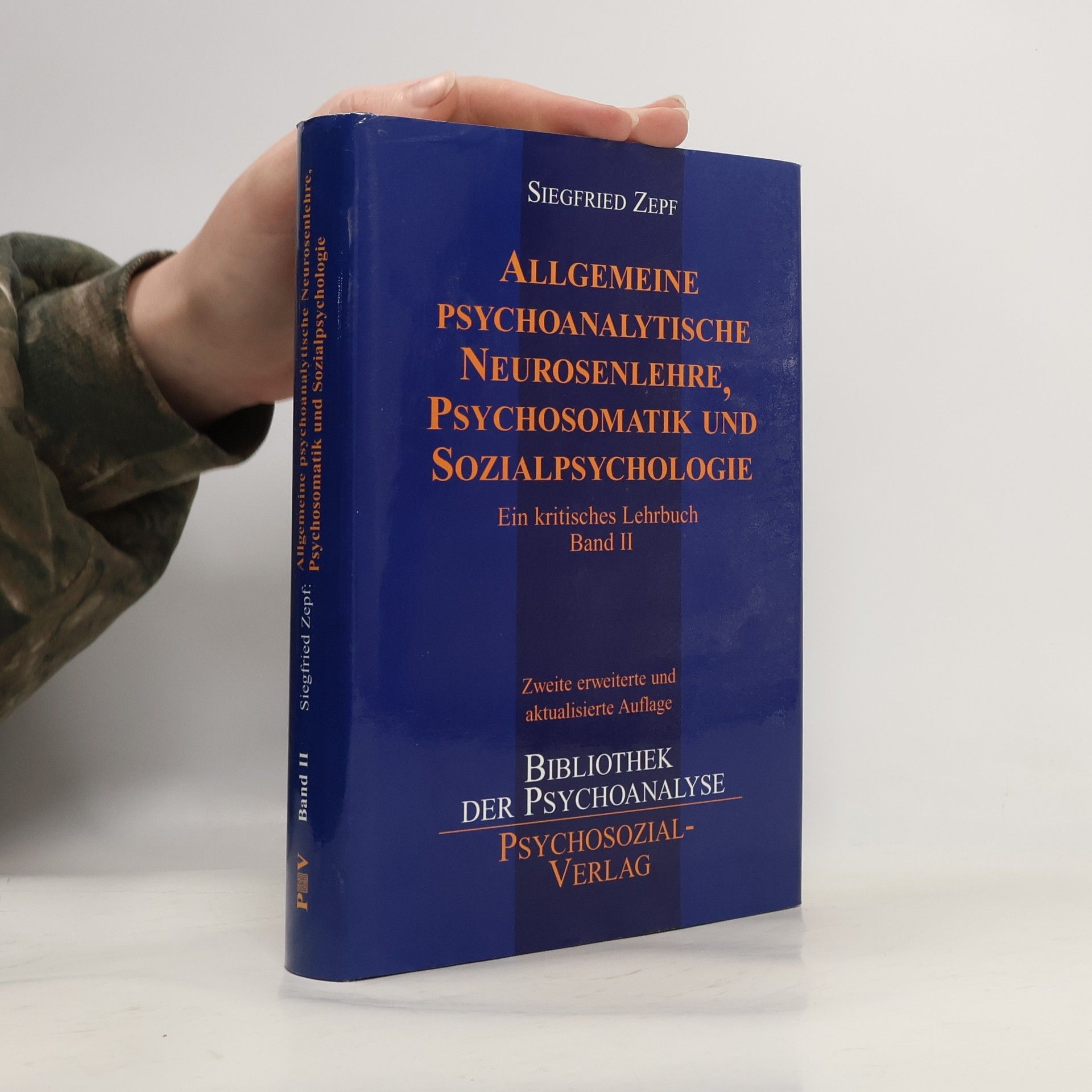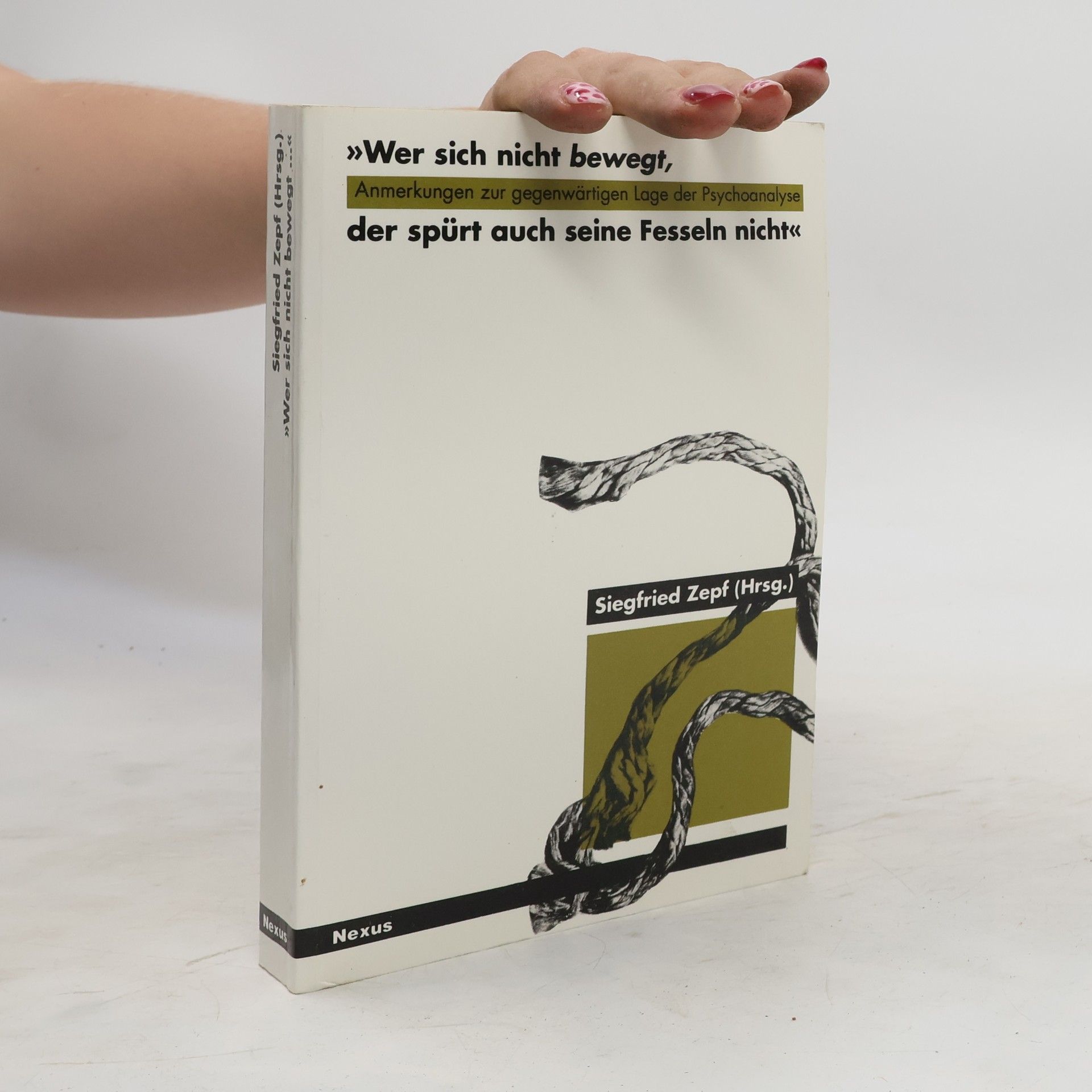Die notwendige Vermittlung zwischen Psychoanalyse und Historischem Materialismus, zwischen Subjekt und Gesellschaft, ist seit über 100 Jahren ausstehend. Freud stellte bereits fest, dass die Gesellschaft einen erheblichen Anteil an der Entstehung von Neurosen hat. Während die Psychoanalyse die inneren Prozesse des Lebens untersucht, kann nur die Gesellschaftstheorie erklären, warum bestimmte subjektive Strukturen entstehen. Siegfried Zepf und Dietmar Seel versuchen, diese Vermittlung zu leisten, indem sie Laplanches Überlegungen einbeziehen, die das Triebhafte als Teil des Unbewussten und dessen Beziehung zu gesellschaftlichen Widersprüchen beleuchten. Sie skizzieren auch eine Metatheorie, deren Notwendigkeit zwar anerkannt, deren Umsetzung jedoch bislang ausblieb. Die Autoren plädieren für die Wiederbelebung einer Debatte und erinnern daran, was im psychoanalytischen Bewusstsein durch vermeintlich Neues verdrängt wurde. Sie streben an, die Totalität von Mensch und Gesellschaft dem Begriff näherzubringen, und wagen sich an die Entmystifizierung früherer und gescheiterter Versuche, die von Denkern wie Reich, Bernfeld, Fenichel und Fromm sowie Horkheimer, Marcuse, Lorenzer und Schneider unternommen wurden.
Siegfried Zepf Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
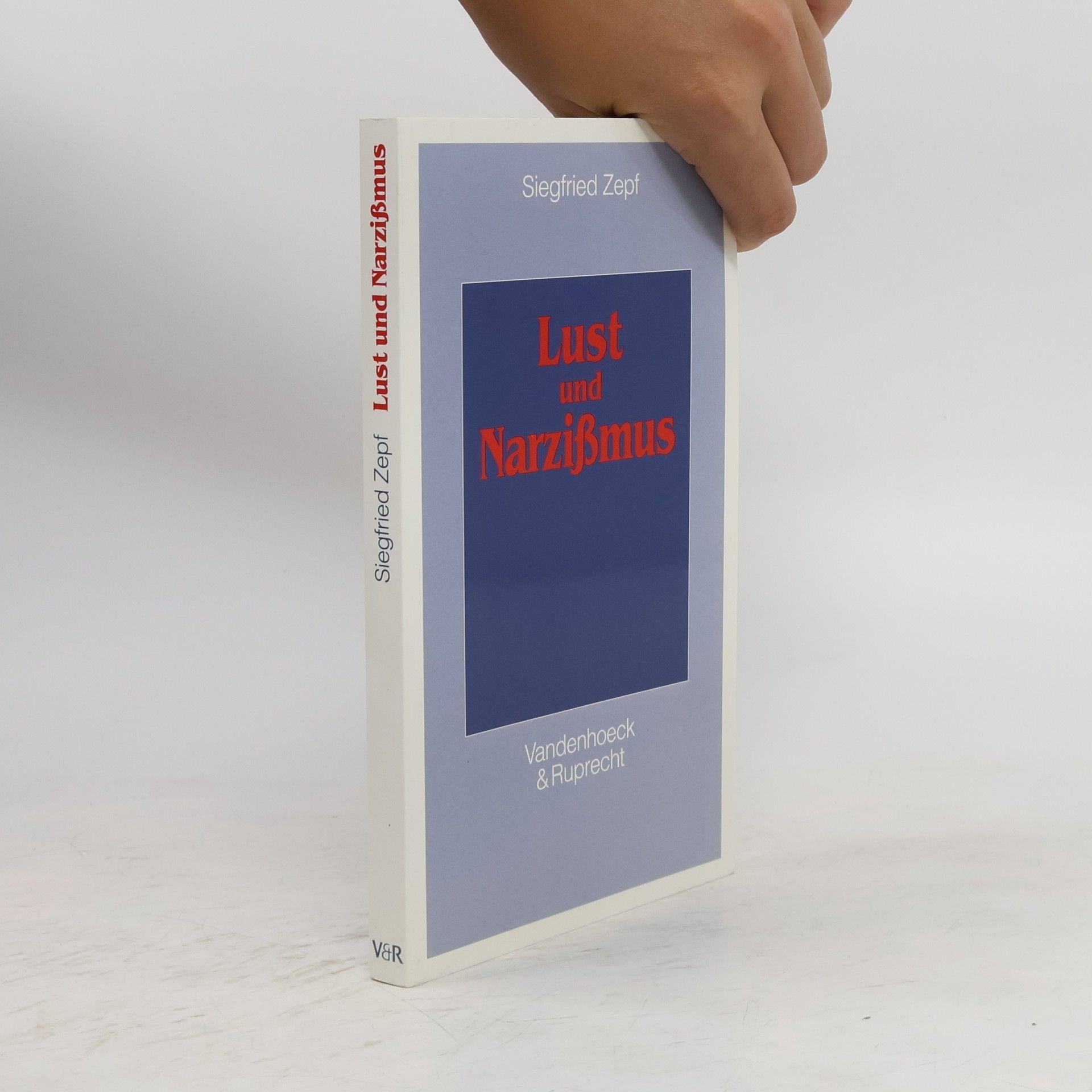




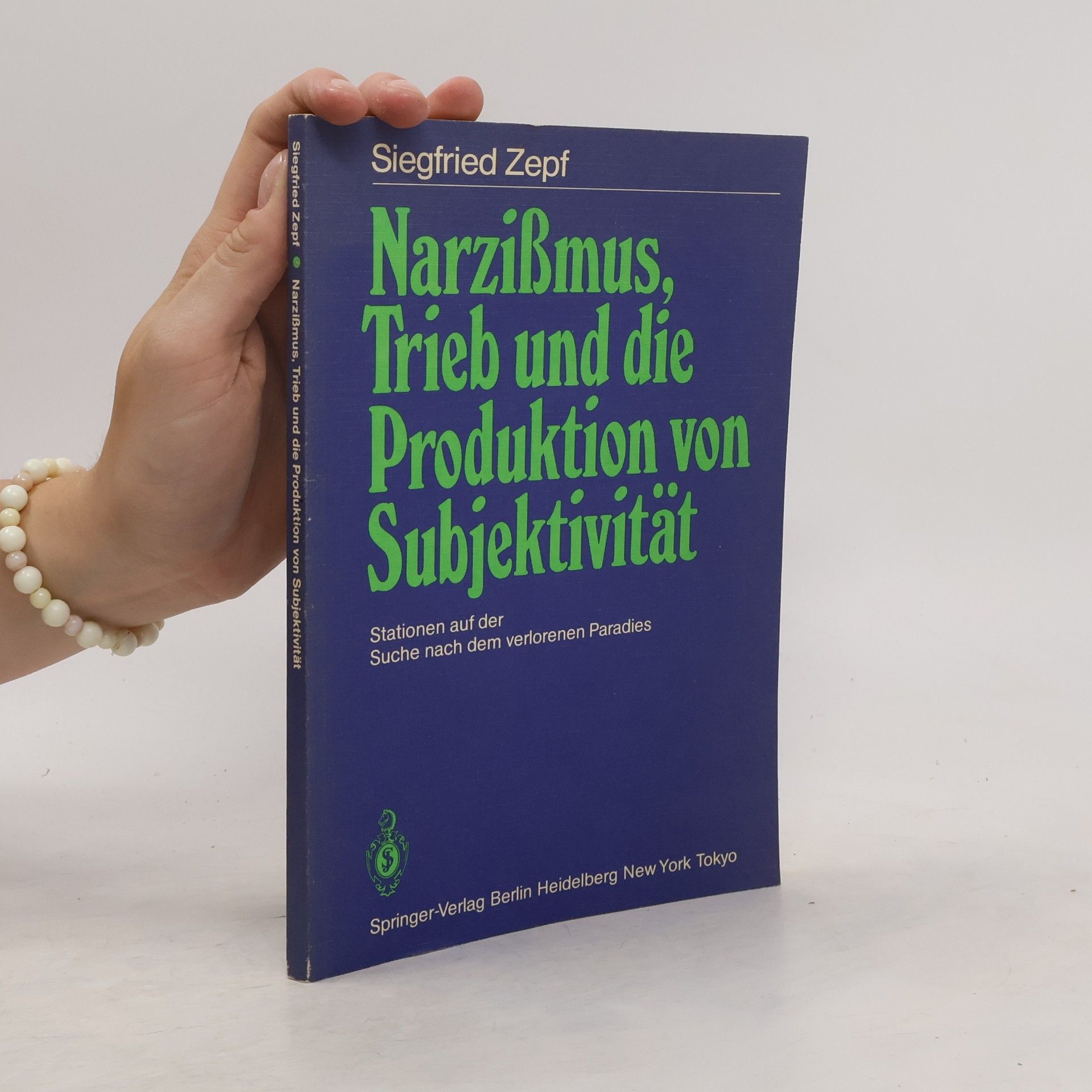
Die Analyse des Kleinen Hans war die erste Anwendung der Psychoanalyse in der Behandlung eines kleinen Kindes und auch die erste Psychoanalyse, die unter Supervision durchgeführt wurde. Sie gehört zu den fünf großen Vignetten, die Freud publizierte, und war von dessen Interesse getragen, bei Kindern sexuelle Wünsche nachzuweisen.Siegfried und Judith Zepf geben einen Überblick über die bislang ganz unterschiedlichen Deutungen von Hans' Behandlungsgeschichte, ehe sie ihre neue Interpretation vorstellen. Sie argumentieren, dass Freud die Einflüsse der Ödipuskomplexe der Eltern bei der Entwicklung von Hans und bei der Entstehung seiner Pferdephobie vernachlässigte. Unter Einbezug von Laplanches Konzept der rätselhaften Botschaften zeigen sie auf, wie sich über unbewusste Mechanismen elterlicher Projektionen, Verschiebungen und kindliche Identifizierungen das elterliche Unbewusste in die Psyche des Kindes eintragen kann.
Psychoanalyse und das gesellschaftlich Unbewusste
Eine Entmystifizierung psychoanalytischer Konzepte
Bibliothek der Psychoanalyse: Verstehen und Begreifen in der Psychoanalyse
Erkundungen zu Alfred Lorenzer
- 270 Seiten
- 10 Lesestunden
Seit den 1990er Jahren erfährt die Psychoanalyse aufgrund der Professionalisierung der Psychotherapie eine immer stärker werdende Reduzierung auf die Psychotechnik. Die praktisch-theoretische Dialektik, aus der die Psychoanalyse Freuds entstand, wird dadurch aufs Empfindlichste gestört. Alfred Lorenzer gehörte zu den Analytikern der Nachkriegszeit, die nach Lösungen für das von Habermas postulierte »szientistische Selbstmissverständnis« der Psychoanalyse suchten. Geprägt von der Diskussion über den wissenschaftlichen Stellenwert der Psychoanalyse versuchte er die Rolle der Psychoanalyse in der Gesellschaft und ihr Verhältnis zur Soziologie neu zu überdenken. Die Beiträger widmen sich den verschiedenen Aspekten von Lorenzers Ansätzen, entwickeln diese weiter und zeigen neue zeitgemäße Perspektiven auf. Mit Beiträgen von Helmut Dahmer, Sebastian Hartmann, Hans-Dieter König, Alfred Lorenzer, Bernd Nissen, Gunzelin Schmid Noerr, Thierry Simonelli, Hans-Volker Werthmann und Siegfried Zepf
Die Ödipusmythen werden heute von Freuds Konzept des Ödipuskomplexes überschattet. Diese Art der Auslegung drehen die Autoren um. Sie nutzen die Mythen zur Interpretation des Ödipuskomplexes und zeigen dessen verborgene Inhalte auf. So wird der Komplex als ein Drama entlarvt, das nicht von den Kindern inszeniert wird: Nicht Sohn oder Tochter beginnen, mit Vater oder Mutter zu rivalisieren, es sind vielmehr die Eltern, die mit ihrem Kind um den Partner in Konkurrenz treten. Die Autoren zeigen Aspekte der Mythen auf, die Freud in seiner Konzeption des Ödipuskomplexes nicht berücksichtigt hat, wie die Entstehung des ödipalen Dramas und seine transgenerationale Weitergabe. Sie kommen zu der überzeugenden Einsicht, dass Ödipus keinen Ödipuskomplex hatte.
Bibliothek der Psychoanalyse - 2: Allgemeine psychoanalytische Neurosenlehre, Psychosomatik und Sozialpsychologie
Ein kritisches Lehrbuch - Zweite erweiterte und aktualisierte Auflage
- 409 Seiten
- 15 Lesestunden
Das Lehrbuch präsentiert zentrale psychoanalytische Konzepte und beleuchtet das aufklärerische Potenzial der Psychoanalyse. Es wird eine kritische Diskussion verschiedener wissenschaftstheoretischer Ansätze zur Verortung der Psychoanalyse geführt, einschließlich ihrer theoretischen Begriffe wie Trieb, Libido, Ödipus-Komplex und Unbewusstes. Zudem werden therapeutische Konzepte wie Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand behandelt. Das Buch zielt darauf ab, den Leser über den aktuellen Stand der Psychoanalyse zu informieren und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen „common sense“ zu fördern. Es zeigt auf, welche emanzipatorischen Möglichkeiten der Psychoanalyse auch heute noch bestehen, wenn man sie von ihren vielfältigen Ummäntelungen befreit. Gerichtet an Leser, die durch ihre Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse Fragen aufwerfen, regt das Buch zum Nachdenken über bestehende Konzepte an. Auch die behandlungstechnischen Konzepte wie Abstinenz, Neutralität und Deutung sowie die psychoanalytische Psychosomatik und analytische Sozialpsychologie werden kritisch beleuchtet. Prof. Dr. Siegfried Zepf ist Direktor des Instituts für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin an der Universität Homburg/Saar.
Lust und Narzißmus
- 149 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Narzissmus-Theoretiker führen schwerwiegende narzisstische Störungen auf das Fehlen verlässlicher Zuwendung in der frühen Kindheit zurück, wobei die kalte, ungeliebte Mutter als zentrales Gespenst fungiert. Narzissten werden zum Gegenpol eines idealisierten Menschenbildes, unfähig zu Liebe und Bindung. Sie sind nicht nur Opfer von Gefühlskälte, sondern senden diese auch aus und rufen sie hervor. Selbst Psychotherapeuten gestehen, dass sie Narzissten nicht mögen, was die Einschätzung der Therapierbarkeit narzisstischer Störungen beeinflusst. In einer als zunehmend narzisstisch wahrgenommenen Gesellschaft stellt Siegfried Zepf das gängige Narzissmus-Konzept in Frage. Er zeigt, dass die „Frühstörung“ nicht aus biologischen Defiziten resultiert, sondern aus einer Sehnsucht nach etwas verlorenem Realem. Es ist nicht das biologisch Verheißene, das die nachhaltige Störung verursacht, sondern der erlebte Verlust, der im späteren Leben bewältigt werden muss. Zepfs Perspektive auf diese menschliche Erfahrung eröffnet ein neues Verständnis für die frühen Kindheitserlebnisse, die Objektbeziehungen reifer Menschen und die Rolle der Psychoanalyse im Kontext dauerhafter Charakterstrukturen.
Narzißmus, Trieb und die Produktion von Subjektivität
Stationen auf der Suche nach dem verlorenen Paradies
- 138 Seiten
- 5 Lesestunden
Aus unserer Erorterung wurde gewilS deutlich, daIS es bisher nichtgelungen ist, das NarzilSmuskonzept innerhalb der psychoanalytischen Metapsychologie wi derspruchsfrei und so mit der psychoanalytischen Trieblehre in Verbindung zu setzen, daIS die von Freud behauptete relative Eigenstandigkeit beider Bereiche gewahrt blieb. Auch in den neueren Versuchen wurde das Problem nicht gelost. Kohut verabsolutiert die Eigenstandigkeit der narzilStischen Entwicklung und lost sie von der Triebentwicklung ab (s. dazu auch Rothschild 1981). 1m Urteil von Kohut (1979, S. 294) hat sein Konzept denn auch keinen spezifischen Bezug mehr auf die etablierten Theorien der Psychoanalyse und suspendiert den von Freud geschaffenen theoretischen Rahmen. Kemberg wiederum diskutiert den NarzilSmus im wesentlichen unter dem triebtheoretischen Aspekt der Abwehr und reduziert den NarzilSmus unter Vemachlassigung seiner relativen Eigen standigkeit auf eine Erscheinungsform der Triebpsychologie und -pathologie. Die dazu kontrare Position wurde schon von Grunberger und - wenn auch in anderen Worten - von Ferenczi und Balint vertreten.