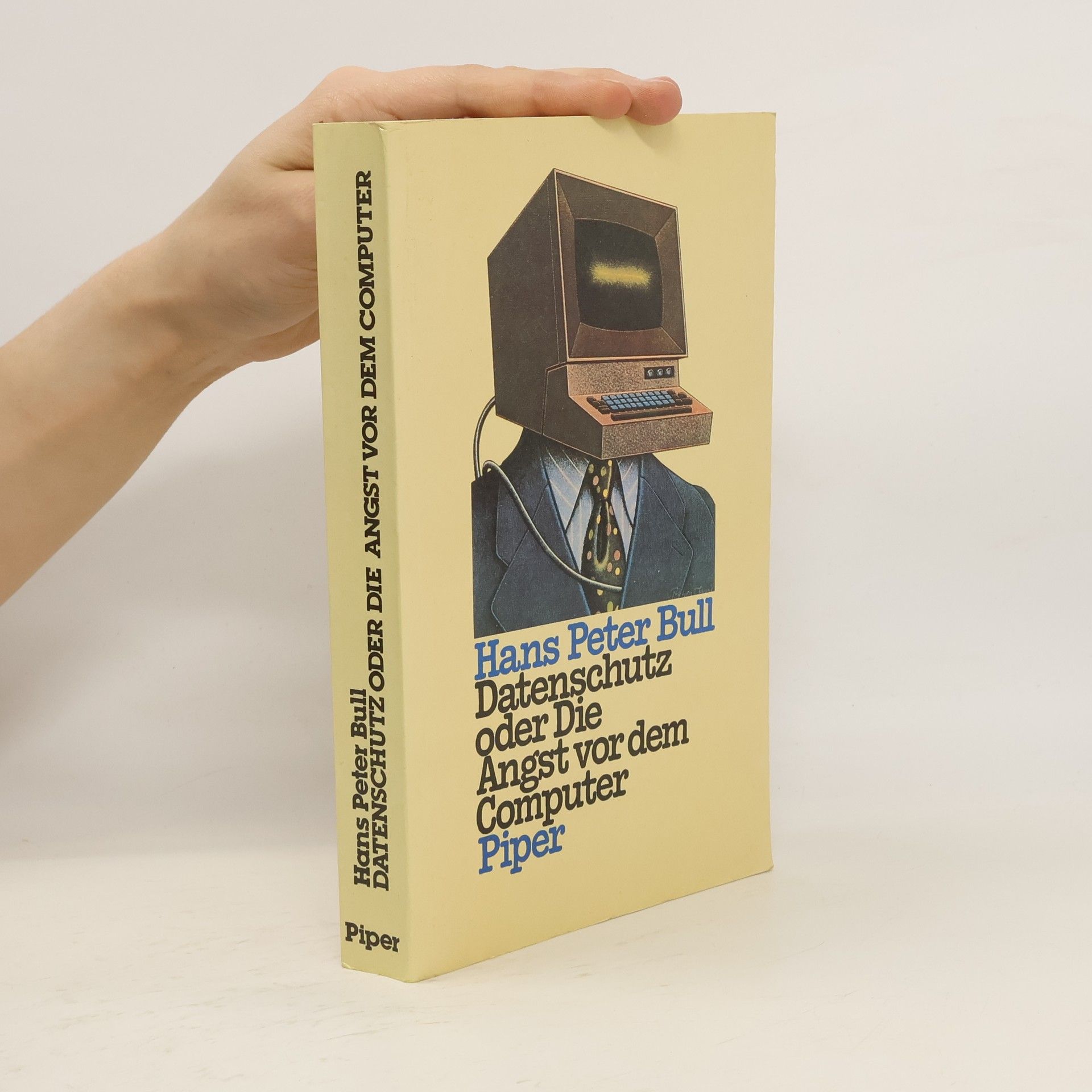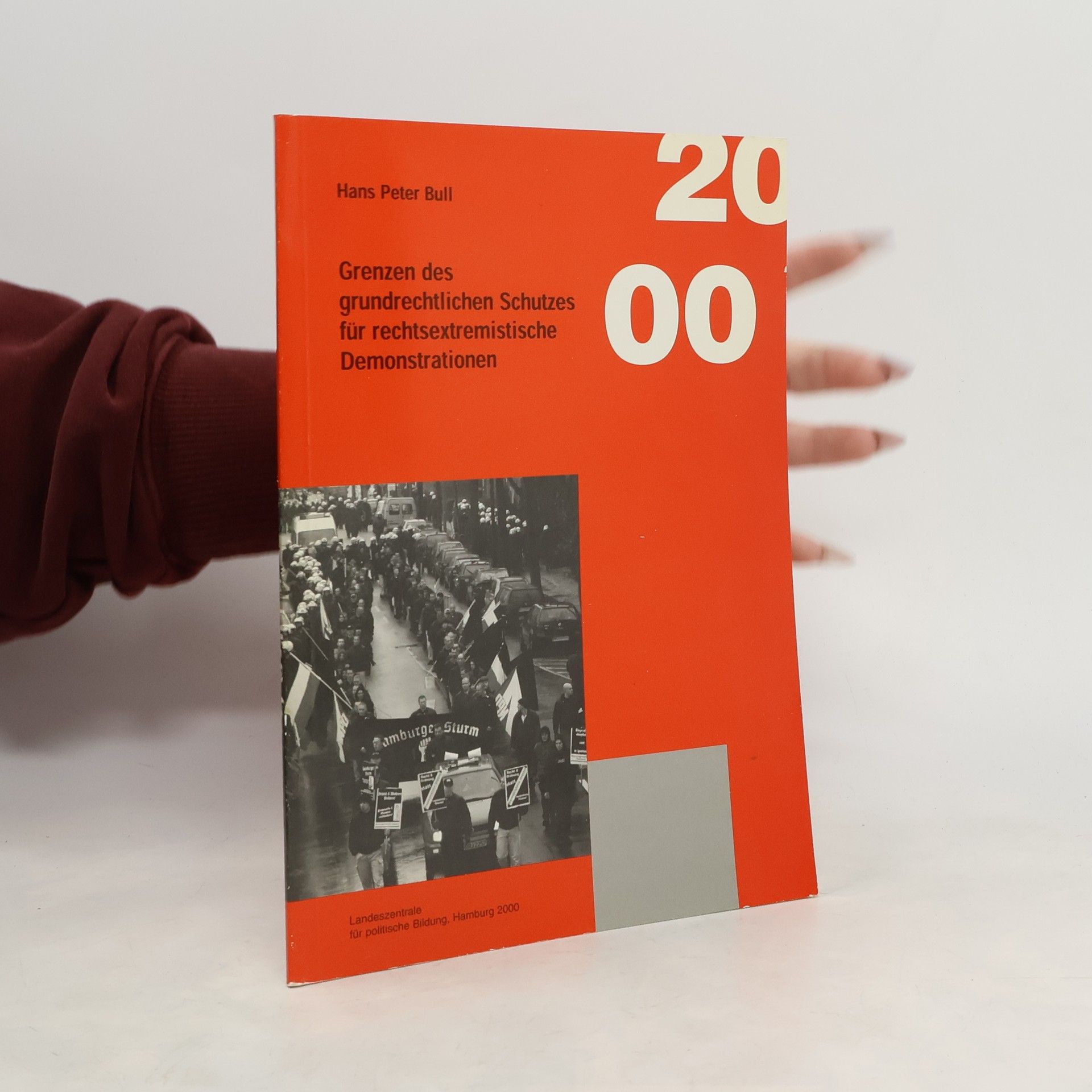Demokratie und Rechtsstaat in der Diskussion
Über Verfassungsprinzipien und ihre Realisierung. Beiträge aus zwei Jahrzehnten
Über die Bedeutung des Demokratieprinzips und der Rechtsstaatlichkeit muss immer wieder diskutiert werden. Dazu hat Hans Peter Bull als Wissenschaftler und Praktiker zahlreiche Beiträge geleistet, von denen hier eine Auswahl in systematischer Ordnung wieder zugänglich gemacht wird. Im ersten Teil werden die ideellen Grundlagen der Demokratie und ihre konkrete Ausgestaltung - z. B. das Wahlsystem - behandelt, während im zweiten Teil materielle Staatsziele wie Daseinsvorsorge, öffentliche Sicherheit und die Entwicklung von Grundrechten wie Eigentum, Persönlichkeitsrecht und Kommunikationsfreiheiten im Mittelpunkt stehen. Es geht dabei auch um die Folgen von Automatisierung und Digitalisierung und entsprechende Reformvorschläge. Eine aktuelle Abhandlung befasst sich mit der Funktion von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung für die Demokratie und dem tatsächlichen Zustand der Medien.