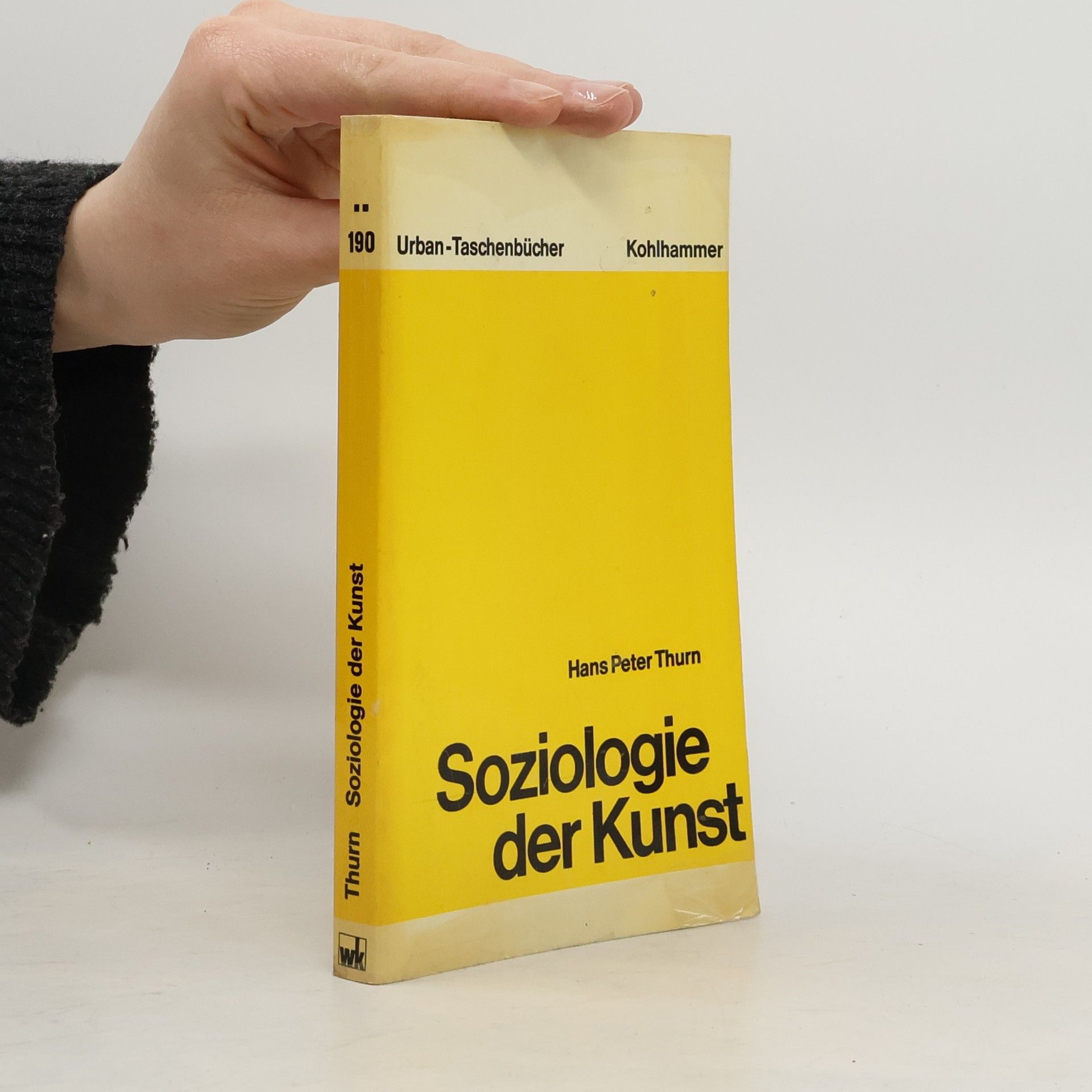Unter den zahlreichen Büchern, die Farbe naturwissenschaftlich, technisch, philosophisch, kunsthistorisch oder psychologisch thematisieren, fehlt bisher eines, das sich den sozialen Aspekten des Farbgebrauchs widmet. Diese Lücke schließt dieses Buch. Der Umgang mit Farbe hat sich im 20. Jahrhundert weitgehend demokratisiert, denn jeder kann über beliebig viele Farben verfügen. Farben wirken im Zusammenleben von Menschen vielfältig mit, wir alle erscheinen einander farblich und so nehmen wir uns wahr. Zwischenmenschliche Beziehungen waren und sind stets durch die verwendeten Rot, Grün, Blau, Gelb imprägniert und beeinflusst. Dieser Band setzt auf der Alltagsebene ein, um zu zeigen, warum wir heute über keinen festen Farbkanon mehr verfügen. Durch Bezugnahme auf konkrete Beispiele und Situationen stellt das Buch diese Sachverhalte plastisch dar. Rituale, Mode, Kleidungsvorlieben, Wohngestaltungen, Gebrauchsgegenstände, Bücher, Blumenschmuck, Autos und dergleichen mehr werden dabei farblich ausgelotet.
Hans Peter Thurn Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
5. August 1943
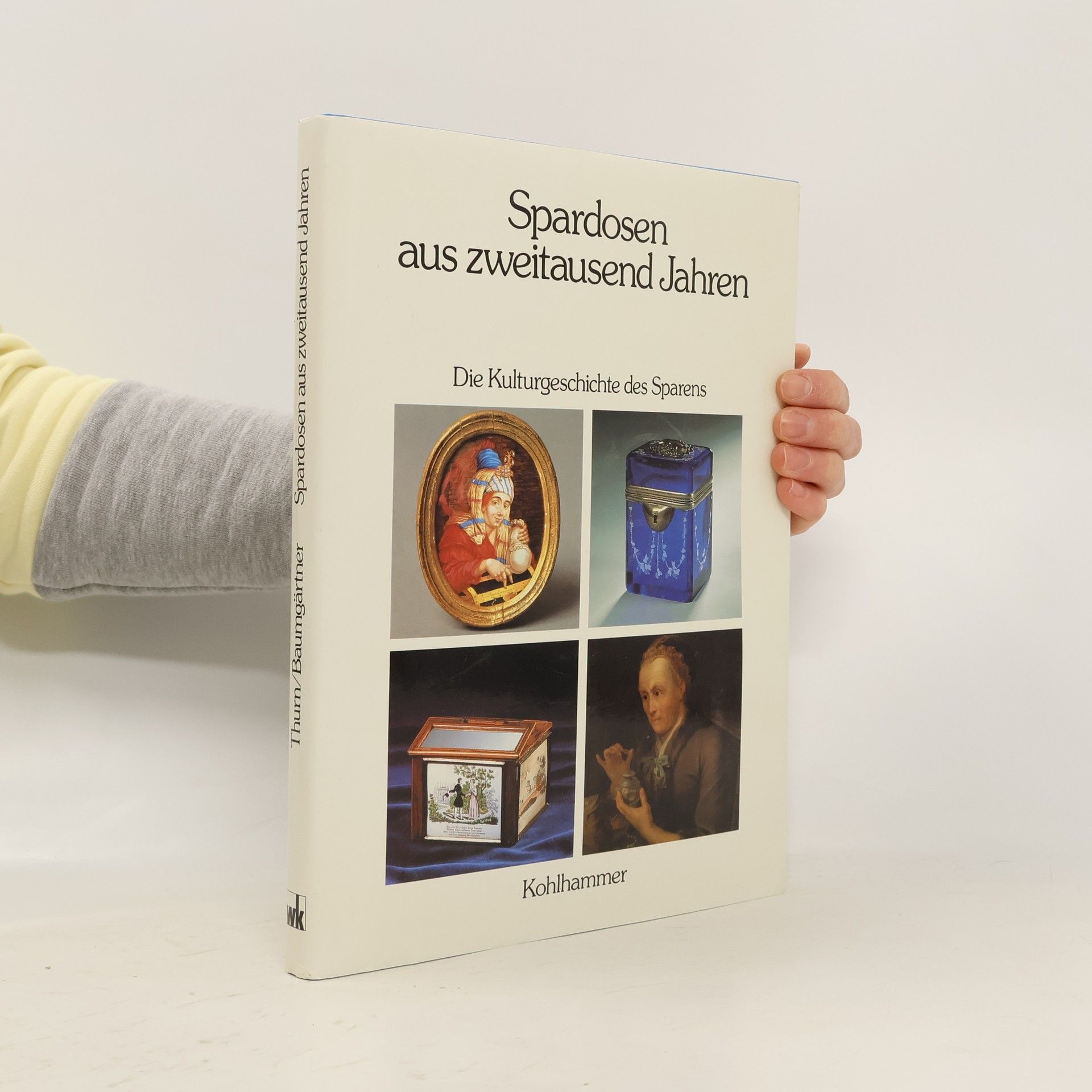

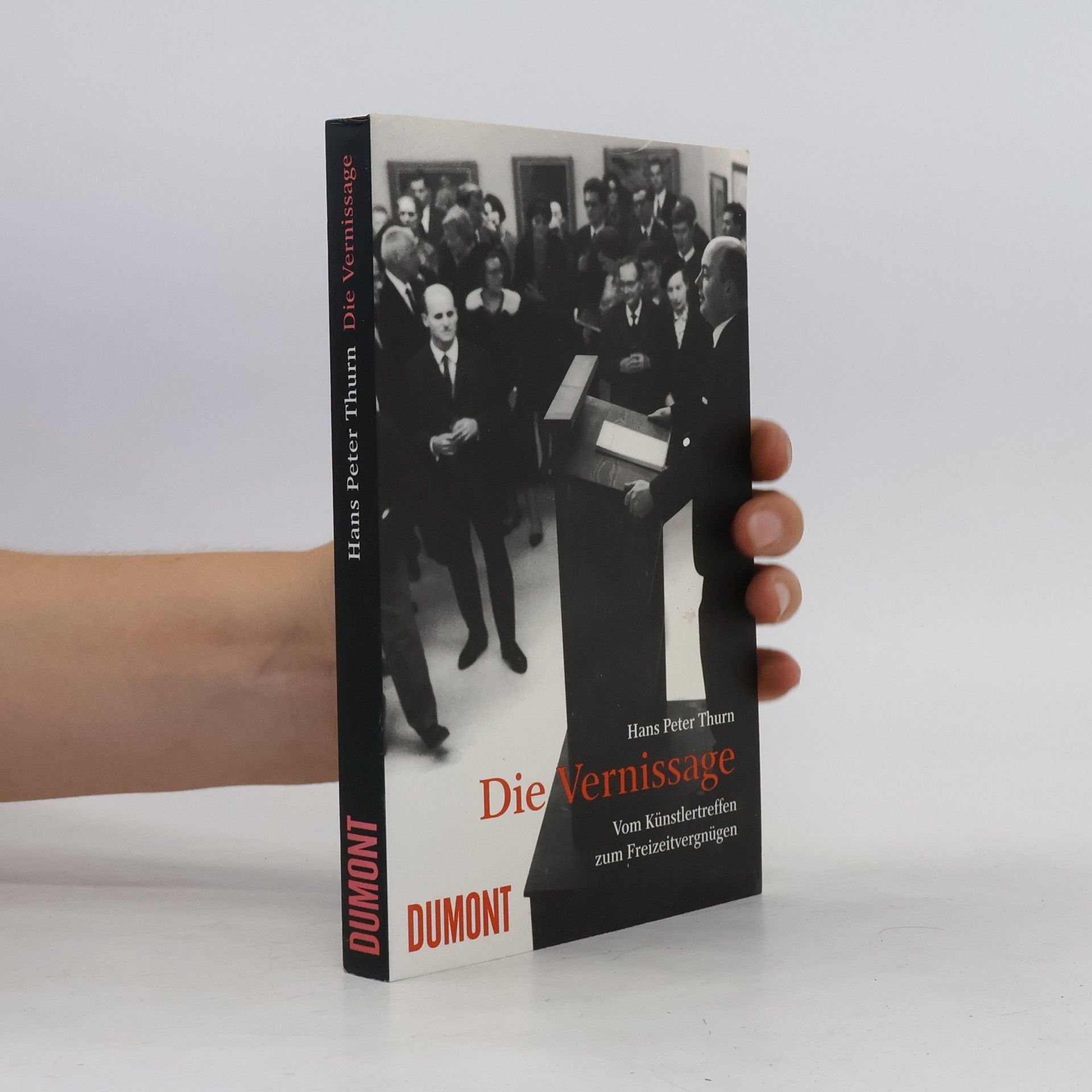
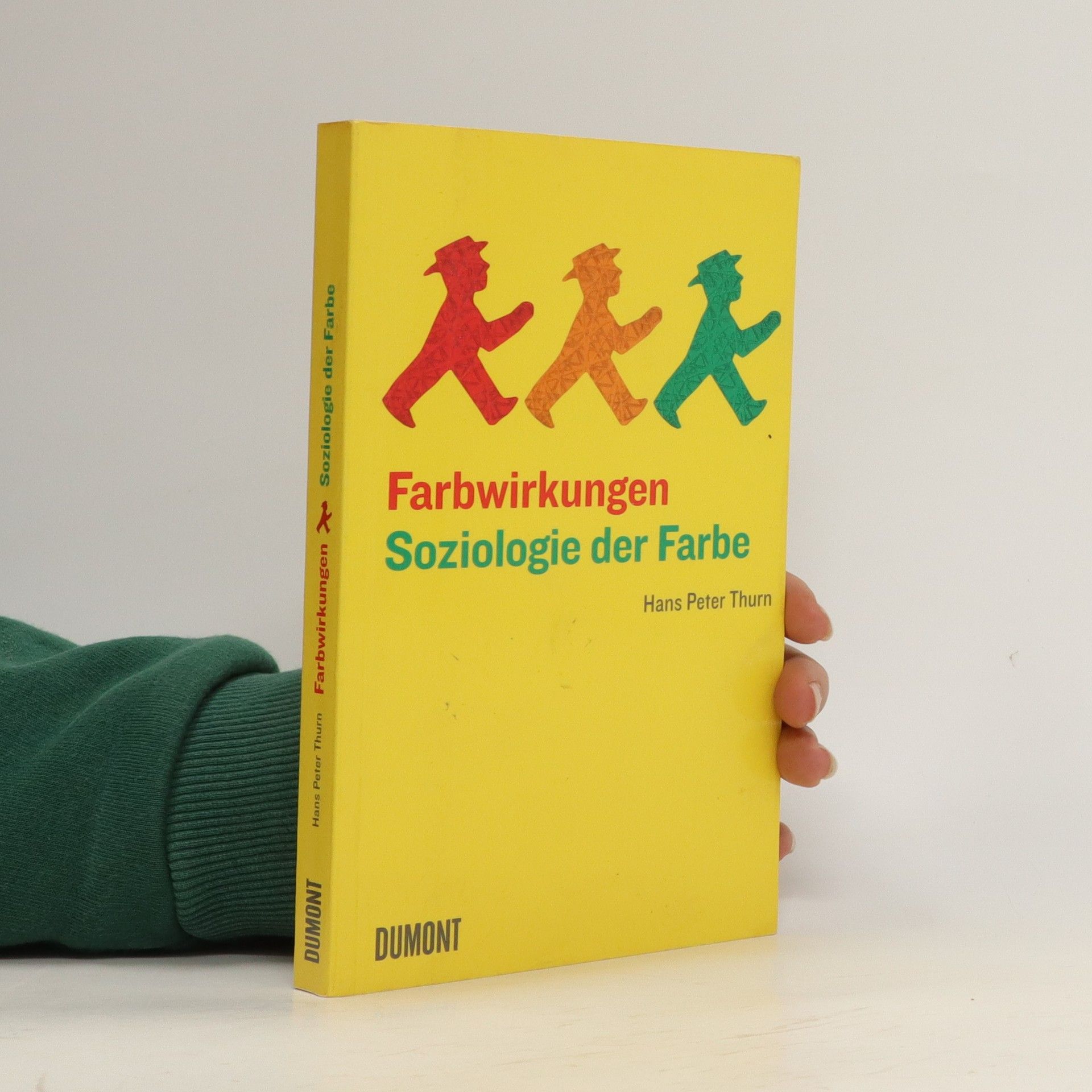


Seit wann gibt es Vernissagen? Wie hat sich diese Institution entwickelt? Und was passiert heute auf einer Vernissage? Warum wird dort gegessen und getrunken? Worüber spricht man? Was trägt man? Wer trifft sich auf einer Vernissage? Diese und viele andere Fragen beantwortet Hans Peter Thurn auf seinem unterhaltsamen Weg durch die Kulturgeschichte der Vernissage. Gespickt mit prominenten Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart, beleuchtet dieses Buch die Rolle der Vernissage in unserer Kultur und Gesellschaft und offenbart dabei so manches Überaschende und Interessante über dieses 'Ritual' des modernen Kunstbetriebs. Kleine Kulturgeschichte der Vernissage
Kulturbegründer und Weltzerstörer
Der Mensch im Zwiespalt seiner Möglichkeiten
Soziologie der Kunst
- 147 Seiten
- 6 Lesestunden