Freiheitsbegriff und Emanzipationsprozess
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden


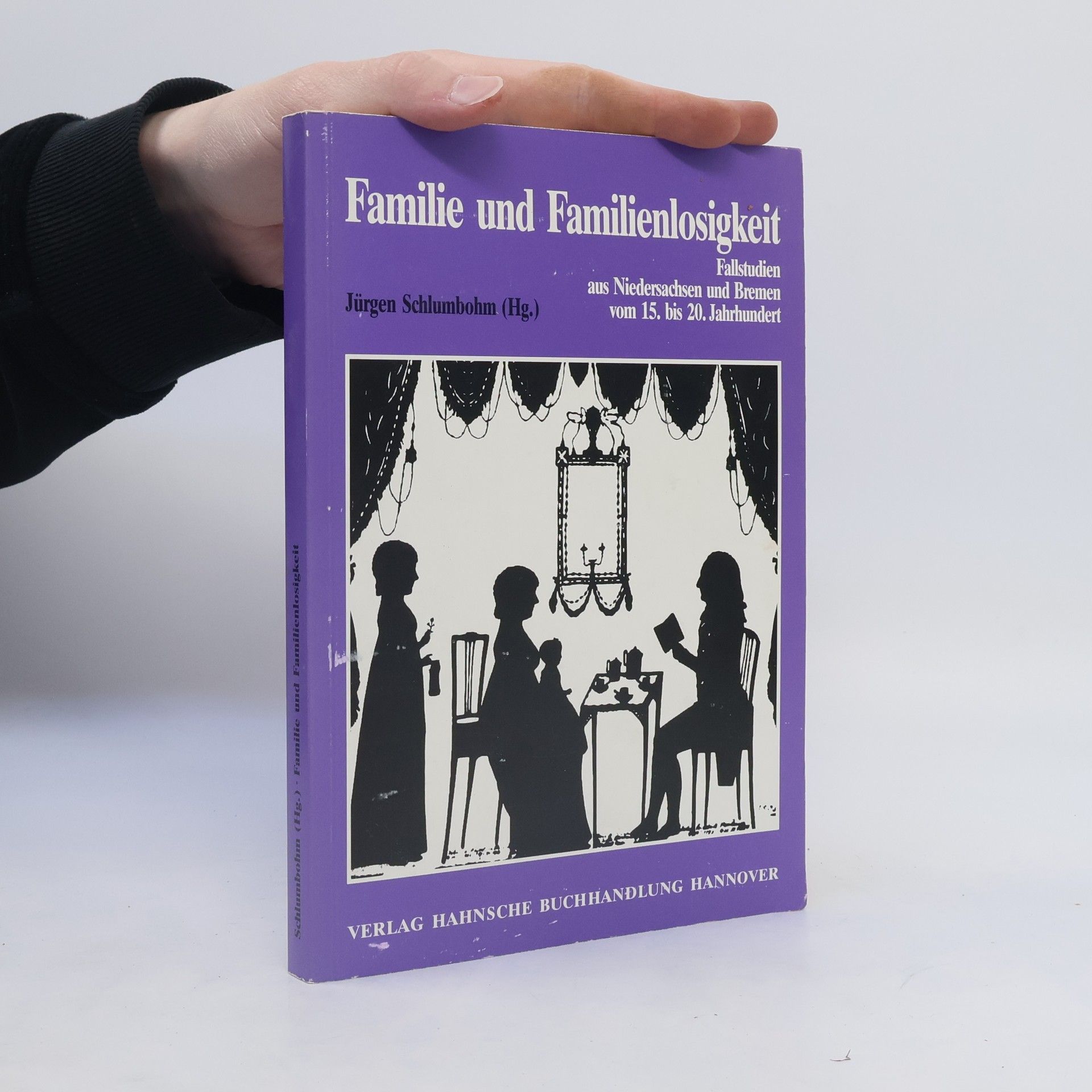
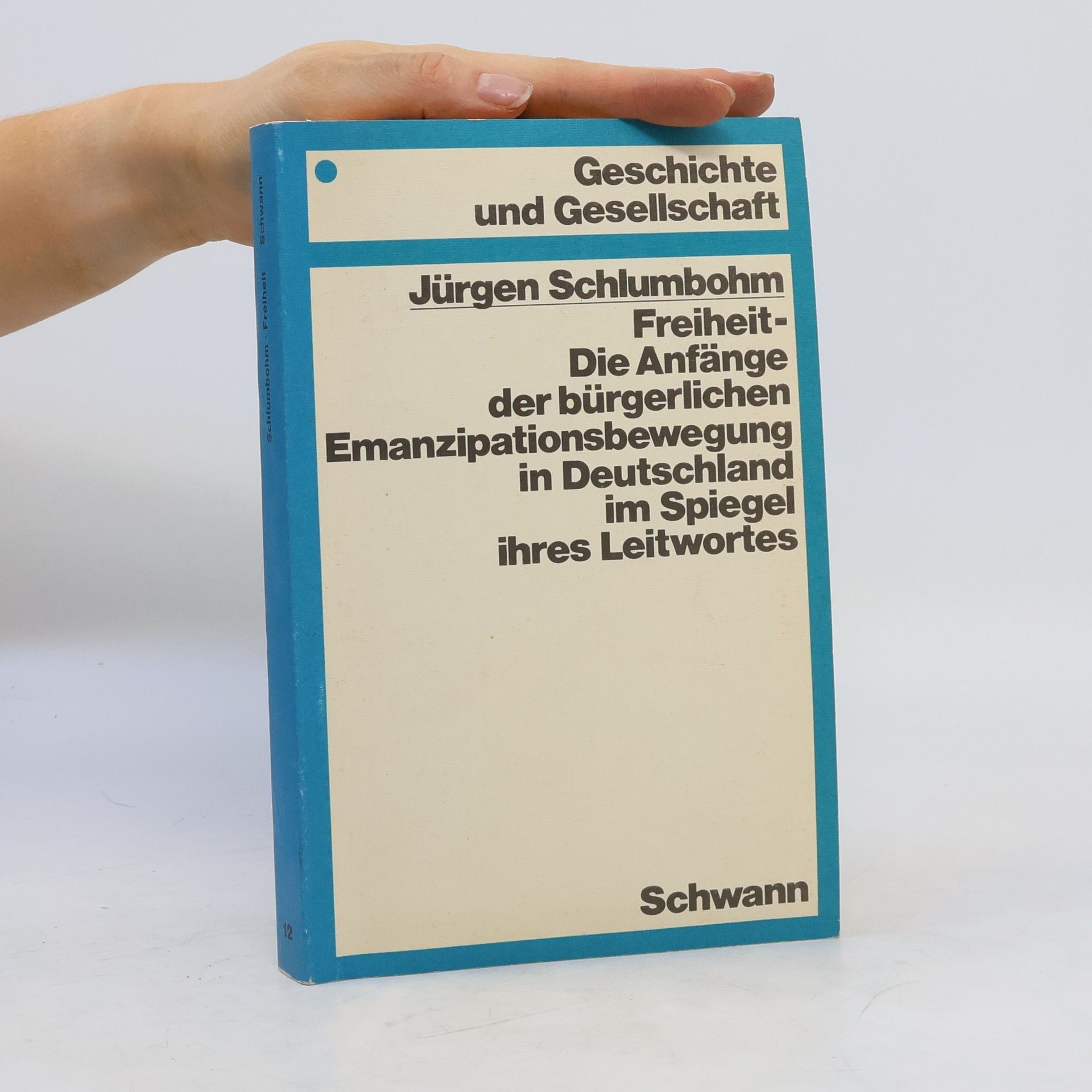

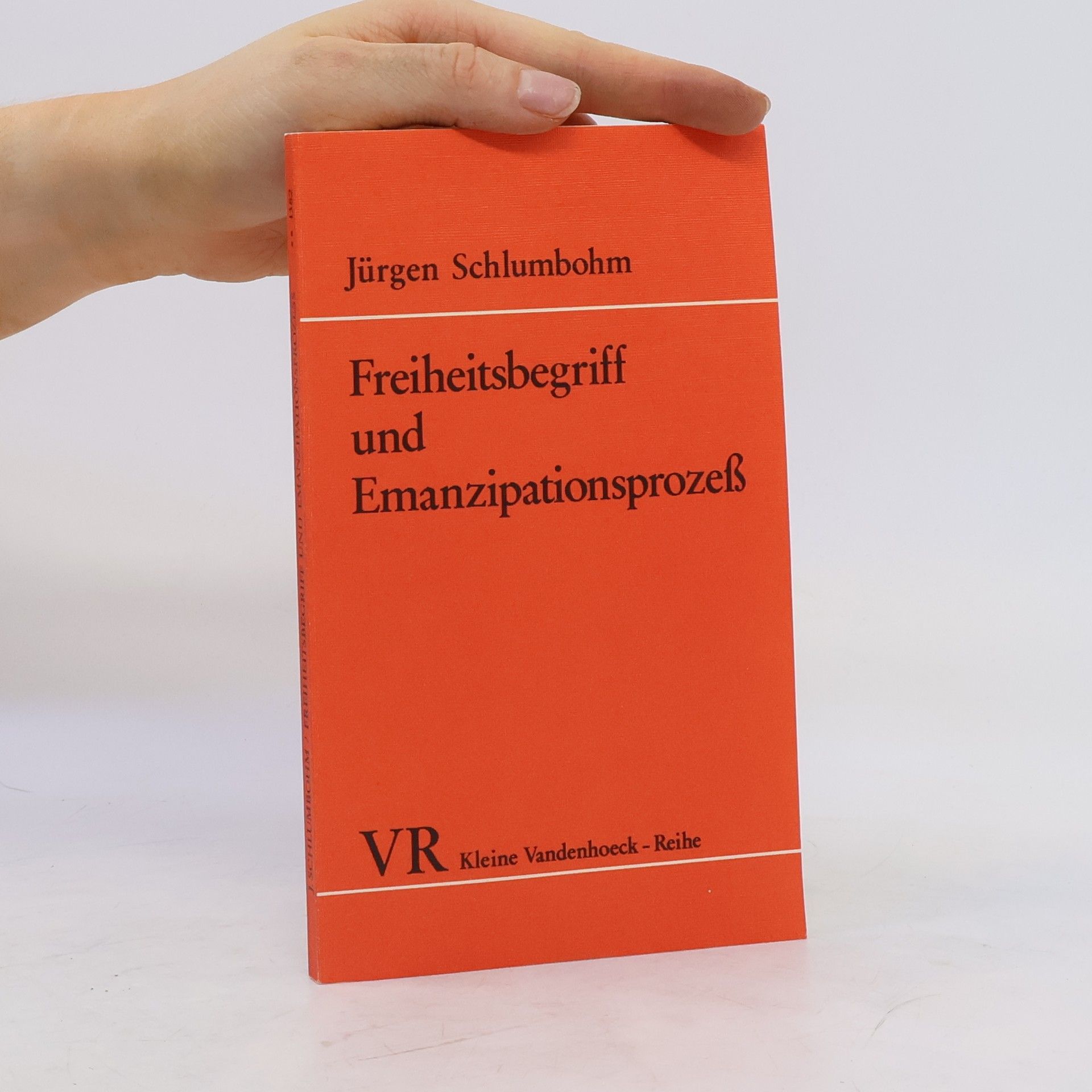
Frauen in bedrängter Lage begegnen Medizinern, die sich für den Fortschritt der Geburtshilfe stark machen. In eine ferne Welt führt dies Buch den Leser. Es erzählt von der Magd Dorothea Elisabeth Junk, die ihre uneheliche Tochter dem Kindsvater vor die Tür legte, von Juliane Nolte, deren »blühende Schönheit« den »Verführer« anzog, und von der »Mohrin« Viktoria Laurenti, mit der sich ein fürstlicher Hof schmückte, bevor sie von einem adeligen Offizier ein Kind erwartete. Wie hunderte andere Frauen, die unverheiratet schwanger waren, gingen sie in das neue Göttinger Universitäts-Entbindungshospital. Dort begegneten sie dem ärztlichen Direktor, der sich für den Fortschritt der Geburtshilfe stark machte, und seinen zahlreichen Studenten, die im Verlangen nach praktischer Ausbildung mit den Hebammenschülerinnen konkurrierten. Wenn die Lebensgeschichten dieser Frauen und Männer durch ihre Fremdartigkeit den Leser in den Bann ziehen, so blitzen zugleich Konfliktlinien auf, die von bestürzender Aktualität scheinen. Es geht um Liebe und Gewalt zwischen den Geschlechtern, um soziale Hilfe und Abweisung Fremder, um natürliche Geburt und operative Entbindung, um medizinische Technik und Wünsche von Patientinnen.
This book presents an analysis of this 'industrialization before industrialization'.