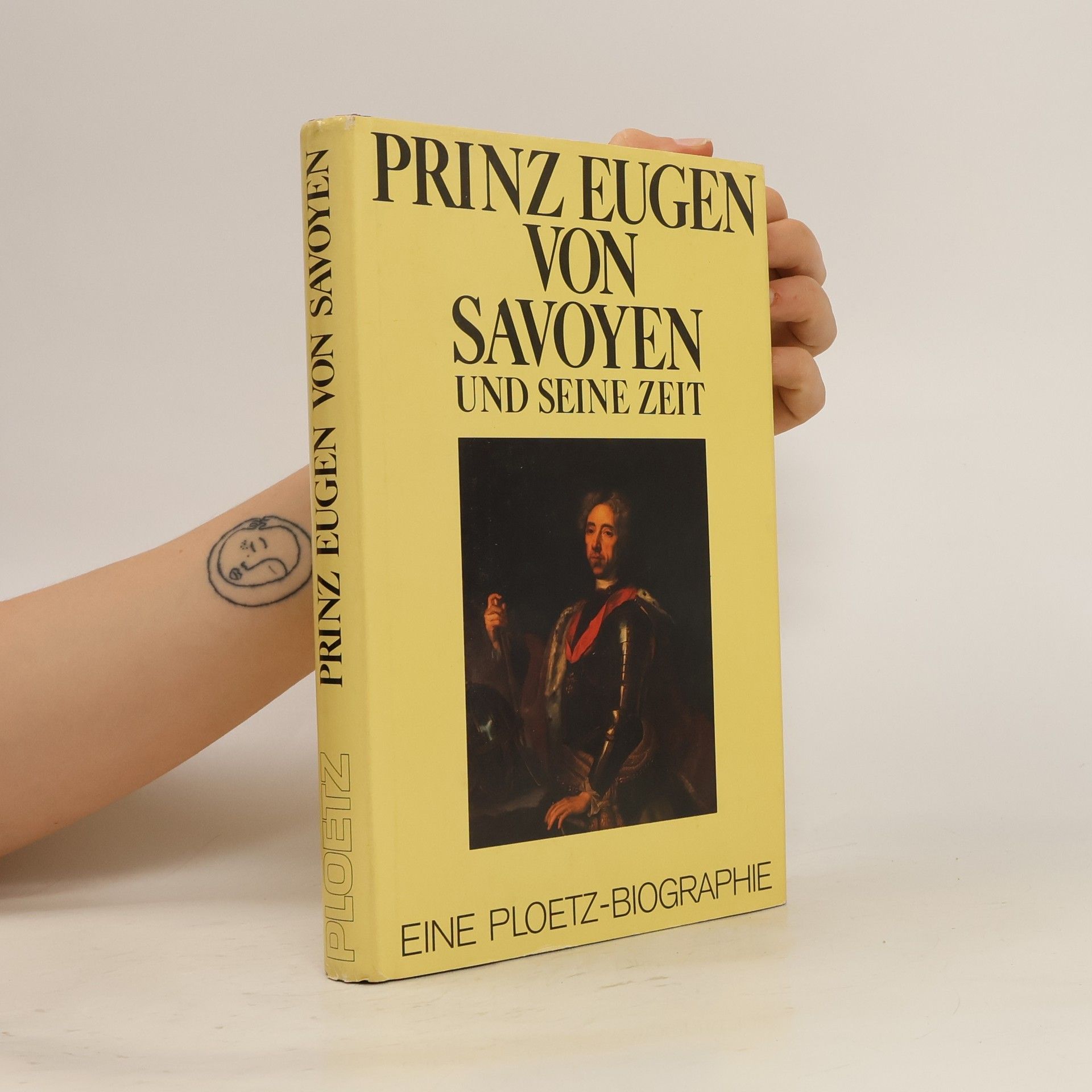Johannes Kunisch über den Preußen-König Nach seiner glänzenden und hoch gelobten Biographie Friedrichs des Großen legt Johannes Kunisch jetzt einen Sammelband vor, in dem Themen aufgegriffen und vertieft werden, die in einer chronologisch angelegten Lebensgeschichte in dieser Ausführlichkeit nicht zur Sprache kommen können. Neben Beiträgen zur Rezeptionsgeschichte gehen die Essays auf widersprüchliche Aspekte im Denken und Handeln des preußischen Königs ein und präsentieren neue Erkenntnisse der Forschung, die unser Bild Friedrichs vervollständigen. Thomas Mann und Friedrich der Große Der Historikerstreit über den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges Das Begräbnis eines Unsterblichen? Friedrich der Große, Friedrich Wilhelm II. und das Problem der dynastischen Kontinuität im Hause Hohenzollern > Friedrich der Große und die preußische Königskrönung von 1701 „Ein großer Wurf ... nicht weniger als ein glänzend erzähltes Epochengemälde.“ Arne Karsten, Frankfurter Rundschau
Johannes Kunisch Bücher



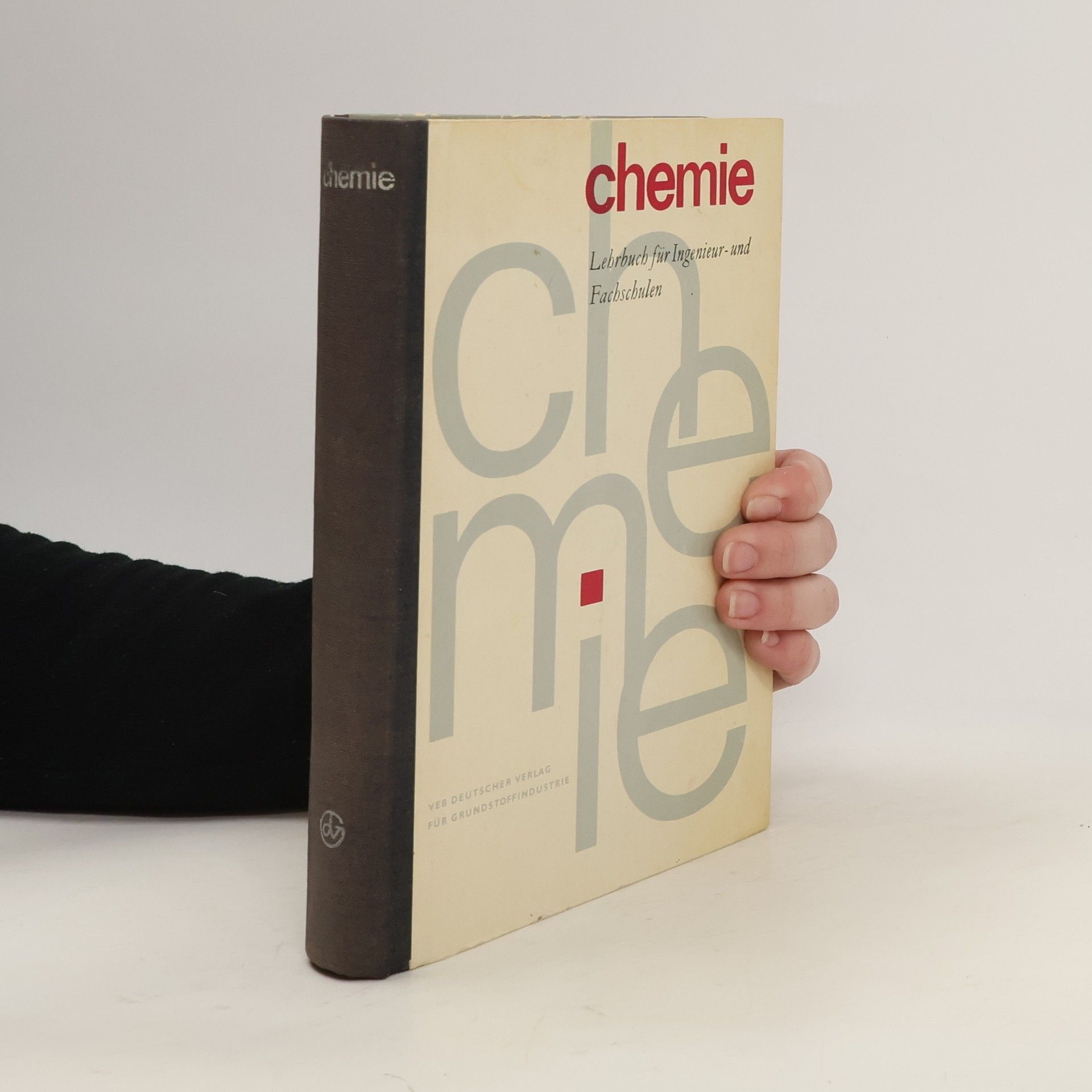

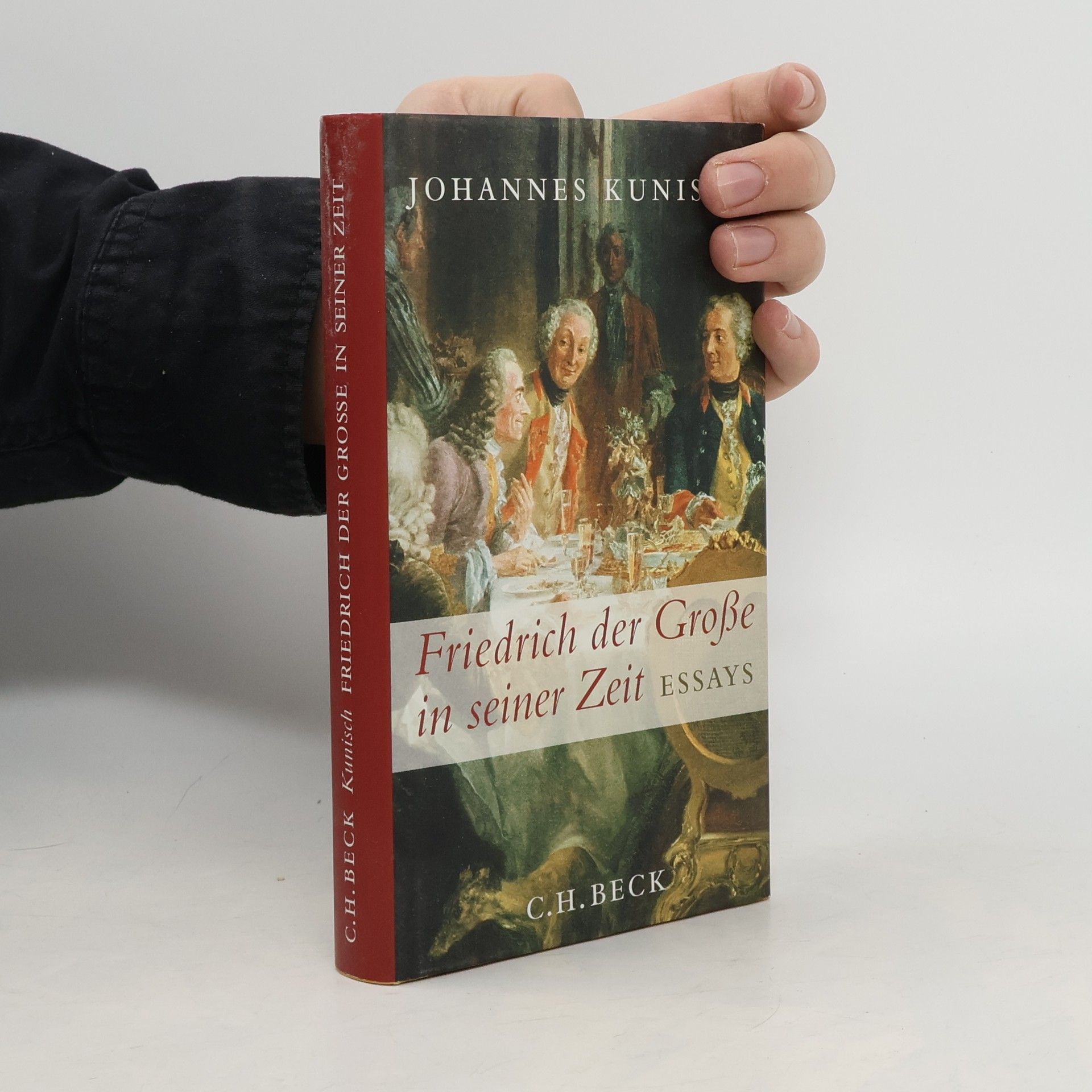
Friedrich der Grosse
Der König und seine Zeit
Friedrich der Große – die lange erwartete Biographie„Die Schicksale von Völkern und Staaten, die Richtungen von ganzen Civilisationen“ können daran hängen, daß „Ein außerordentlicher Mensch durch seine abnorme Willenskraft magischen Zwang um sich verbreitet“. Mit diesen berühmten Worten portraitiert Jacob Burckhardt Friedrich den Großen in seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen. Nun liegt seit langer Zeit wieder eine gültige Biographie des Preußenkönigs vor, die nicht nur die so überaus komplexe Persönlichkeit Friedrichs sensibel auslotet, sondern zugleich mit souveräner Meisterschaft in die Geschichte des 18. Jahrhunderts einführt. Keine andere Gestalt der preußischen Geschichte hat mehr Widerspruch und Faszination hervorgerufen als Friedrich der Große.
Der Band dokumentiert die Tagung der Preußischen Historischen Kommission, die vom 16. bis 18. November 2000 in der Eosanderkapelle des Schlosses Charlottenburg stattfand. Der Fokus lag auf dem Abschluss des Krontraktates, der am 16. November 1700 zwischen dem Kaiserhaus und dem Kurfürsten von Brandenburg unterzeichnet wurde, nicht auf dem Jubiläum der Krönung selbst, die am 18. Januar 1701 stattfand. Dieses Abkommen ermöglichte die Selbstkrönung im darauffolgenden Januar. In den Beiträgen des Bandes wird die Königserhebung aus neuen Perspektiven erörtert, wobei ein breites Spektrum an Themen rund um den Krönungsakt behandelt wird. Der Monarch selbst wird nicht biographisch gewürdigt, jedoch werden seine Rolle, Vorzüge, Grenzen und die Energie, mit der er die Standeserhöhung seines Hauses verfolgte, deutlich. Das Hauptinteresse der Tagung galt den strukturellen und politischen Faktoren, die die Königserhebung des Hauses Brandenburg ermöglichten. Es wird diskutiert, ob die Krönung als eitler Selbstdarstellungswahn eines schwachen Monarchen oder als „ein staatsmännisches Meisterstück“ zu bewerten ist, wie es selbst der kritische Enkel, der große Friedrich, zugab.
Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte
- 202 Seiten
- 8 Lesestunden
Die ZHF bietet ein Forum für die Forschung zur Geschichte der europäischen Vormoderne. Das Konzept beruht auf der Idee, die Epochen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit über die Zäsur um 1500 hinweg als strukturelle Einheit wahrzunehmen. Neben Aufsatzbeiträgen bietet die ZHF regelmäßig aktuelle Forschungsberichte und einen ausführlichen Besprechungsteil. Zweimal jährlich erscheint ein thematisch ausgerichtetes Beiheft.
Expansion und Gleichgewicht
- 239 Seiten
- 9 Lesestunden
Die ZHF bietet ein Forum für die Forschung zur Geschichte der europäischen Vormoderne. Das Konzept beruht auf der Idee, die Epochen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit über die Zäsur um 1500 hinweg als strukturelle Einheit wahrzunehmen. Neben Aufsatzbeiträgen bietet die ZHF regelmäßig aktuelle Forschungsberichte und einen ausführlichen Besprechungsteil. Zweimal jährlich erscheint ein thematisch ausgerichtetes Beiheft.
Prinz Eugen von Savoyen und seine Zeit
- 255 Seiten
- 9 Lesestunden
InhaltsverzeichnisInhalt: H. Mohnhaupt, Die Lehre von der »Lex Fundamentalis« und die Hausgesetzgebung europäischer Dynastien - J. Weitzel, Die Hausnormen deutscher Dynastien im Rahmen der Entwicklungen von Recht und Gesetz - J. Kunisch, Hausgesetzgebung und Mächtesystem. Zur Einbeziehung hausvertraglicher Erbfolgeregelungen in die Staatenpolitik des ancien régime - T. Klein, Verpaßte Staatsbildung? Die wettinischen Landesteilungen in Spätmittelalter und früher Neuzeit - R. Reinhardt, Kontinuität und Diskontinuität. Zum Problem der Koadjutorie mit dem Recht der Nachfolge in der neuzeitlichen Germania Sacra - W. Reinhard, Bemerkungen zu »Dynastie« und »Staat« im Papsttum - U. Muhlack, Thronfolge und Erbrecht in Frankreich - H. Pietschmann, Reichseinheit und Erbfolge in den spanischen Königreichen - W. Schulze, Hausgesetzgebung und Verstaatlichung im Hause Österreich vom Tode Maximilians I. bis zur Pragmatischen Sanktion - G. Stökl, Das Problem der Thronfolgeordnung in Rußland - N. Runeby, Das 'bedingte' Erbreich: Schweden - J. K. Hoensch, Königtum und Adelsnation in Polen - P. Wende, Die Thronfolge in England im 16. und 17. Jahrhundert - H. Neuhaus, Chronologie erb- und thronfolgerechtlicher Bestimmungen europäischer Fürstenhäuser und Staaten