Das Buch will einen aktuellen Überblick über die Erziehungswissenschaft vermitteln
Hans Jürgen Apel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

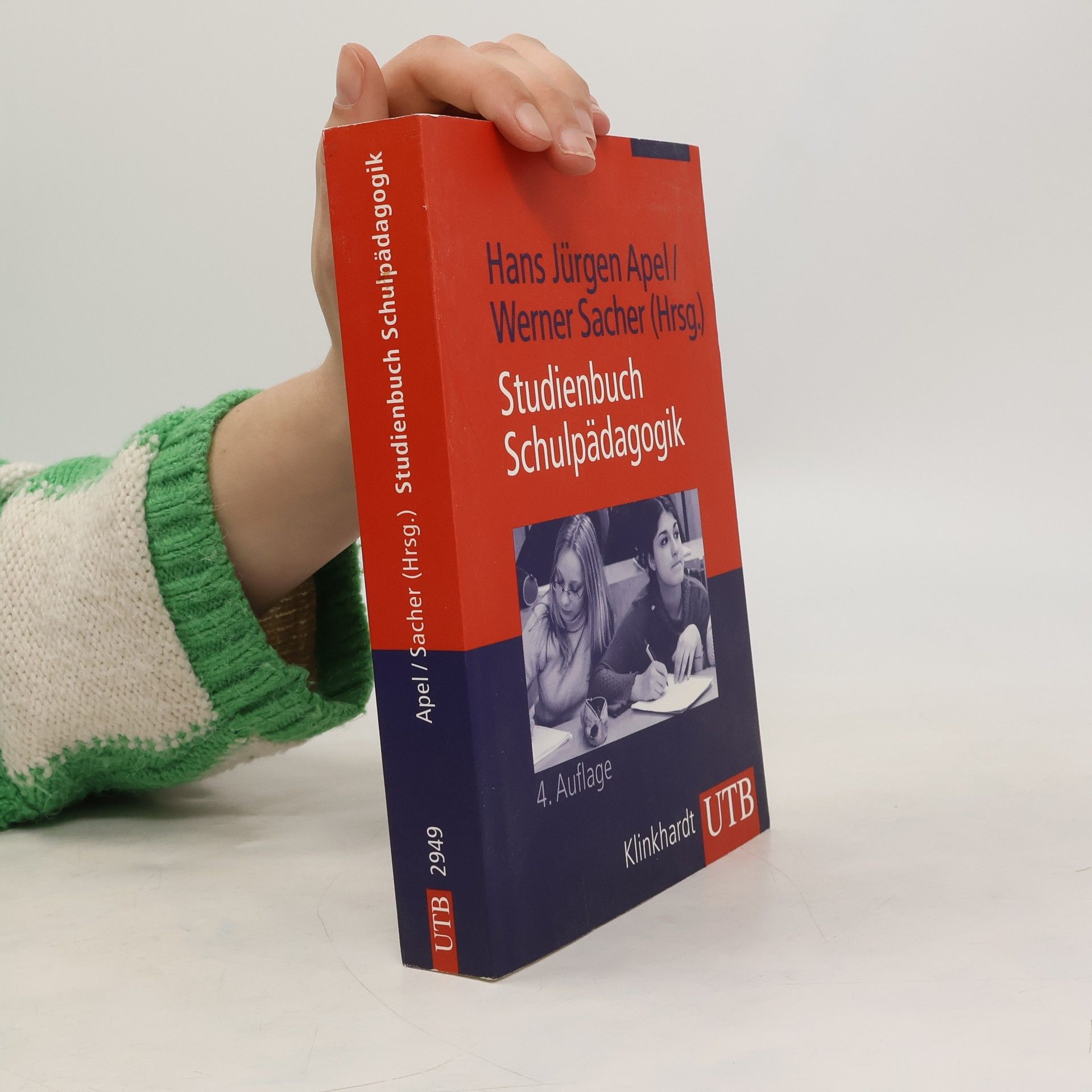
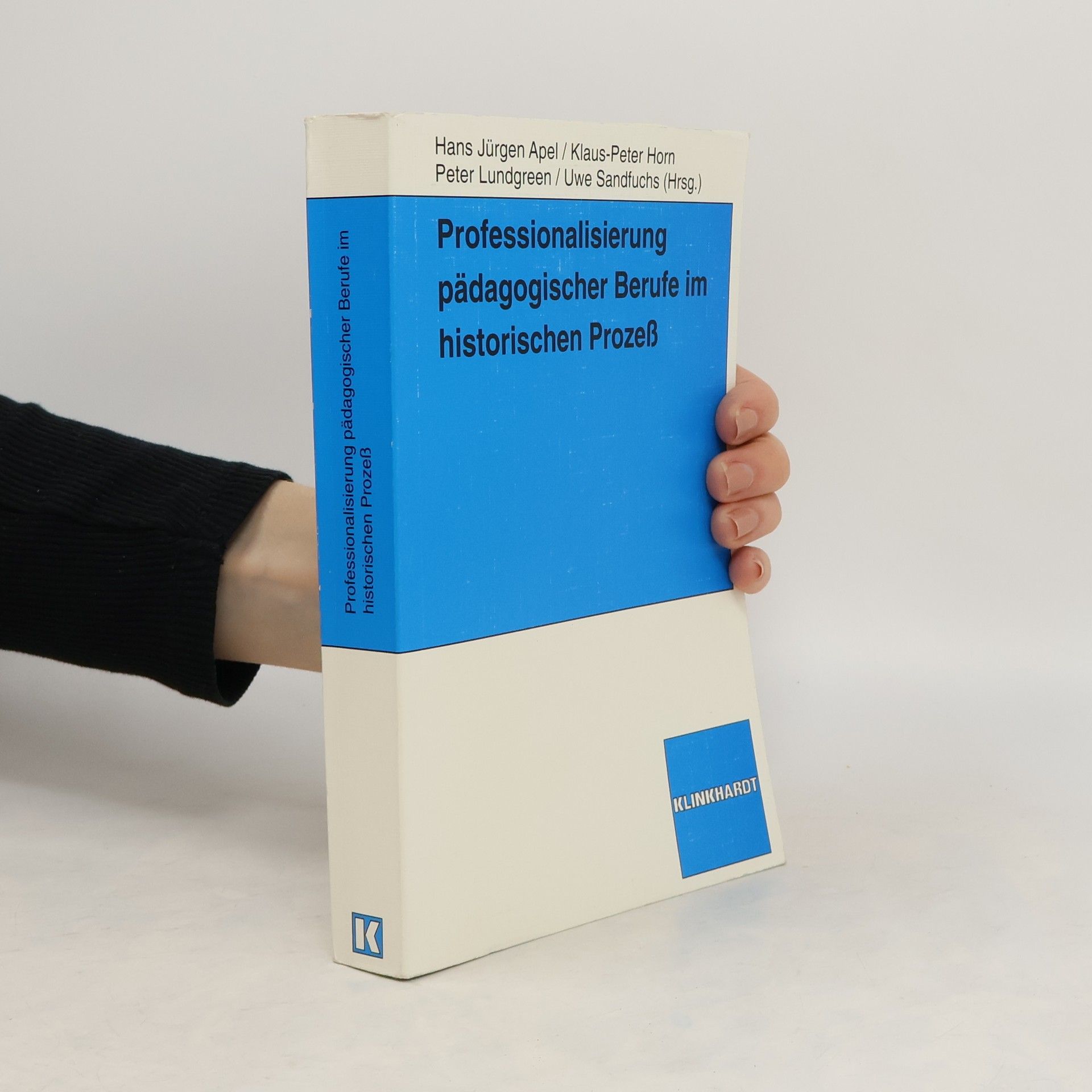
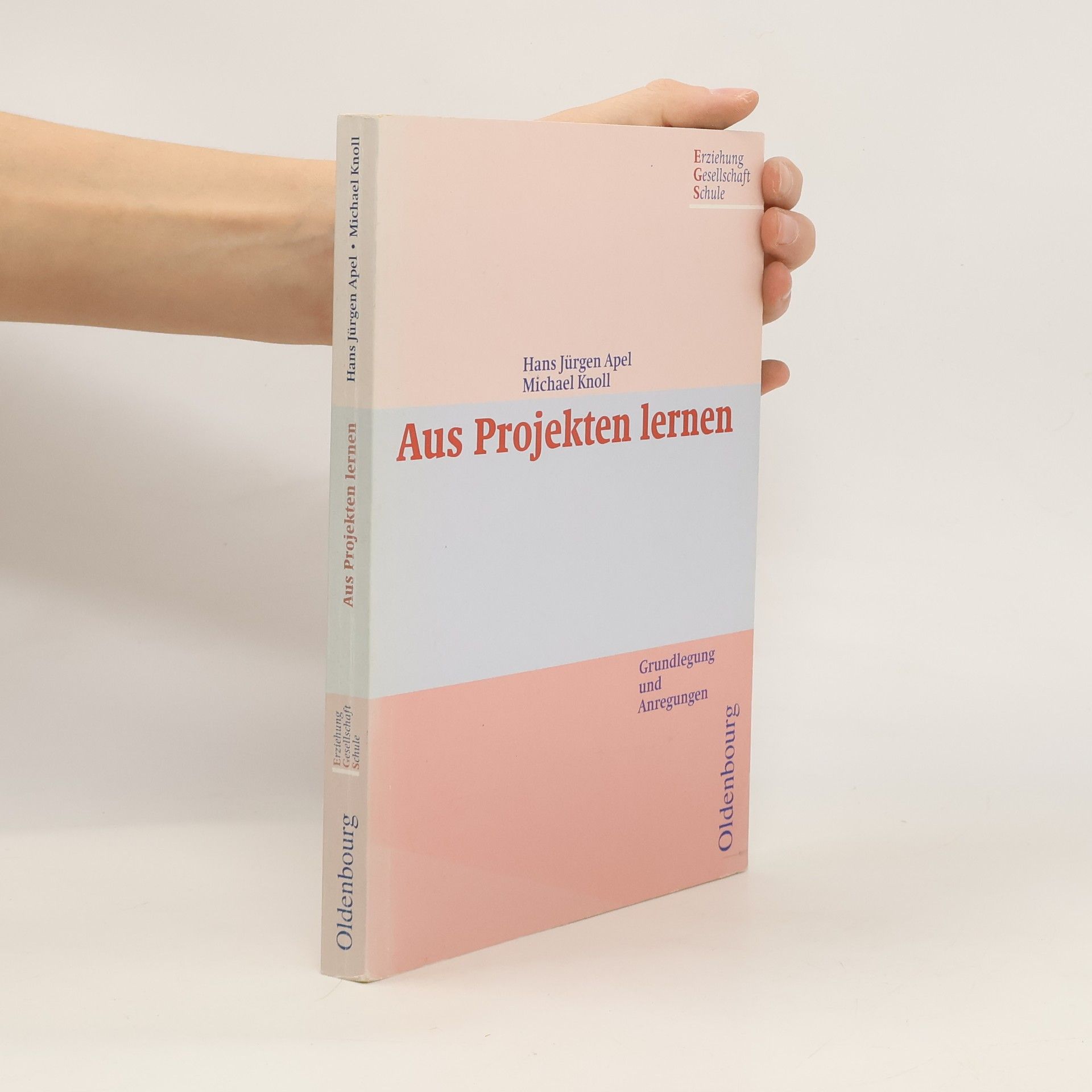
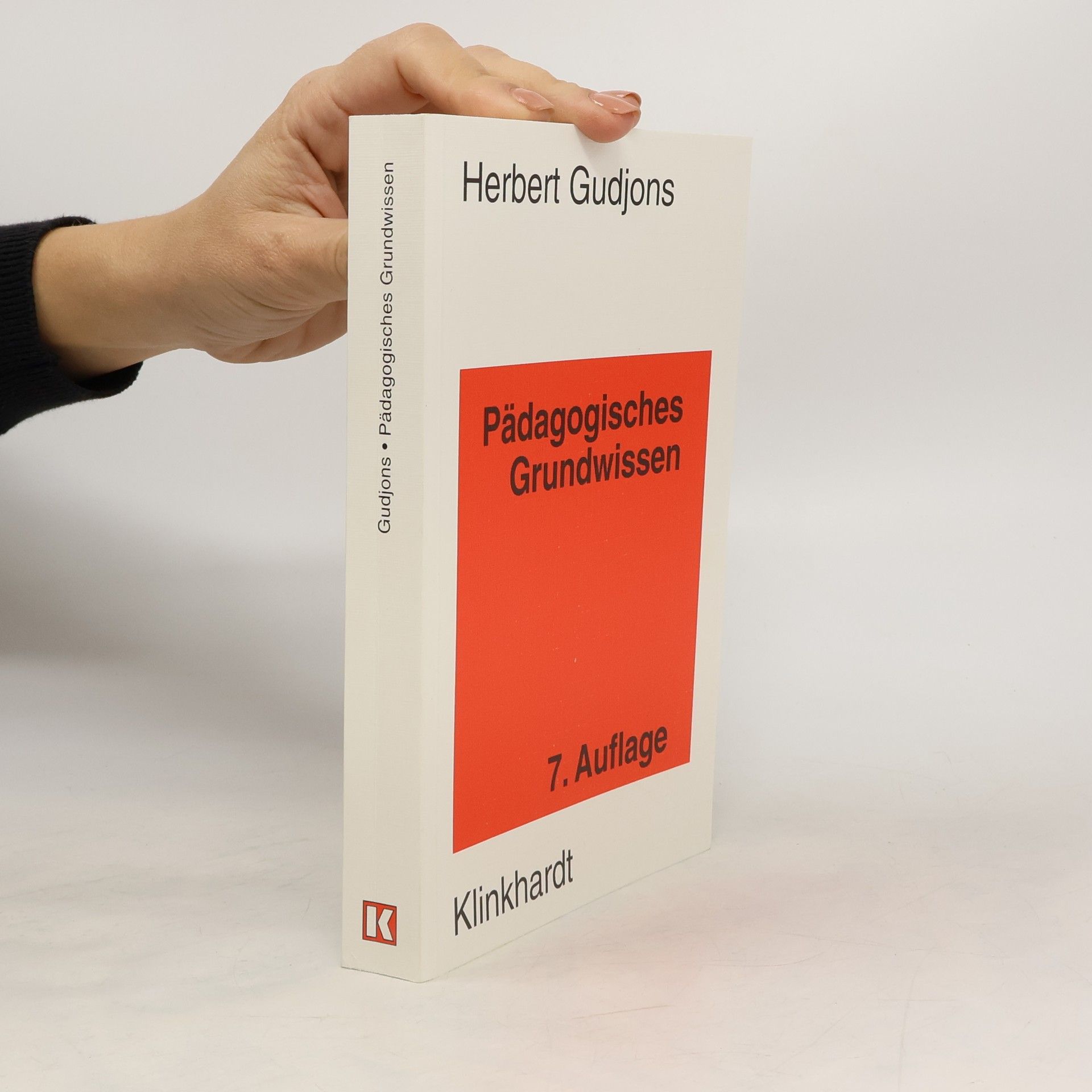
Aus Projekten lernen
- 208 Seiten
- 8 Lesestunden
Ausgangspunkt der Studienbuch-Konzeption ist das handlungsorientierte Lernen. Welche Rolle spielt das Projektlernen als Methode bei der Förderung zur Selbstständigkeit, wie kann das Projektlernen als Instrument der professionellen Fort- und Weiterbildung genutzt und eingesetzt werden? Notwendige Beispiele zur Projektarbeit und deren Auswirkungen auf den Fach-Unterricht runden das Konzept ab.
Die Vorlesung
- 141 Seiten
- 5 Lesestunden
Die Vorlesung ist trotz gelegentlicher Anfeindungen immer noch die gebräuchlichste akademische Lehrform. Sie erscheint den meisten Lehrenden so selbstverständlich, dass über ihre Gestaltung selten nachgedacht wird. Kritisch äußert man sich in der Diskussion über den Lehrvortrag: Vorlesungen seien schlecht gegliedert, würden unzulänglich vorgetragen, dienten nur der Selbstdarstellung der Professoren. Mit dieser Meinung räumt der Autor auf. Er geht von mehrjährigen Befragungen seiner Studenten und von eigenen Studien in Hörsälen aus und begreift Vorlesungen als rhetorisch zu gestaltende Lehr-und Lern-Situationen, in denen Studenten grundlegende Einblicke in die Wissenschaft gewinnen können - wenn nur gekonnt vorgetragen wird. Um Vortragskompetenz anzuregen, zeigt der Autor, welche Mängel die unzulängliche und welche Vorzüge die anregend-anspruchsvolle Vorlesung aufweist. Dabei wird klar, daß der alte Spruch „Wer gut gliedert, lehrt gut“ noch nicht ausreicht. Der akademische Lehrvortrag lässt sich rhetorisch verfeinern. Hierzu liefert der Autor zahlreiche Anregungen und anschauliche Beispiele.