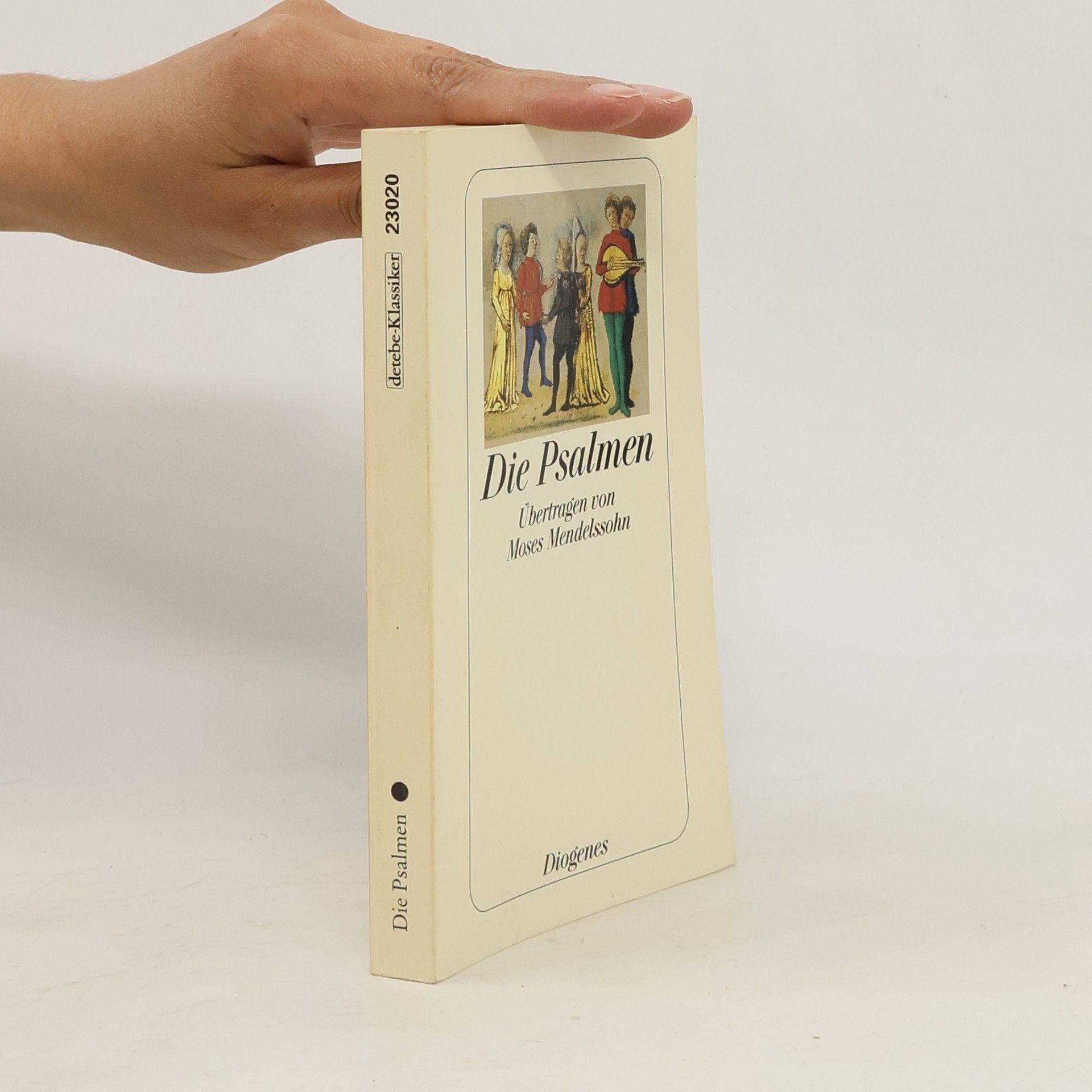Äsopische Fabeln
- 390 Seiten
- 14 Lesestunden
Äsop war ein Sklave im frühen Griechenland, der zwar einen mißgebildeten Körper hatte, aber über außerordentliche geistige Fähigkeiten verfügte. Auf diese Weisheit wurde Apollo, der Gott der Musen, so eifersüchtig, daß er Äsop kurzerhand von einem Felsen in den Tod stoßen ließ. Überliefert wurden die Äsopischen Fabeln von antiken Geschichtsschreibern wie Herodot, seit mehr als 2500 Jahren sind sie variiert, kommentiert und teilweise neu erfunden worden. Die vorliegende Ausgabe folgt der Bearbeitung des Romanautors Samuel Richardson und bringt 40 Kupfertafeln der Erstausgabe von 1757, sie wurde von Gotthold Ephraim Lessing ins Deutsche übersetzt.