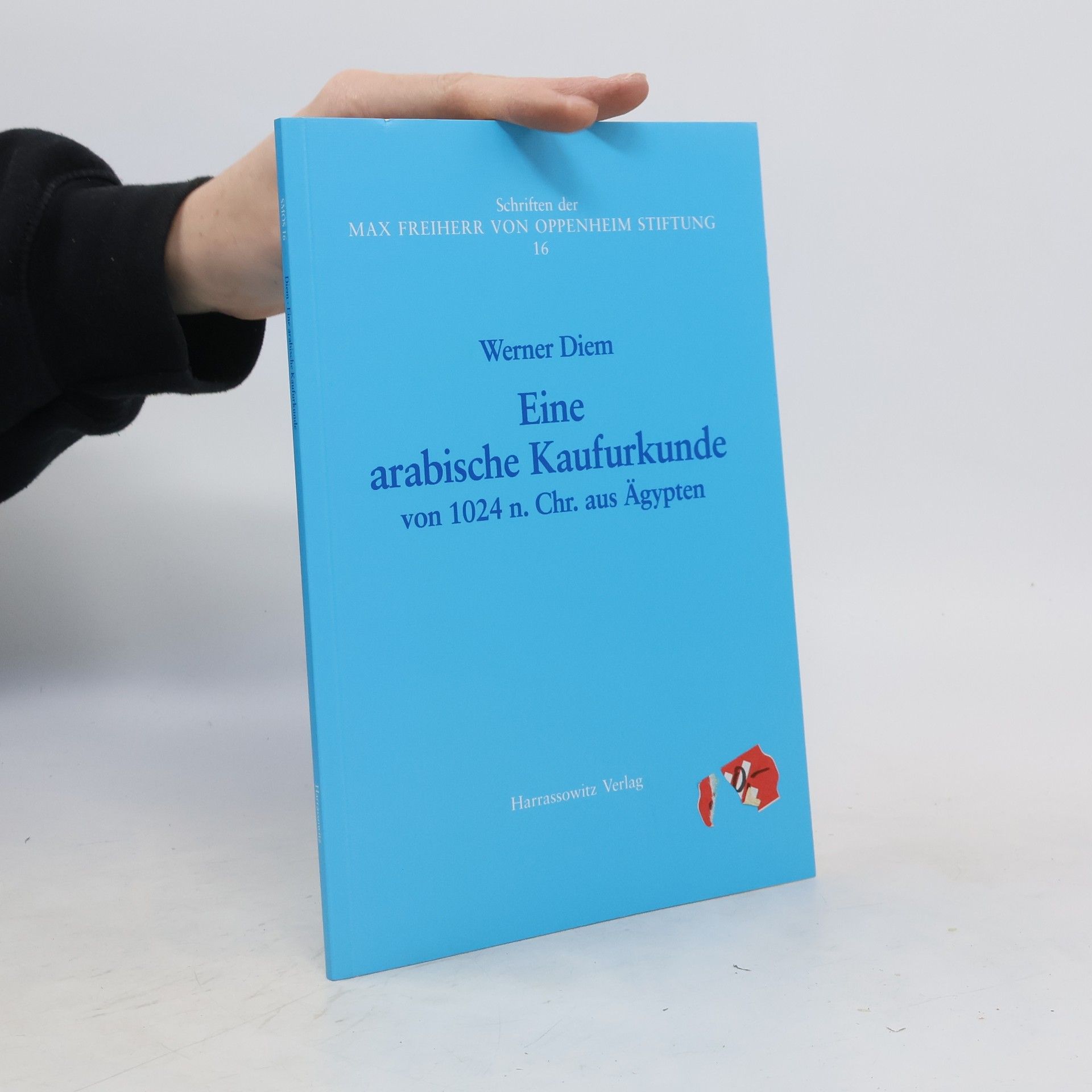Arabische Kerzendichtung des 10.–15. Jahrhunderts
Eine Studie zur arabischen ekphrastischen Poesie
In den letzten Jahrzehnten ist die arabische ekphrastische Dichtung in den Fokus der Arabistik gerückt. Mit diesem Band legt Werner Diem eine Studie zur Kerzendichtung vor, einem der wichtigeren Genres jener Dichtung. Die Studie beruht auf 185 Zeugnissen, überwiegend Distichen, aber auch längeren und sehr langen Gedichten. Nach einer Einleitung in die Thematik, die auch Einleitungsformeln behandelt, werden die Gedichte in vokalisiertem arabischem Text und annotierter Übersetzung nach Subgenres geordnet vorgestellt. Diese sind 1. Beschreibende Gedichte über die Kerze, 2. Gedichte über Dichter und Kerze, 3. Gedichte über Kerzen in bestimmten Situationen, 4. Gedichte über junge Menschen mit Kerzen, 5. Gedichte über Kerzen als Geschenk und 6. Rätselgedichte über die Kerze. Es folgen analytische Kapitel über Einleitungsbezeichnungen der Kerze, die Kerze in Vergleich und Metapher, die Kerze in Personifikation und Intertextualität. Bei der Personifikation entsteht das Bild eines hinsichtlich Körper und Seele, Kleidung und Schmuck, Zustände und Emotionen menschlichen Wesens, das mit der Dunkelheit, den Menschen und dem Dichter auf verschiedenste Weise interagiert.