Nach einer Abhandlung über die Begriffsgeschichte stellt der Autor die in der Kunst vorkommenden christlichen Symbole in historischer Folge vor. Für jedes Symbol werden Ursprung und Bedeutung nachgewiesen und anhand von Beispielen die Anwendung in der Kunst belegt.
Donat de Chapeaurouge Bücher
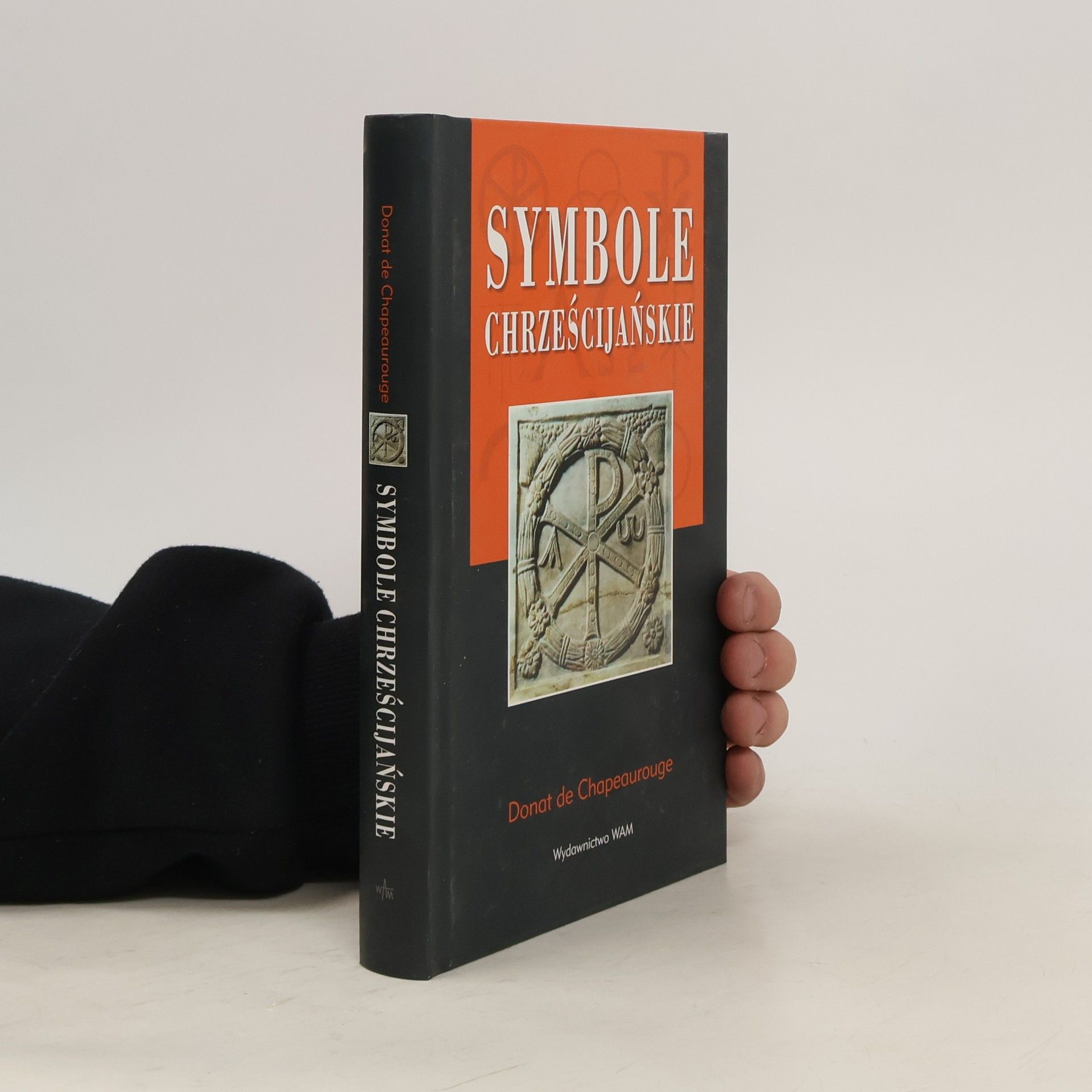
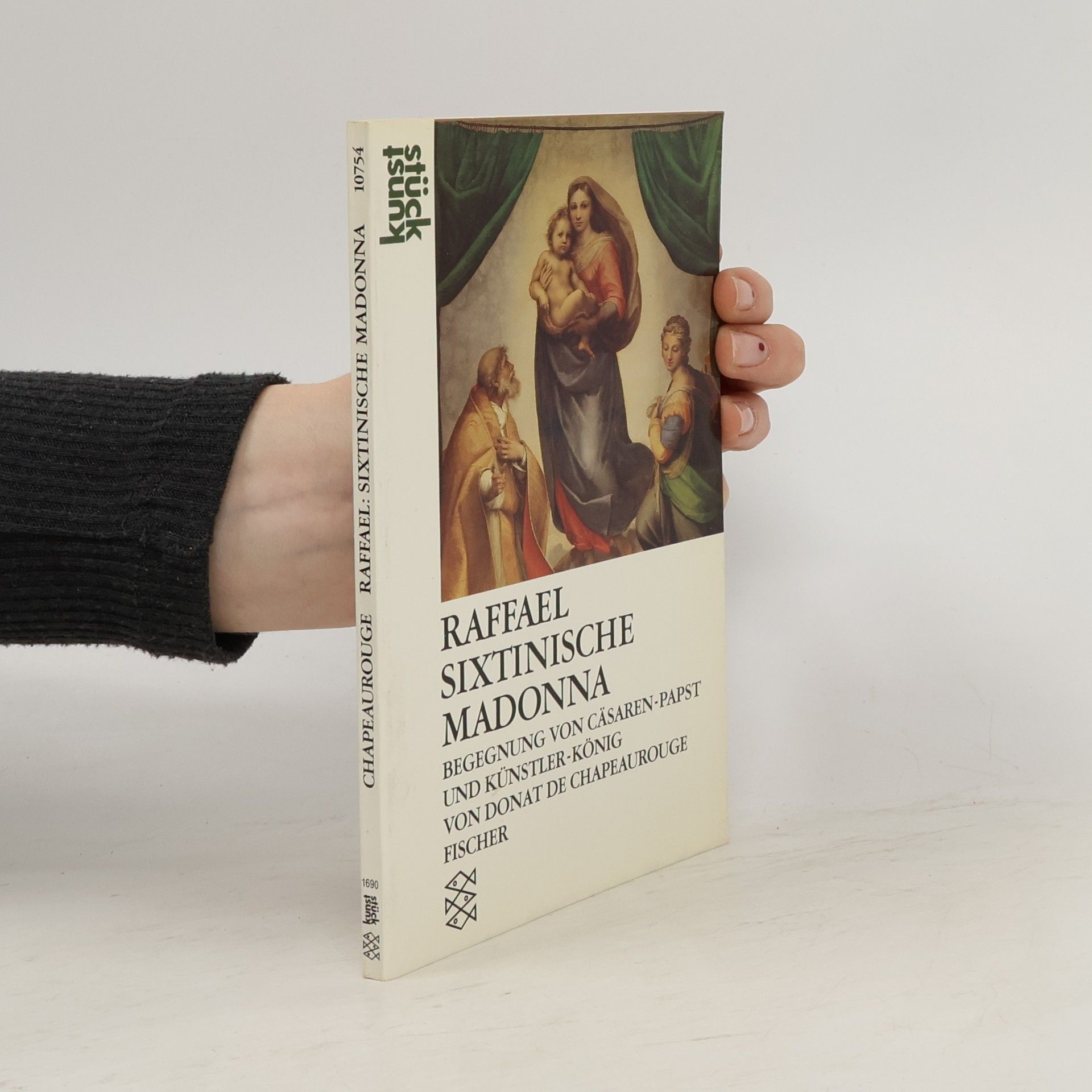

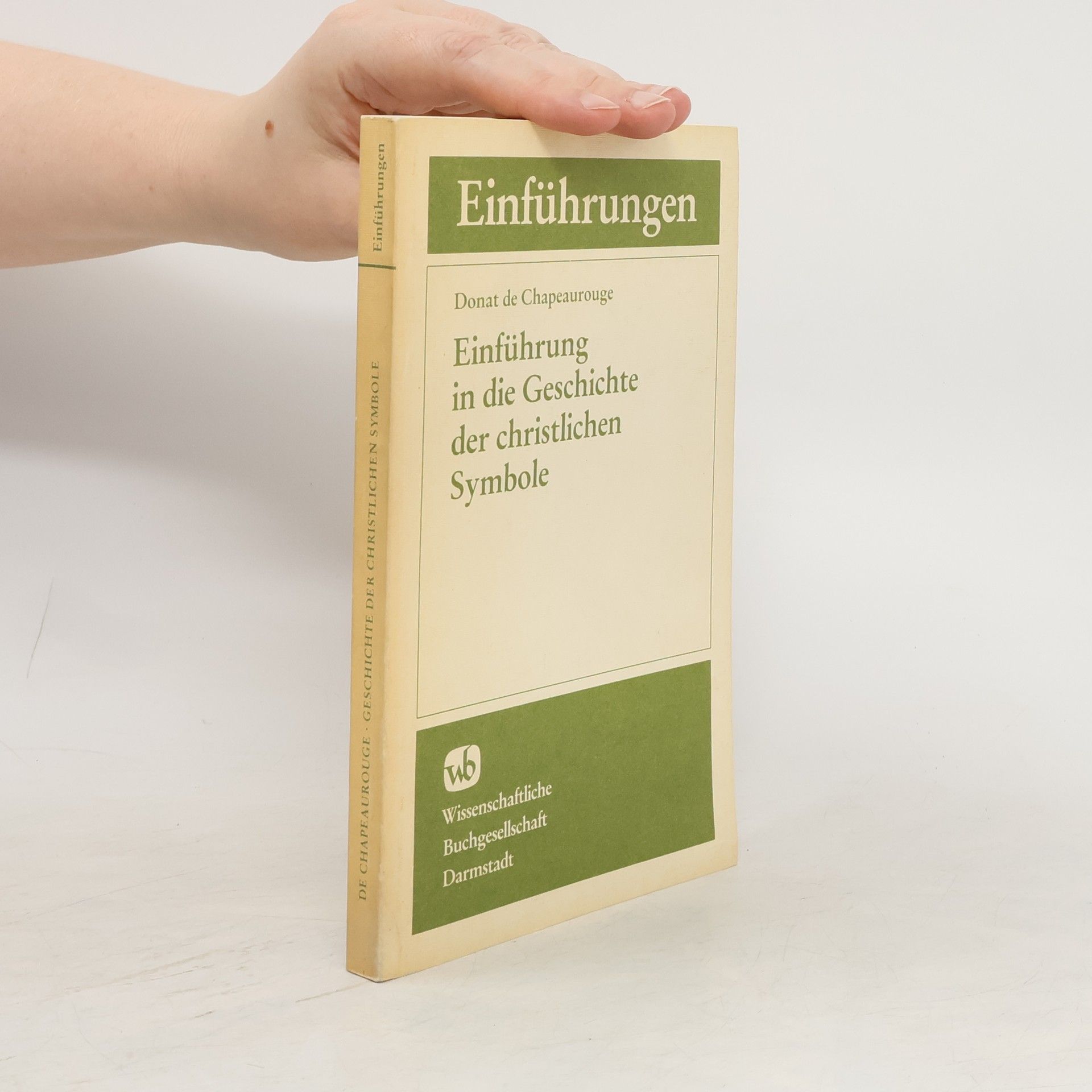
Das Düsseldorfer Bild „hat Kopf, Hand, Fuss und Herz“ von Klee (1930) wird als verkappte Christus-Darstellung erkannt, wobei ein parodistischer Ton überwiegt. Im Hinblick auf George Grosz und dessen aktuellen Gotteslästerungsprozeß hat Klee sich zur Vorsicht gegenüber einem etwaigen Blasphemie-Vorwurf entschlossen. Trotzdem ist nicht nur eine offenkundige Reserve gegenüber dem Christentum, sondern sogar eine atheistische Position des Künstlers deutlich. Diese ergibt sich aus einer Überprüfung von Text- und Bildzeugnissen aus der gesamten Schaffenszeit Klees. Die Anregung durch Texte von Aristophanes, Goethe, E. T. A. Hoffmann u. a. kommt ebenso ausführlich zur Sprache wie die Interpretation des „Angelus Novus“ durch Walter Benjamin. Folgende Werke von Paul Klee werden ausführlich behandelt: „Aufgeklärte bringen den persönlichen Gott ins Museum“ (1903); „Agnus dei qui tollis peccata mundi“ (1918); „Angelus Novus“ (1920); „hat Kopf, Hand, Fuss und Herz“ (1930); die „Eidola“-Zeichnungen (1940) und die Darstellungen der „Letzten Dinge“
Swieca krzyz ryba winny krzew spojrzenie w niebo skladanie rak symbole niegdys czytelne i oczywiste dzis zagubily swoje znaczenie Dlatego wiele interpretacji moze nas zaskoczyc gdy poznamy pierwotne znaczenie danego symbolu Wprowadzenie do historii symboli chrzescijanskich prezentuje naukowe wyjasnienie blisko osiemdziesieciu symboli uzywanych w sztuce od antyku przez sredniowiecze az do czasow nowozytnych Opis kazdego z nich zawiera zrodlo jego pochodzenia ewolucje interpretacji na przestrzeni wiekow oraz przyklady zastosowania w sztuce Wiele omawianych dziel znajdziemy na ilustracjach zawartych w ksiazce Doskonaly przewodnik i niezbedna pomoc dla milosnikow sztuki