Bernd Martin Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
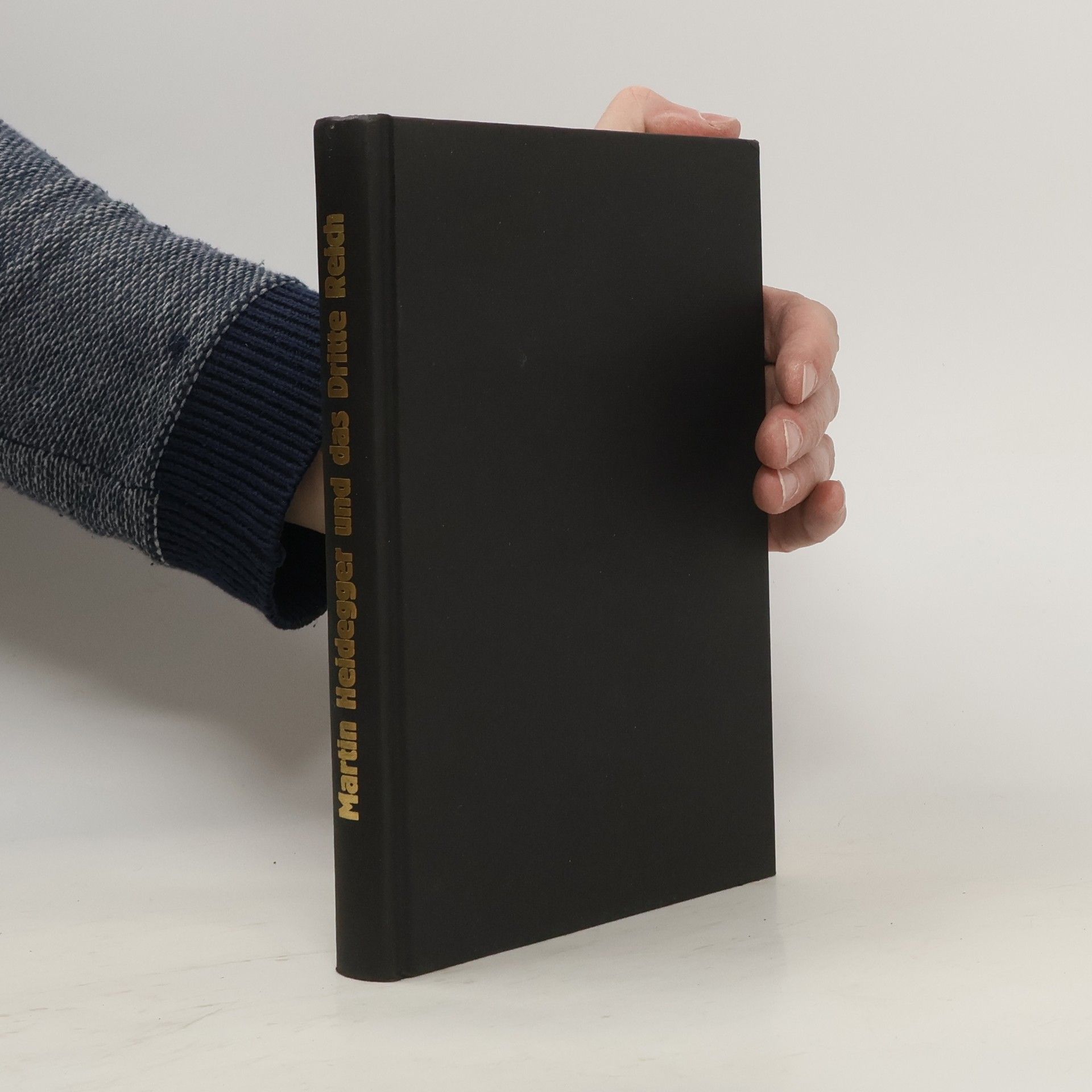


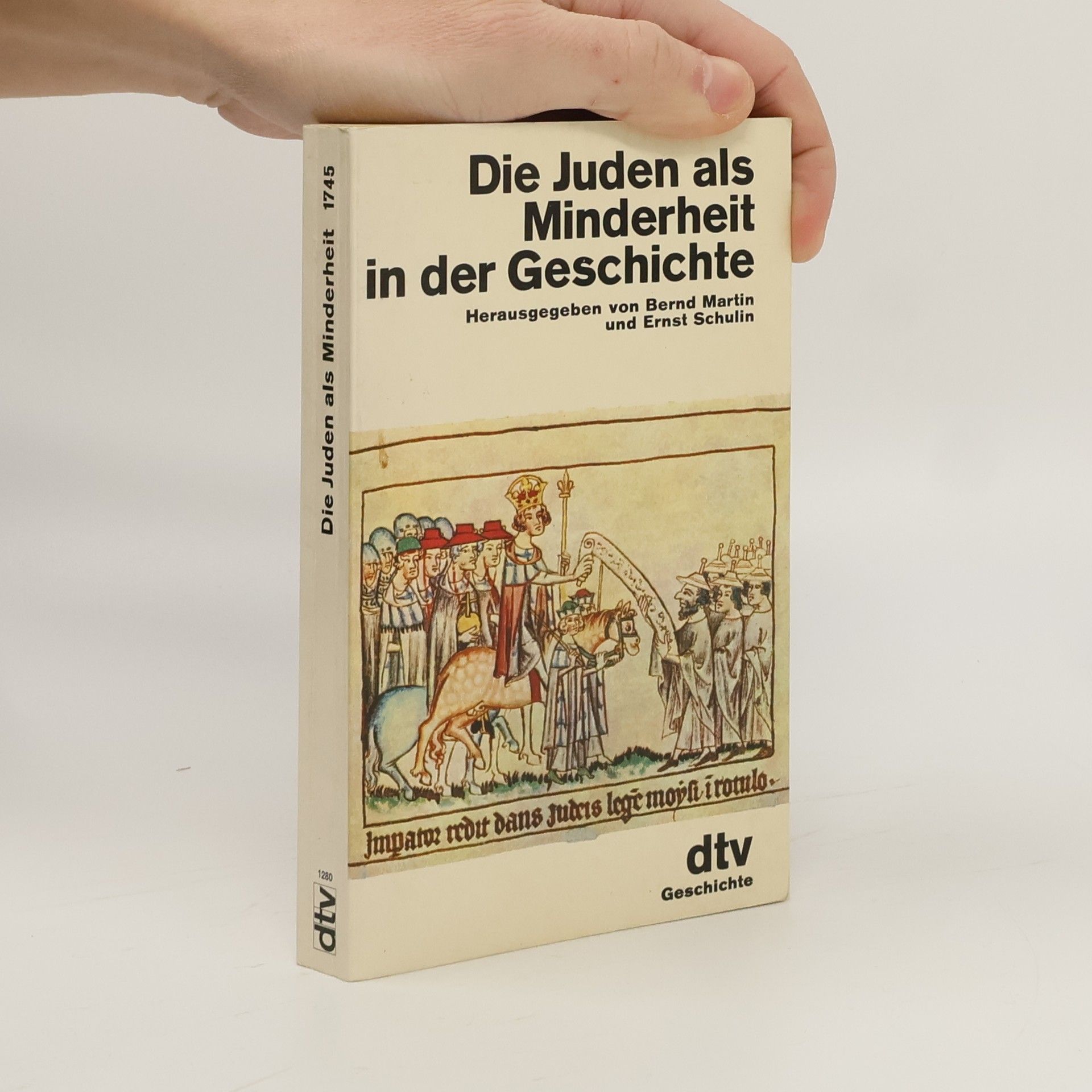
Duldung und Verfolgung, Emanzipation und Ausrottung der Juden - die verhängnisvolle Geschichte einer europäischen Minderheit.
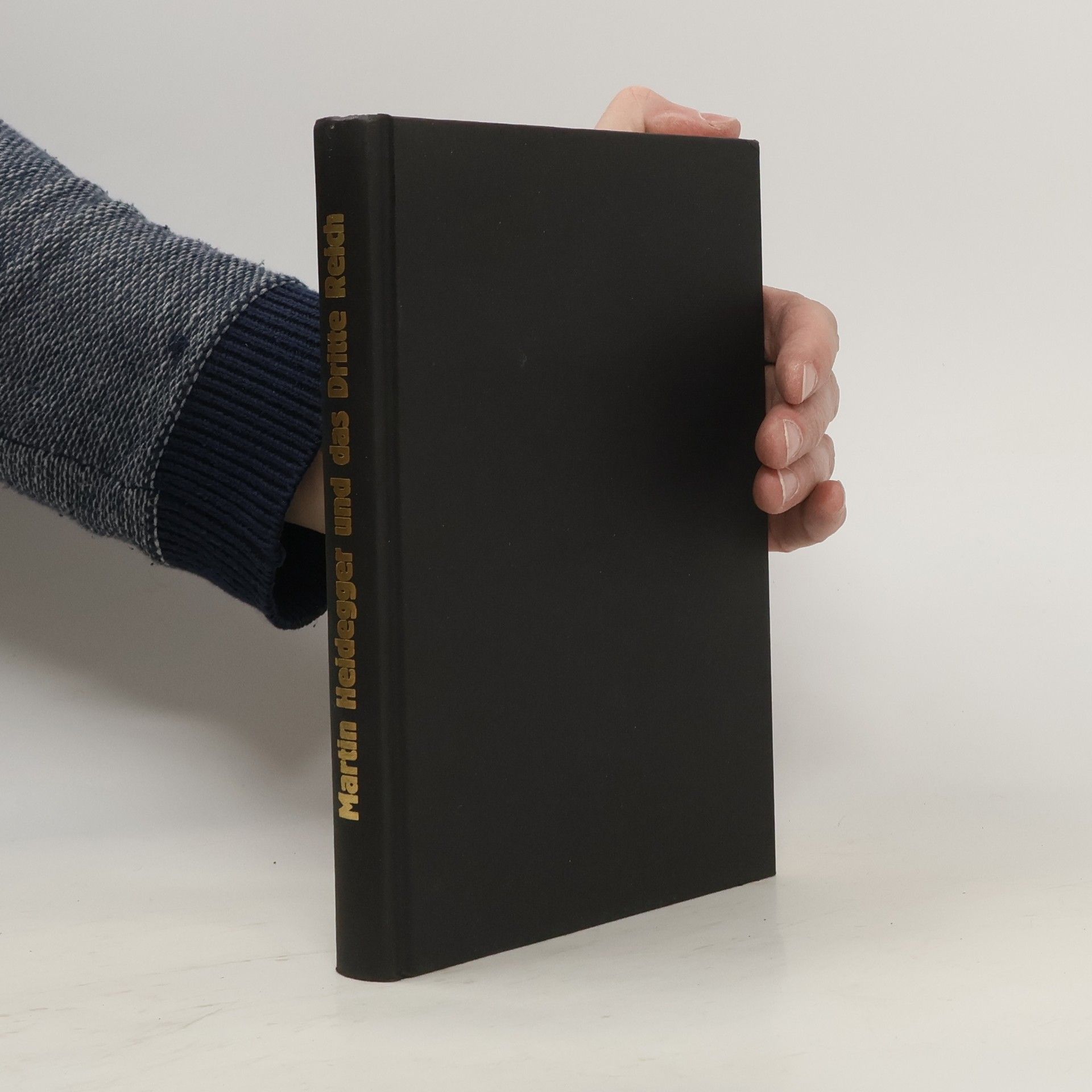


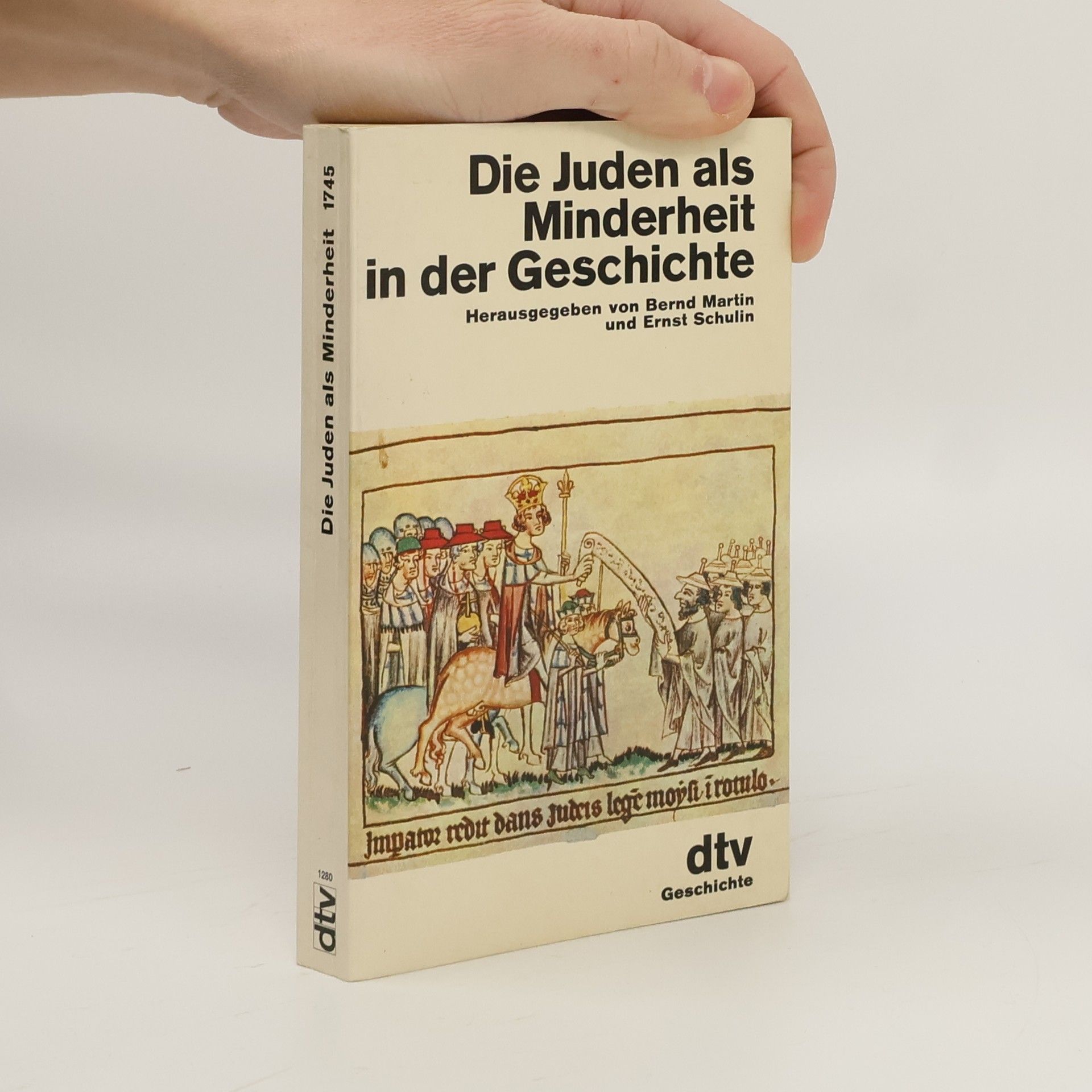
Duldung und Verfolgung, Emanzipation und Ausrottung der Juden - die verhängnisvolle Geschichte einer europäischen Minderheit.