Elterliche Sorge grassiert: Wird die Arbeitslosigkeit im Erwachsenenalter etwa schon im Kindergarten besiegelt? Lernen Kinder nicht früh genug? Und was sollen sie denn lernen? Soll der Kindergarten Behütungsraum oder Vorschule sein? In diesem Buch wird plädiert für einen Kindergarten und eine Grundschule als Raum für eigene Erfahrungen – als beste Vorbereitung auf „das Leben“, die wir Kindern mitgeben können. Themen des Buches sind: 1) Aufgabe der Grundschule: Systematisierung des Lernens; 2) Bildung als Selbstbildung oder Disziplinierung durch Füttern mit Informationen? 3) Fragen von Kindern aufnehmen und vom Kind her denken; 4) Experimente zusammen mit Kindern durchführen; 5) Zum Erziehungsplan „Bildung von Anfang an“; 6) Was will eigentlich die ältere Generation von der jüngeren?
Gerold Scholz Bücher

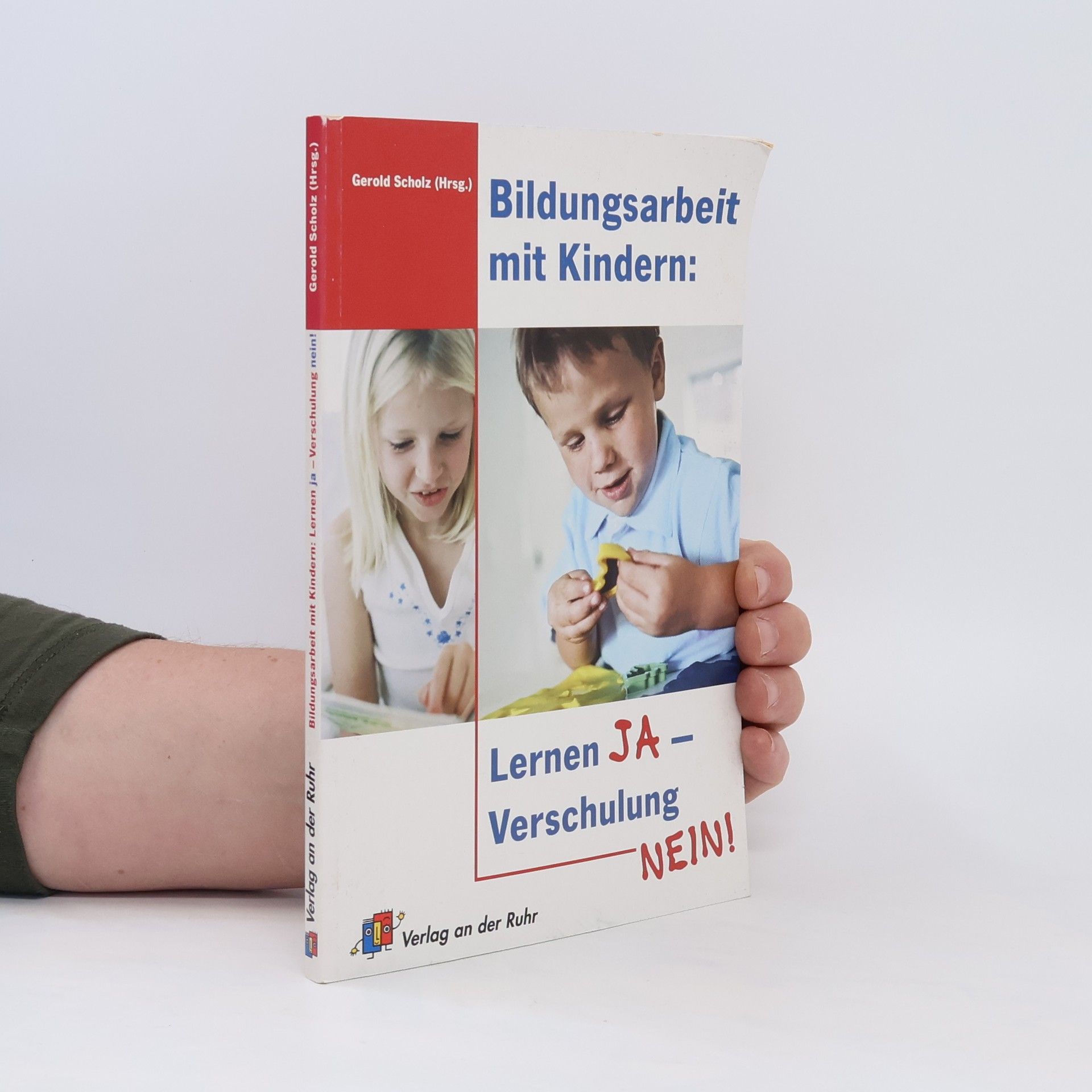
Beobachten im Schulalltag
Ein Studien- und Praxisbuch