Verfehlte Anfänge und offenes Ende
- 87 Seiten
- 4 Lesestunden

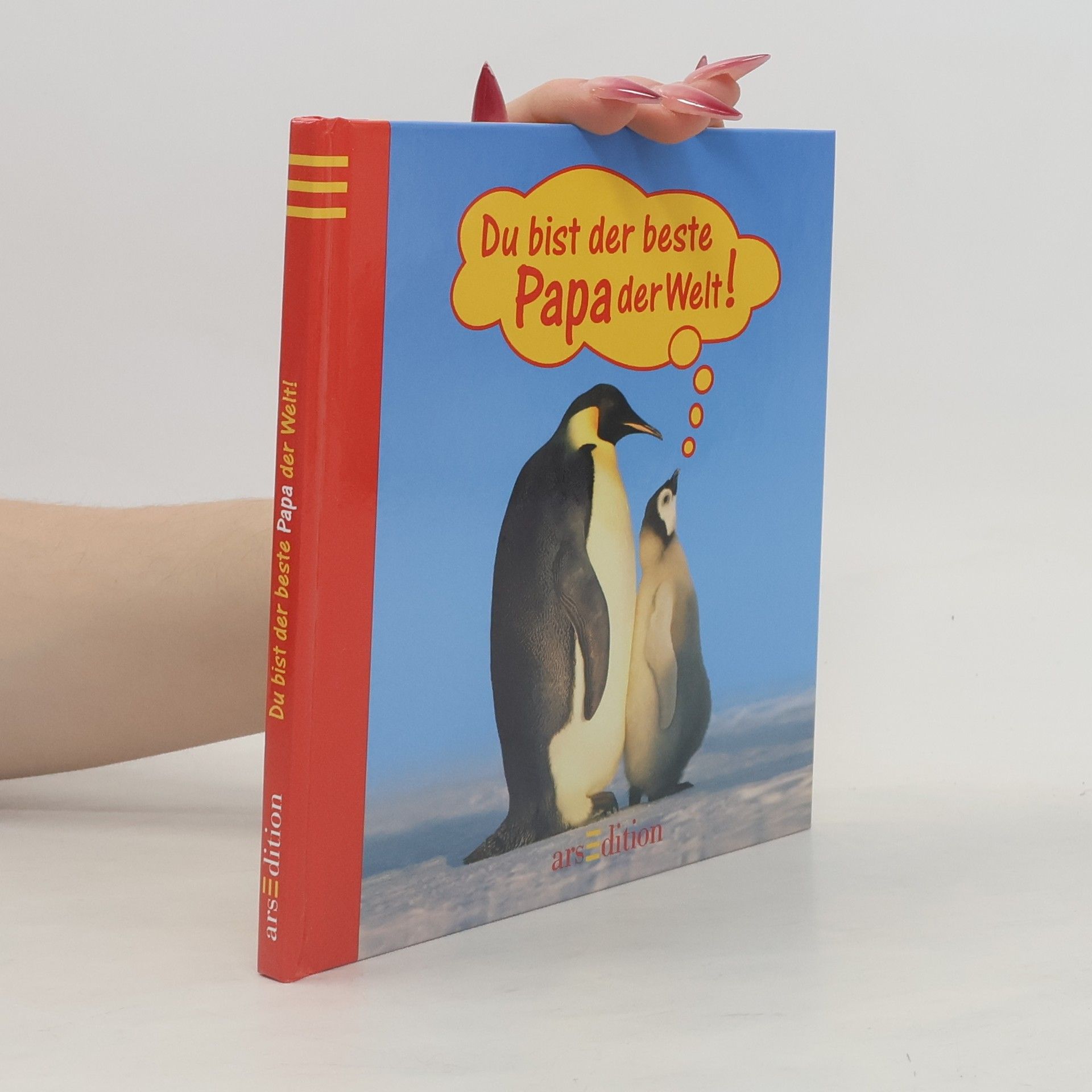
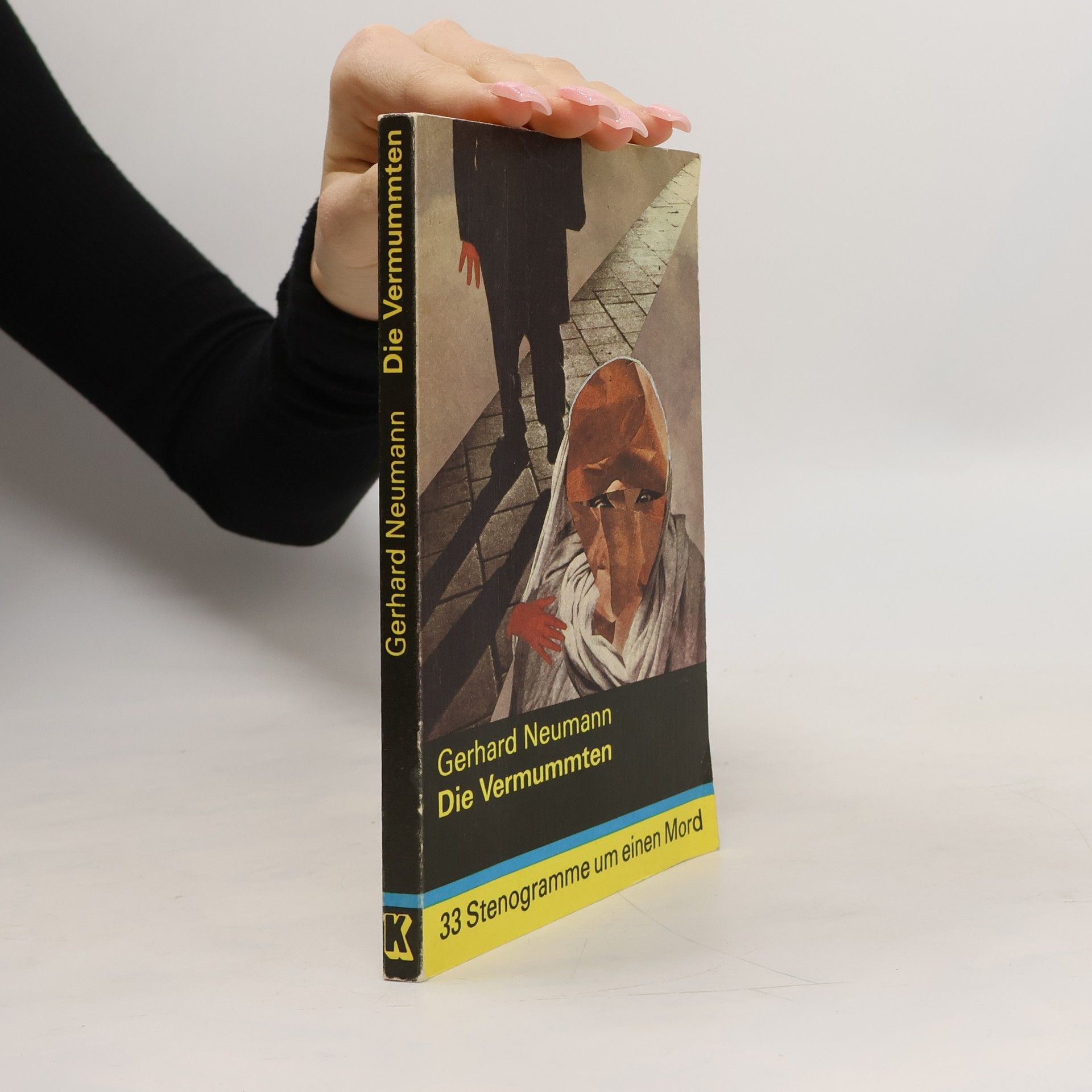

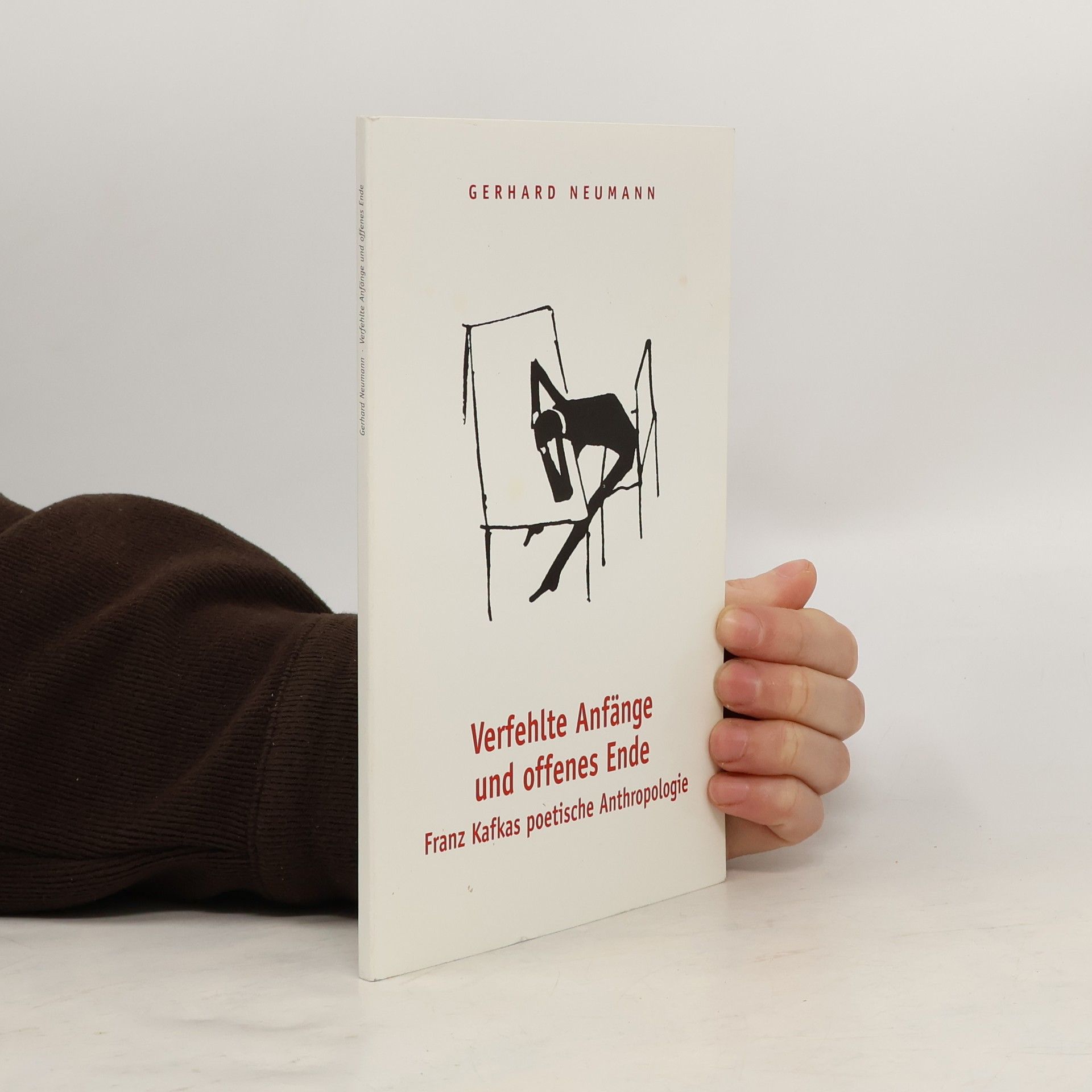
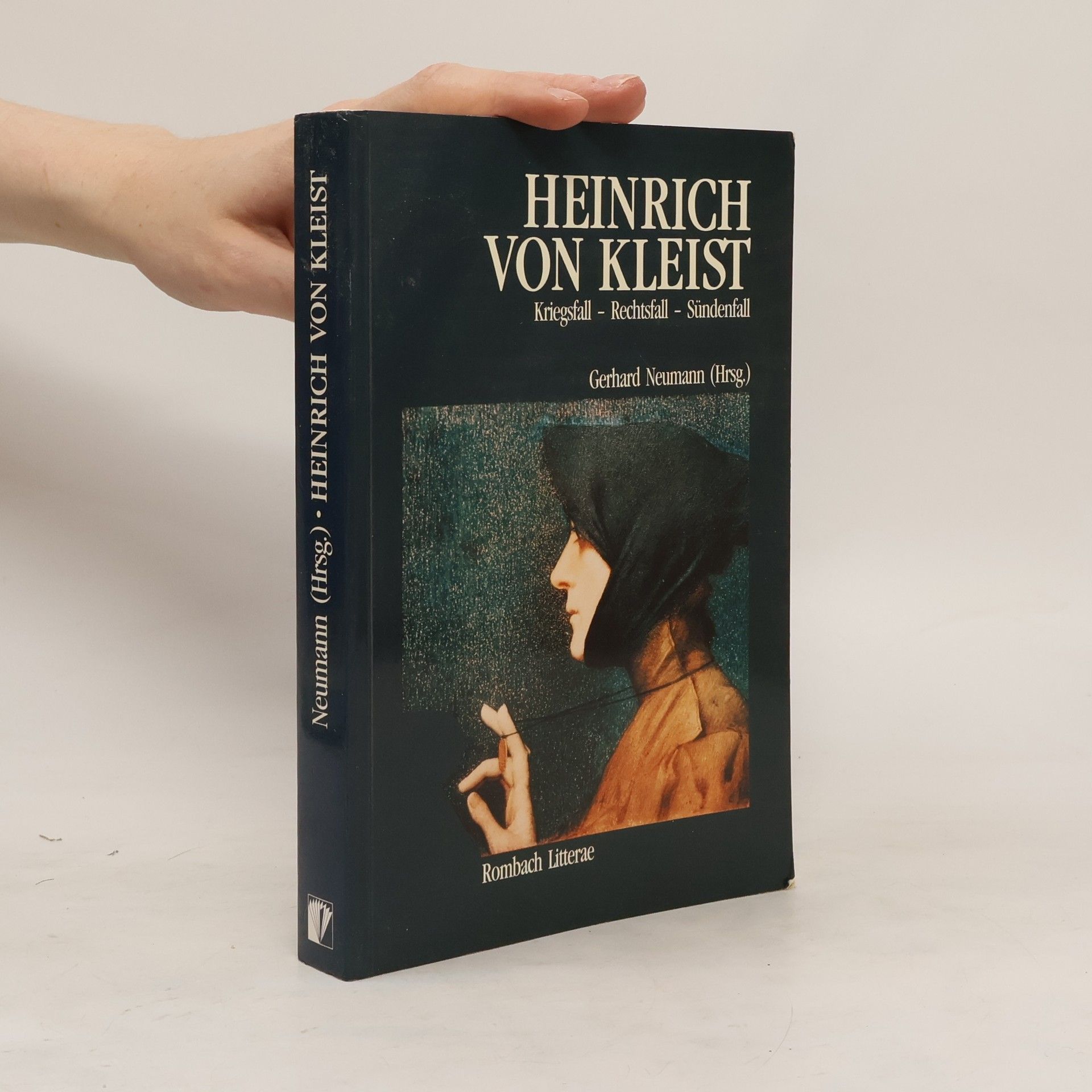
Tierische Grüße für die beste Mama der Welt, den hilfsbereiten Nachbarn, die Katzenfreundin oder den Hundeliebhaber - Im cleveren Six-Pack werden diese Bücher zum idealen Vorrat an Geschenken, die praktisch immer passen. Einfach mit einer Schleife verzier
Tierische Grüße für die liebe Familie, die besten Freunde, den aufmerksamen Kollegen oder den hilfsbereiten Nachbarn - Alle - die auch ohne großen Anlass - gerne und oft schenken, finden hier einen echten Schatz an Geschenkbüchern für jede Gelegenheit. Nu
Tierische Grüße für die beste Mama der Welt, den hilfsbereiten Nachbarn, die Katzenfreundin oder den Hundeliebhaber - Im cleveren Six-Pack werden diese Bücher zum idealen Vorrat an Geschenken, die praktisch immer passen. Einfach mit einer Schleife verzier
German
Die hier zusammengeführten 12 Aufsätze namhafter Forscher nähern sich von verschiedenen - thematisch wie methodisch orientierten - Ansätzen her einem Schlüsselproblem des Kleistschen Werks: demjenigen, was man seine »poetische Kasuistik« nennen könnte - die immer von neuem in seinen Texten inszenierte Erörterung des Konflikts zwischen Einzelnem und Ganzem, zwischen Fall und Gesetz. Die allen Beiträgen gemeinsame Interessenlage ist die der kulturellen Anthropologie und Semiotik: ausgerichtet auf die problematische Frage nach der gefährdeten Lage des Subjekts in den wechselnden Legitimationsfeldern der Rechtsphilosophie, der Physiologie und Psychologie, der Psychoanalyse, der Mythologie, der Bildenden Kunst und der Zeichenordnung der Musik.
33 Stenogramme um einen Mord