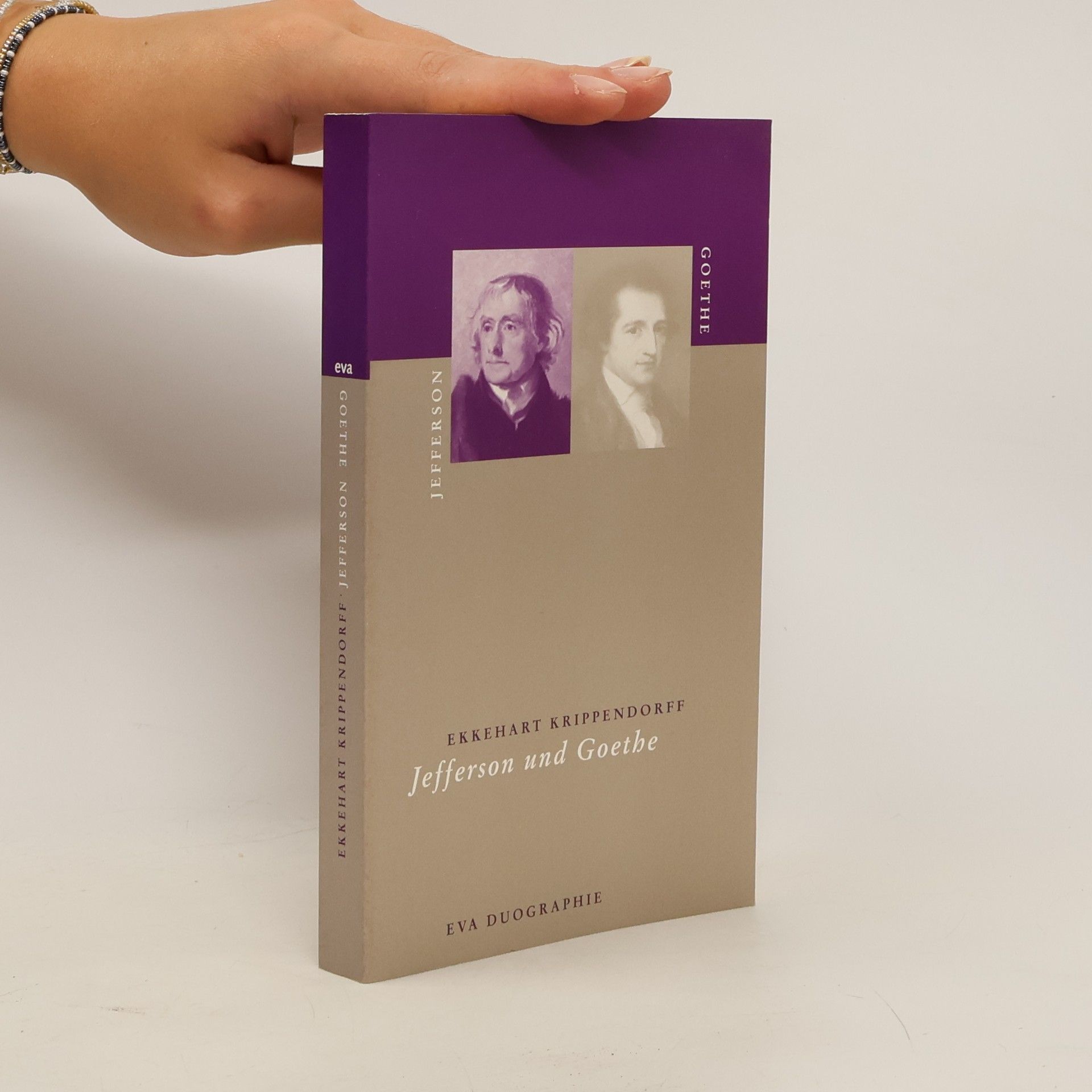Theaterkritiken sind kein literarisches Genre wie der Essay, die Erzählung oder gar der Roman – allenfalls Rezensionen haben mit ihnen etwas gemein. Theaterkritiken sind aber flüchtiger und überleben selten ihren angestammten Erscheinungsort, die Tages- oder Wochenzeitung. Selten tragen sie den Mantel des Zeitungslesers vom übernächsten Tag und ebenso selten treten sie auf die Bühne der Öffentlichkeit mit dem Anspruch, von späteren Lesern und Leserinnen noch wahrgenommen zu werden. Solche Kritiken stellen bisweilen literarische Ansprüche „über den Tag hinaus“. Um solche geht es bei der hier getroffenen Auswahl aus rund dreißig Bühnenbesprechungen aus fünfundzwanzig Jahren überwiegend Berliner Inszenierungen und einigen wenigen, aber nichtsdestoweniger einschlägigen anderen Beispielen. Der Autor hat nicht den Ehrgeiz, Maßstäbe kritischen Theaters zur Diskussion zu stellen, wohl aber Maßstäbe für die Theaterkritik und sehr wohl der politischen Thematik bekannter oder weniger bekannter klassischer Stücke aktuelles Gehör zu verschaffen – auch insofern also: „Über den Tag hinaus“.
Ekkehart Krippendorff Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)


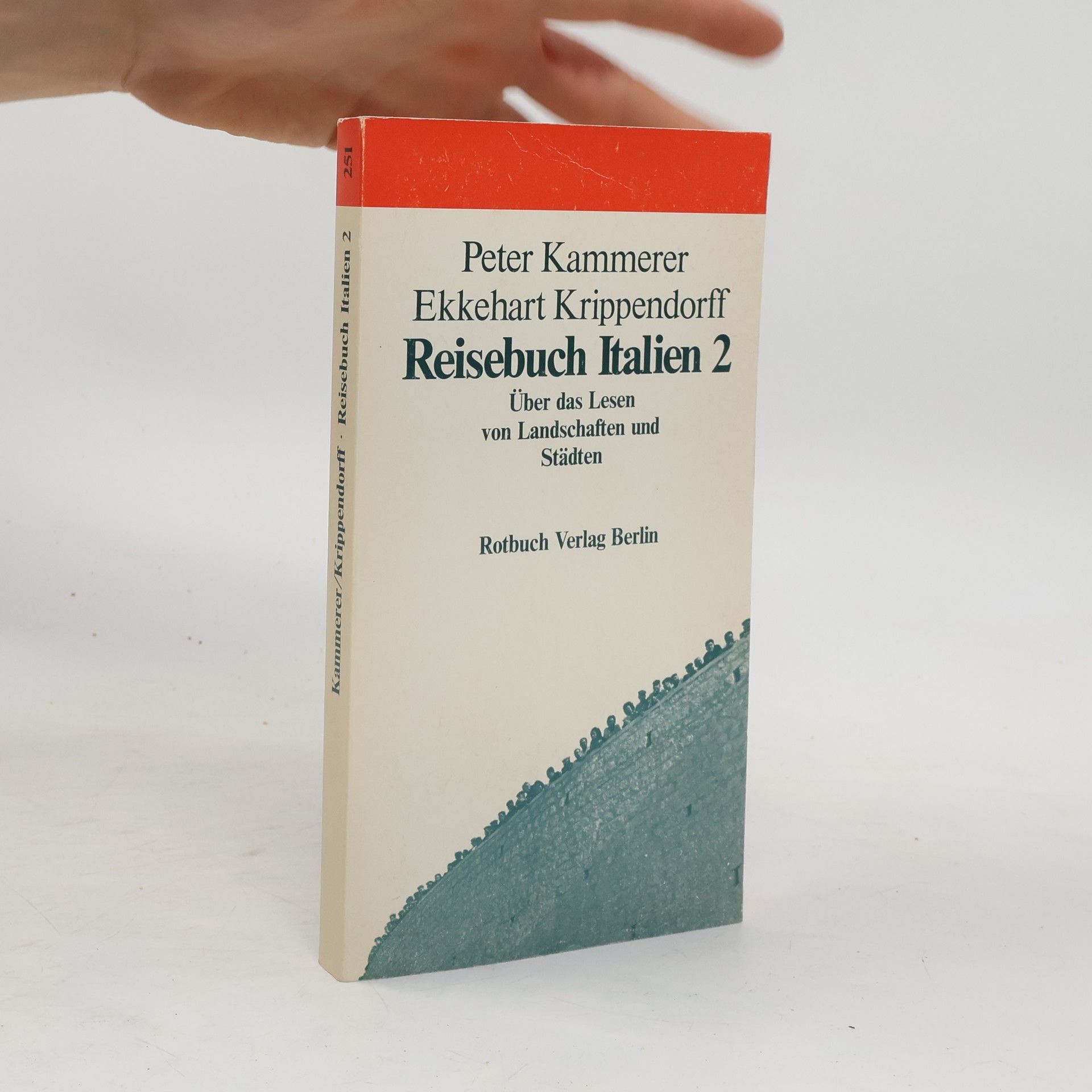

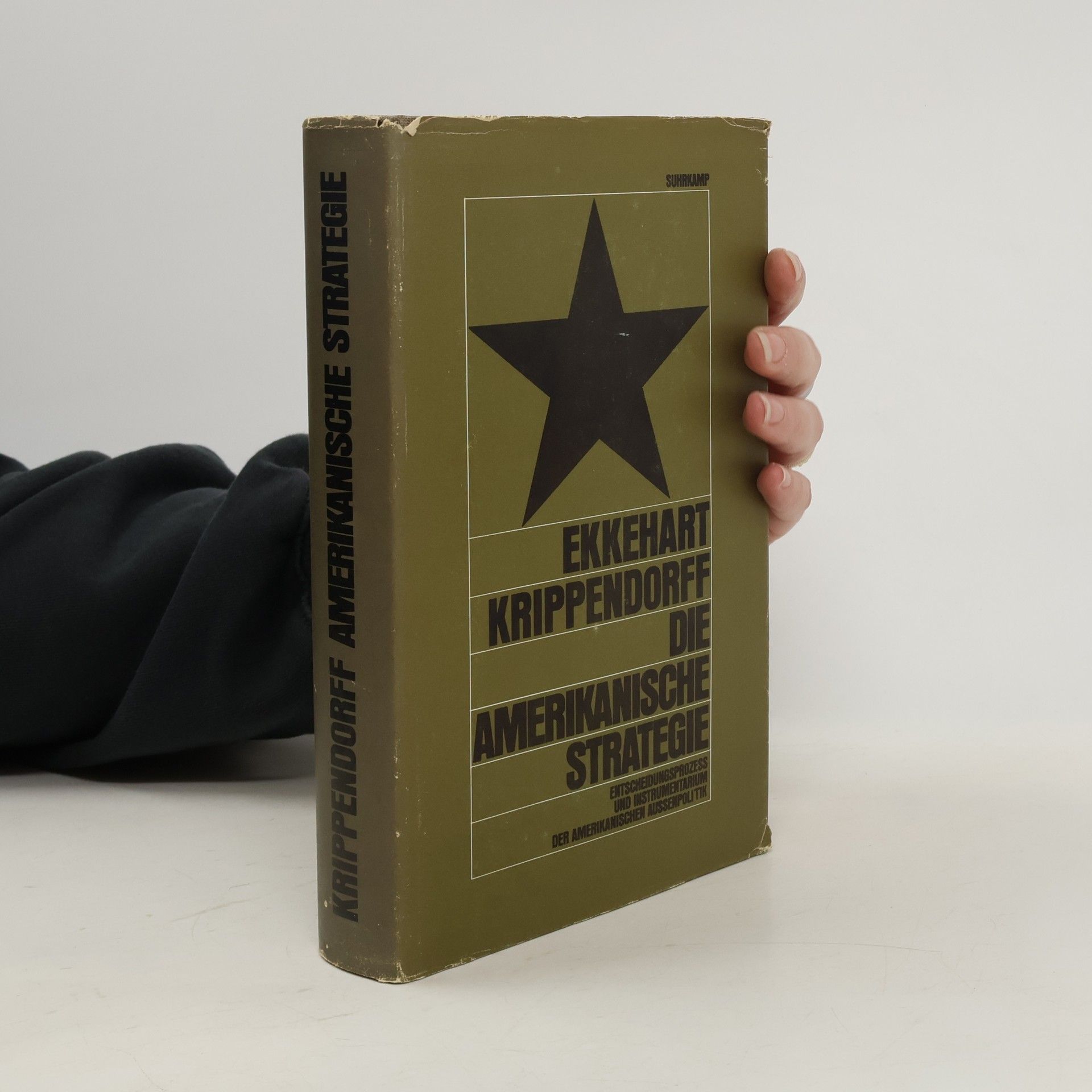

Ekkehart Krippendorff, geboren 1934 und emeritierter Professor der Freien Universität Berlin, gilt als erster politikwissenschaftlicher Student und Promovend in Deutschland. Er erlebte die letzten Kriegsjahre als Kind und war von 1960 bis 1963 als Fulbright-Stipendiat Zeuge der Aufbruchsjahre in den USA. Als Mitbegründer der deutschen Friedensforschung und Sprecher der Studentenbewegung ab 1965 prägte er die politische Landschaft. In den 1970er Jahren lehrte er in Italien und erlebte das „rote Bologna“. Seine historisch-systematische staatskritische Monographie „Staat und Krieg“ beeinflusste soziale Protestbewegungen und kritisierte Militär und Außenpolitik. Später wandte er sich der Literatur zu und verfasste zwei Monographien über Shakespeare sowie zahlreiche Theaterkritiken. Inspiriert von Goethe, entblätterte er sein Leben thematisch und teilte es als Erzählungen mit. Krippendorff entdeckte, dass sein Leben aus verschiedenen Fäden besteht, die Notwendiges und Zufälliges miteinander verweben. Aus seinen Erinnerungen entstanden zehn in sich geschlossene, aber auch „durcheinandergeschränkte“ Autobiographien, die Themen wie Krieg, Theater, Universitäten, Nazismus, Amerika, Juden, Italien, DDR, Musik und Religion behandeln. Ein historischer Epilog beleuchtet seine Familiengeschichte als Mikro-Spiegel deutscher Geschichte.
Die Kultur des Politischen
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden
Mythologie und Literatur, Musik und Theater, Goethe, Shakespeare und die indische Bhagavadgita sind einige der Themen, mit denen versucht wird, unser zur Herrschaftsanalyse verkümmertes Verständnis von Politik aber auch die dafür zuständige akademische Disziplin daran zu erinnern, dass die Politik eine kulturelle Dimension hat, die Wege aus der zerstörerischen Macht- und Realpolitik bereithält. Spannende Entdeckungen sind da zu machen
Die Stoffe der Tragödien stammen aus der Wirklichkeit, während der Komödiendichter seine Figuren aus der Phantasie und den Beziehungen ihrer Gesellschaft erschafft. Diese Erfindungen repräsentieren eine Welt der Möglichkeiten, die noch nicht realisiert sind. In den Figuren von Shakespeare, die Goethe als „natürliche und doch geheimnisvollste Geschöpfe der Natur“ beschreibt, erreicht die Komödie ihre höchsten Gipfel. Für Hegel sind sie die Erfüllung der Weltgeschichte und bieten die schönste Seite der Erkenntnis. Jede Komödie Shakespeares hat ihre eigene poetische und dramaturgische Physiognomie, was eine spezifische Auseinandersetzung mit jedem Stück nahelegt. Dies belohnt die Leser mit tiefen Einsichten über das Menschliche, die nur die Dichtung vermitteln kann. Obwohl Shakespeare für die Bühne geschrieben hat, offenbart sich die komplexe Vieldimensionalität seiner Werke erst durch eine intensive Lektüre, die durch die Interpretationsliteratur unterstützt wird. Eine dieser Dimensionen ist die politische, die Politik nicht als Macht und Gewalt, wie in Tragödien und Historien, sondern als ein radikal anderes Verständnis im Reich der Freiheit transzendiert und überwindet.
Politologo tedesco, Krippendorff presenta dodici saggi su altrettante opere di William Shakespeare, dall'Amleto al Re Lear, al Macbeth. In ciascuno di essi, con la sua caratteristica chiarezza, passione e precisione, Ekkehart Krippendorff analizza ciò che dell'opera in questione è ancor oggi prezioso per comprendere i meccanismi del potere. Per Krippendorff, infatti, la produzione drammatica di Shakespeare è un pozzo inesauribile di intuizioni in campo politico e i suoi testi offrono risposte inedite e illuminanti a domande sempre diverse, comprese le più complesse e attuali, in particolare riguardo alla questione del sempre difficile rapporto fra governanti e governati.
Goethe - Theaterarbeit
- 223 Seiten
- 8 Lesestunden
Im Jahr 1776 entschied sich Goethe, in Weimar zu bleiben und dort aufklärend zu „regieren“, was auch das Theater zu seinem Bildungsprojekt umfasste. Zunächst als „Liebhabertheater“ gegründet, engagierte er die Star-Schauspielerin Corona Schröter und übertrug das Theater einer privaten Schauspieltruppe. 1791 wurde das Herzogliche Hoftheater gegründet, dessen Direktor Goethe für 26 Jahre war. In dieser Zeit verantwortete er über viertausend Aufführungen, förderte insbesondere die Opern seines Zeitgenossen Mozart und kümmerte sich aktiv um die Ausbildung der Schauspieler. Goethe war ein engagierter Direktor, der auch Prologe und Epiloge schrieb, Theaterarchitektur entwarf und intensiv mit seinen Schauspielern probte. Sein gesellschaftspolitisches Engagement umfasste eine „theatralische Sendung“, die Aufklärung und Bildung des öffentlichen Bewusstseins fördern sollte. Er sah das Theater als Mittel zur Ausbildung des Urteils, wobei er betonte, dass das Publikum mit Respekt behandelt werden müsse. Die hier zusammengestellten Texte, die Aufsätze, Gedichte und Berichte über die Probenarbeit umfassen, sind angesichts der heutigen Herausforderungen im Theater von großer Aktualität. Sie zeigen Goethes hohe Ansprüche an Theatermacher und Publikum und bieten neue Perspektiven auf seine theaterpädagogischen Ansichten. Peter Stein hat ein Geleitwort zu diesem Werk verfasst.
Goethe-Blätter
Schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft Siegburg e.V., Band II/2002
- 124 Seiten
- 5 Lesestunden