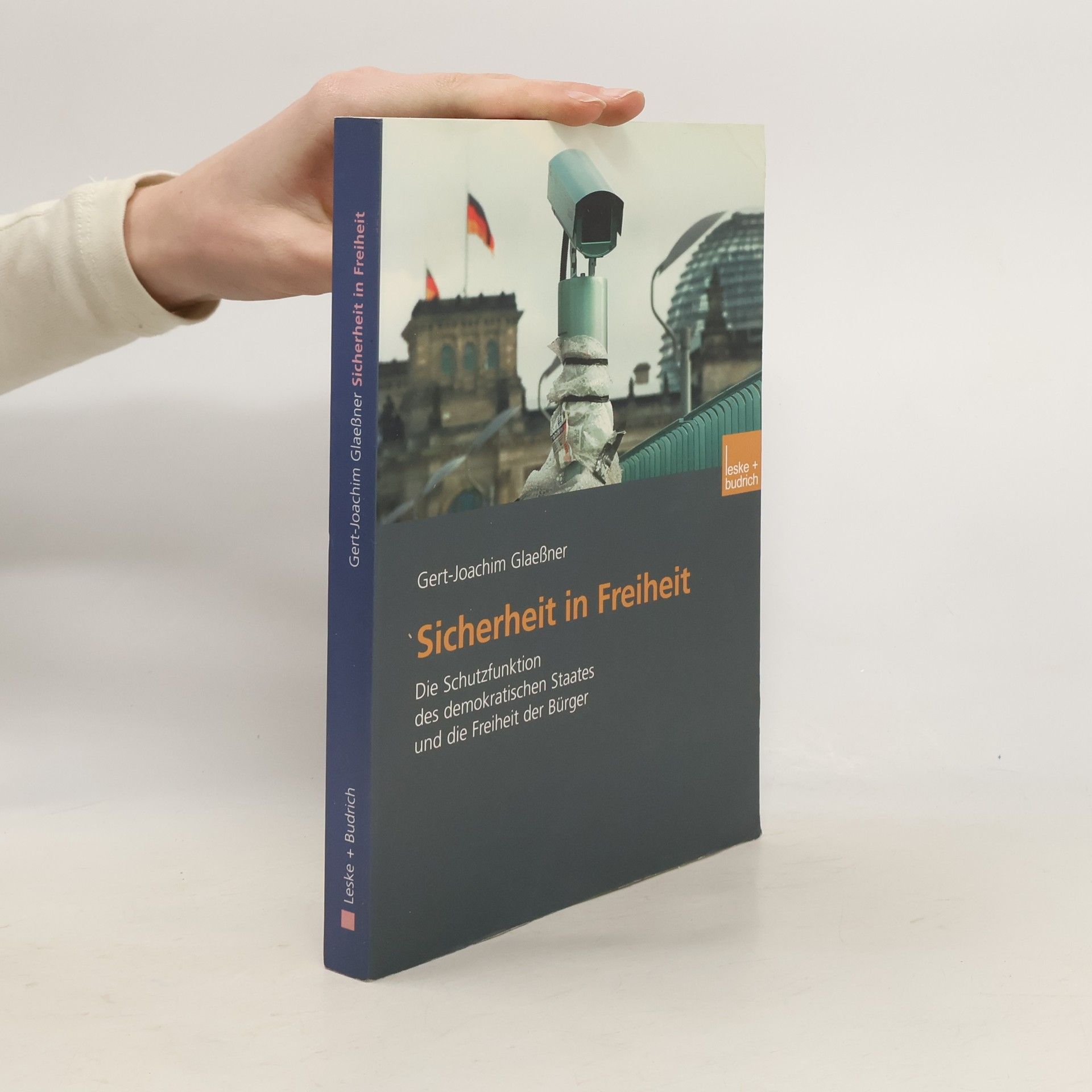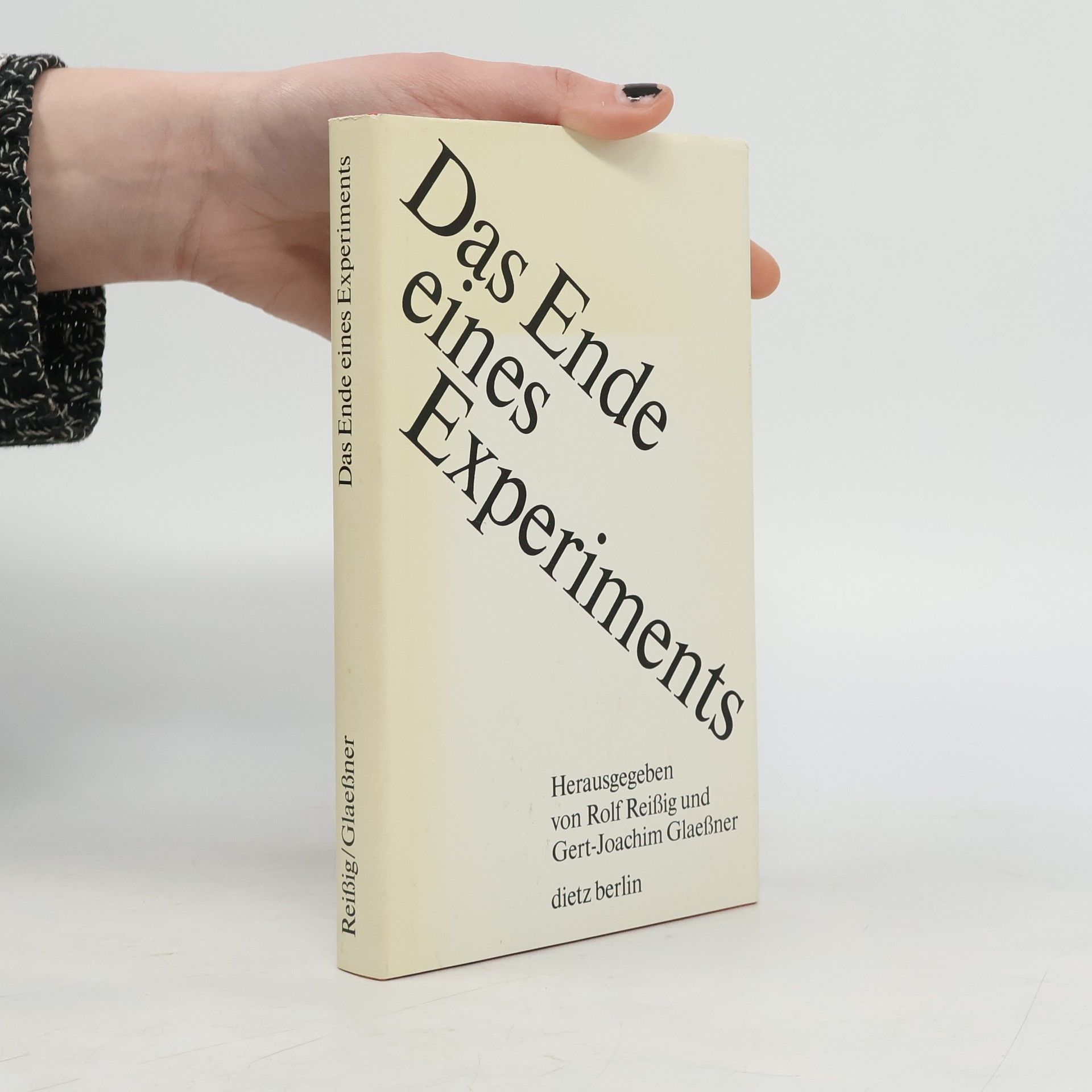Gert Joachim Glaeßner Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
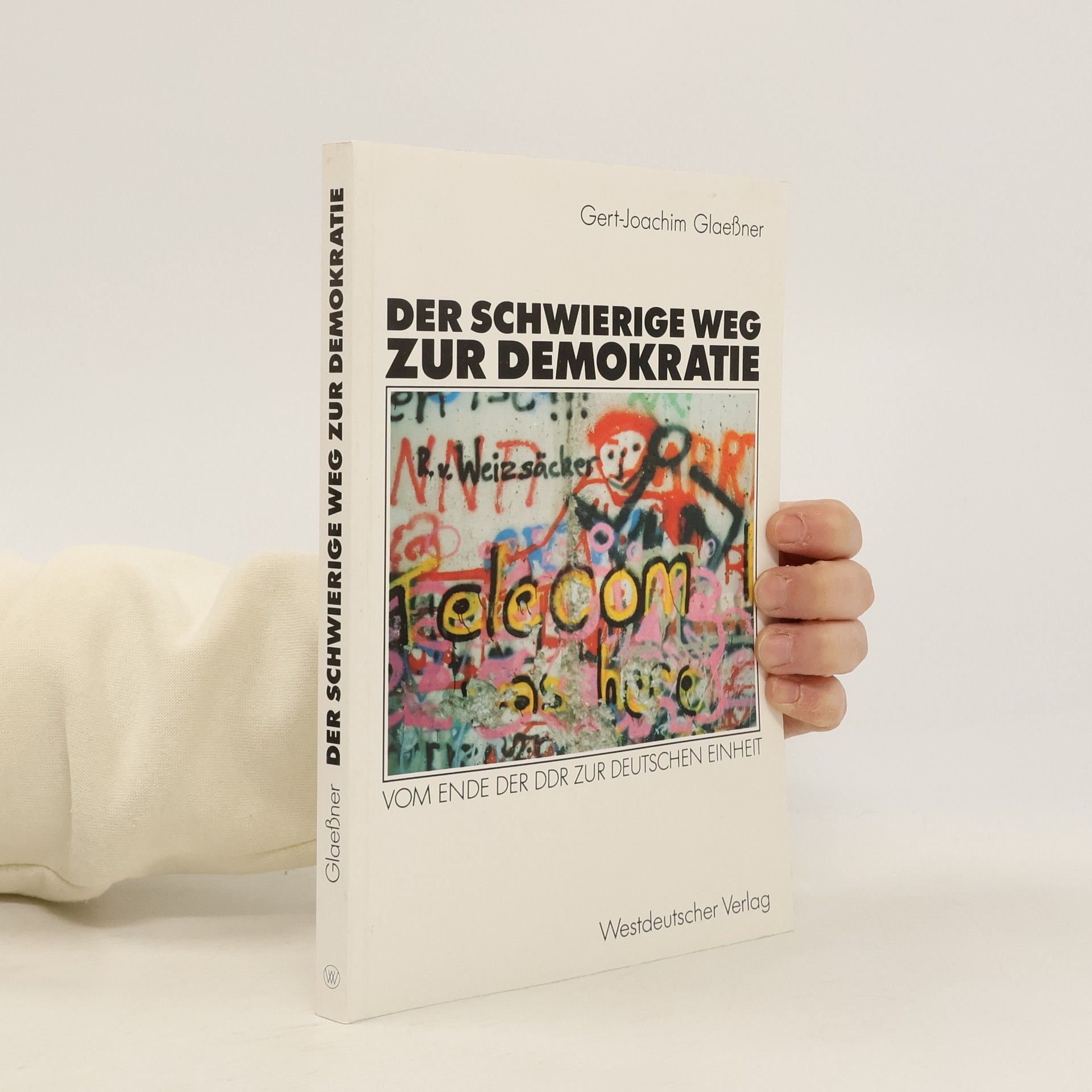
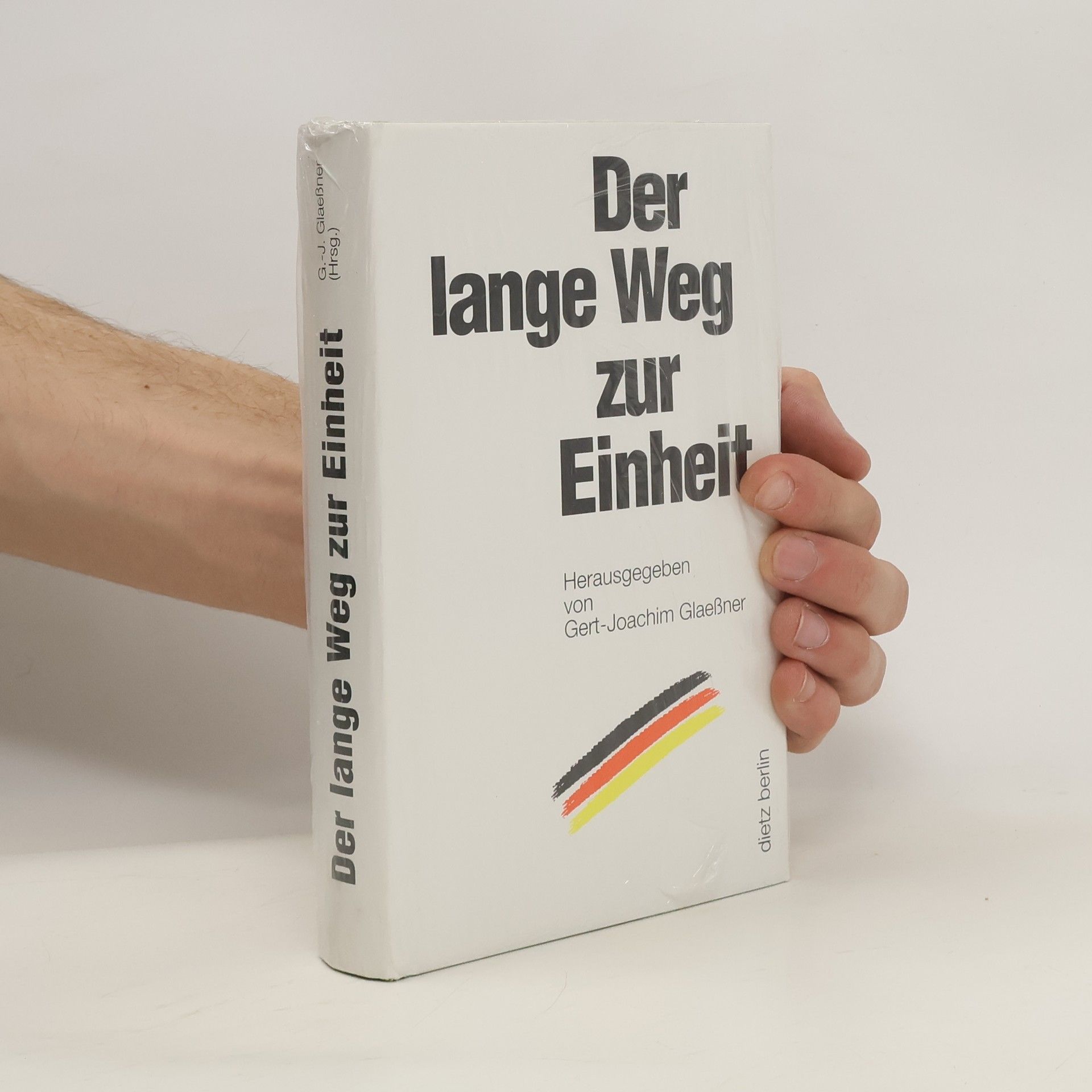
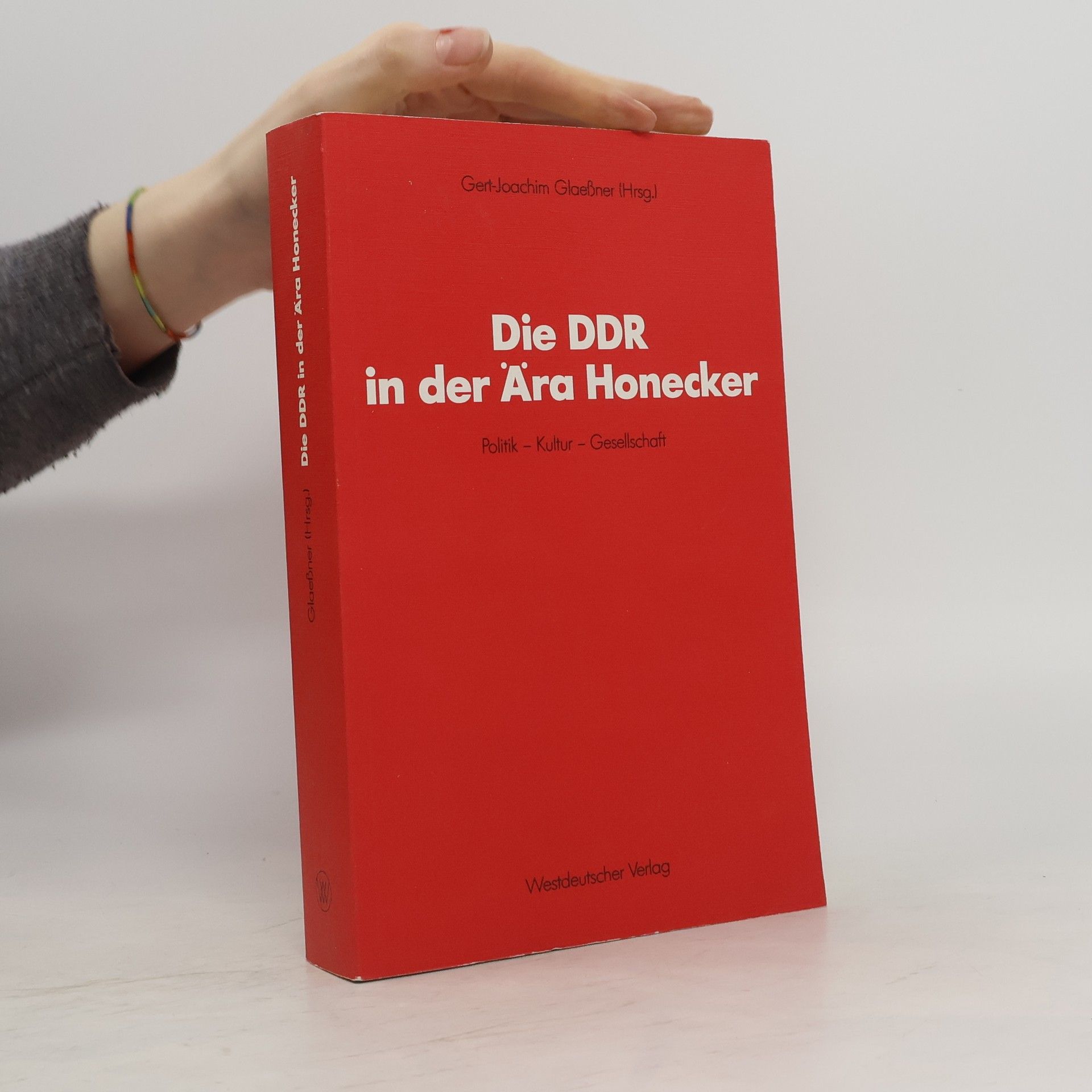
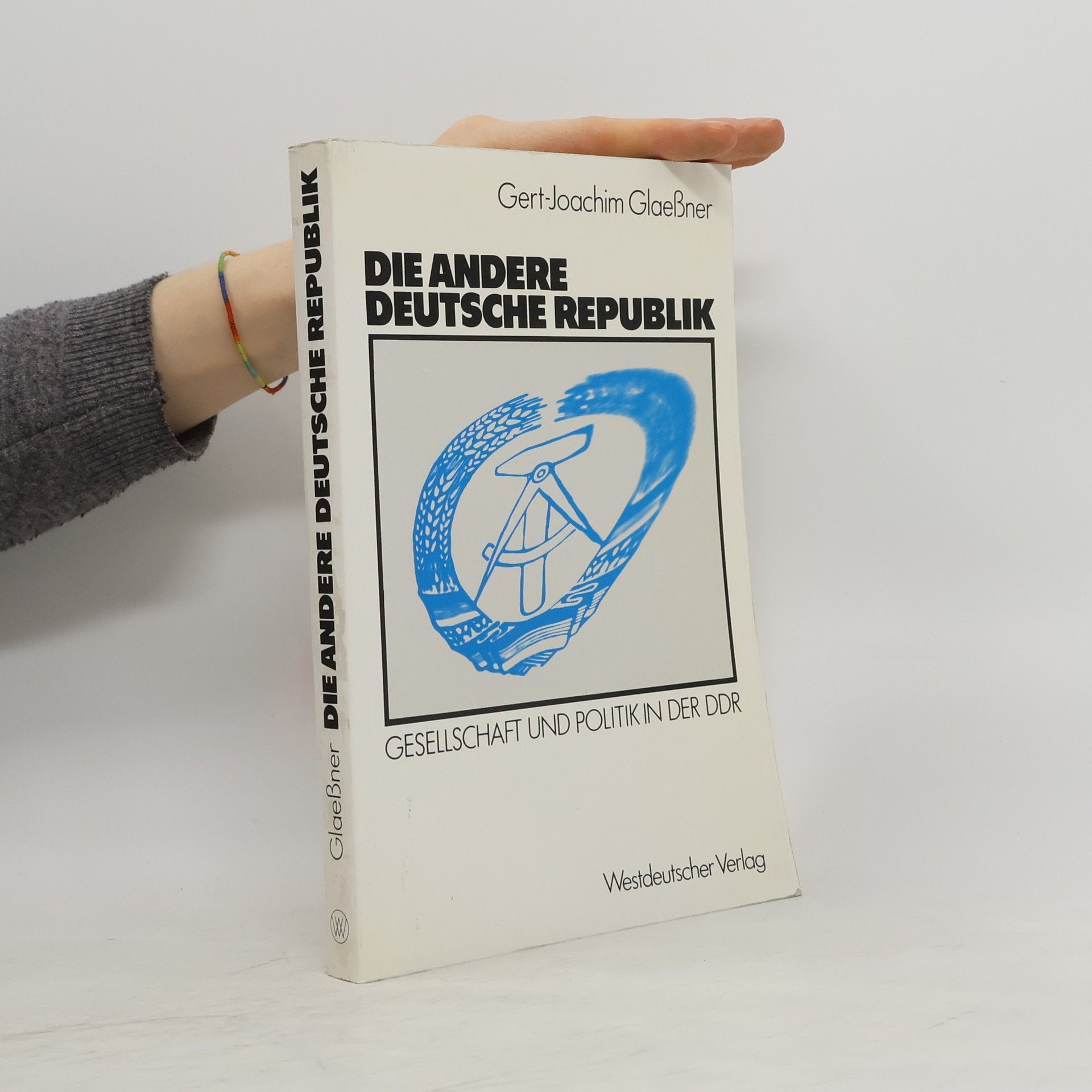

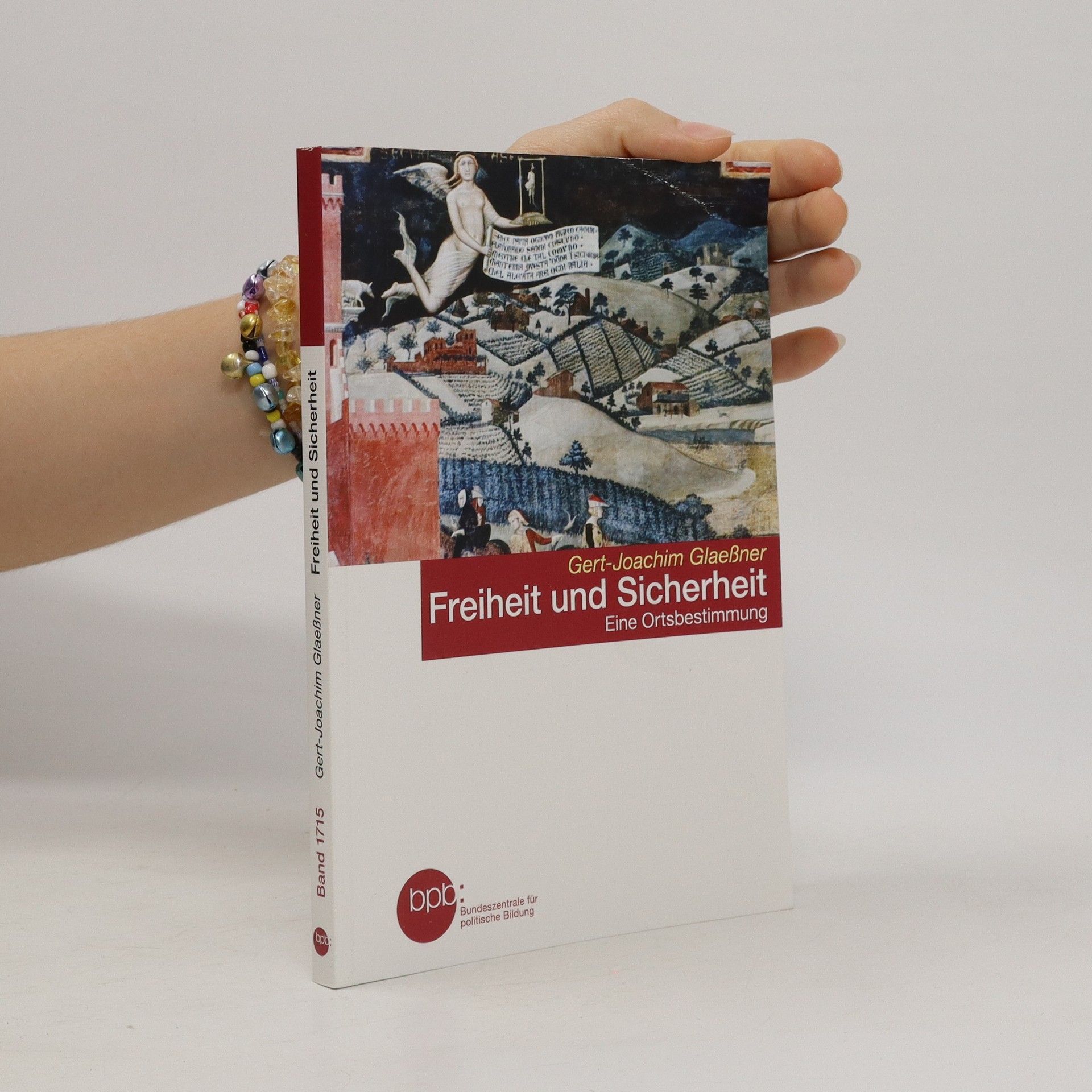
Sicherheit in Freiheit
Die Schutzfunktion des demokratischen Staates und die Freiheit der Bürger
- 293 Seiten
- 11 Lesestunden
Das Buch untersucht Grundlagen, Entwicklung und Aktualität von Sicherheitsvorstellungen, Staatsschutz und innerer Sicherheit und die Terrorismusbekämpfung in den USA, Großbritannien und der Bundesrepublik. Sicherheit zu gewährleisten ist von Alters her die Aufgabe der staatlichen Ordnung. Diese Aufgabe rechtfertigt die Ausstattung des Staates mit besonderen Machtmitteln und sein Monopol auf legitime Gewaltausübung. Die gängige Gegenüberstellung von Sicherheit und Freiheit als unvereinbare kollektive Güter und eine Prioritätensetzung zu Gunsten des einen, zu Lasten des anderen führt nicht weiter. Es kommt darauf an, den widersprüchlichen Verhältnissen beider „Staatsaufgaben“ nachzugehen.
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie
- 279 Seiten
- 10 Lesestunden
Die säkulare Herausforderung durch den Sozialismus sowjetischen Typs ist überwunden, doch sein Erbe bleibt relevant. Nach dem Ende des Kommunismus in der Sowjetunion und den von ihr dominierten Ländern Europas stellen sich viele Fragen, die in diesem Buch behandelt werden. Ist eine Revision unseres Bildes vom Kommunismus, wie er in der UdSSR und den sozialistischen Ländern wirkte, notwendig? Waren die analytischen Maßstäbe und theoretischen Modelle angemessen? Wie sind die Ergebnisse der umfangreichen Auseinandersetzung mit dem Kommunismus aus der heutigen Perspektive zu bewerten? Inwieweit beeinflusste die politische Konfrontation zwischen den Systemen das Denken und die Argumentation? War eine objektive Betrachtung des Kommunismus möglich, sinnvoll und angemessen? Welche 'legacies' des alten Systems bestehen und welche Chancen haben die neuen Demokratien in den ehemaligen sozialistischen Ländern, angesichts des Erbes des Kommunismus? Welche Konsequenzen hatte die Konfrontation der Systeme und welche Auswirkungen hatte das Feindbild des Kommunismus auf die demokratischen Strukturen, insbesondere auf die Demokratien im Westen?
Das Ende eines Experiments
- 357 Seiten
- 13 Lesestunden
Book by
Der schwierige Weg zur Demokratie
Vom Ende der DDR zur deutschen Einheit
Das Jahr 1989 markiert eine historische Wende. Die sozialistischen Systeme in Osteuropa brachen innerhalb weniger Monate zusammen. Die DDR, der langjährige "Vorposten" des sowjetischen Imperiums, überlebte diesen revolutionären Umbruch nur ein Jahr. Die Einheit Deutschlands, an die kaum noch jemand geglaubt hatte, wurde Wirklichkeit.Dieses Buch untersucht die Ursachen für den Zusammenbruch und Sturz des politischen Systems in der DDR und beschreibt den komplizierten und widerspruchsvollen Weg des Übergangs zur Demokratie. Neben den inneren Aspekten werden auch die europäischen Konsequenzen des Weges zur staatlichen Vereinigung Deutschlands dargestellt und analysiert. Besondere Beachtung wird schließlich den Problemen des sozialen und kulturellen Zusammenwachsens zweier höchst unterschiedlicher Teilgesellschaften gewidmet."(...) Das Buch zeichnet sich durch wissenschaftlich genaue Recherche und trotz seiner Aktualität durch eine erstaunliche Distanz aus."Süddeutsche Zeitung, 20.11.1992
Die andere deutsche Republik
Gesellschaft und Politik in der DDR
InhaltsverzeichnisI. Die DDR als Forschungsgegenstand — Methoden, Probleme, Perspektiven.1. Entwicklung der DDR- und Kommunismusanalyse.2. Das Zauberwort „Modernisierung“.3. Konvergenz der Systeme?.4. Renaissance des Marxismus.5. Probleme und Perspektiven der Forschung.II. Historische, ideologische und rechtliche Grundlagen des politischen und gesellschaftlichen Systems.1. Kontinuität und Wandel — Entwicklungslinien und Krisen in der Geschichte der DDR.Exkurs: Deutschlandpolitik und deutsch-deutsche Beziehungen.2. Ideologische Grundlagen der Politik der SED.3. Rechtliche Grundlagen der DDR-Gesellschaft.III. Das politische System — Struktur und Funktionsweise.1. Die SED.2. Staat und Staatsapparat.3. Volksvertretungen und Nationale Front.4. Die Massenorganisationen.Exkurs: Die Kirchen.5. Agitation und Propaganda.Zwischenresümee.IV. Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik.1. Die Struktur der DDR-Volkswirtschaft.2. Das Planungssystem.3. Die DDR-Wirtschaft im RGW.4. Die Wirtschaftspolitik der SED — Probleme und Perspektiven.V. Bildung, Wissenschaft und Kultur.1. Das Bildungssystem.2. Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsorganisation.3. Soziokulturelle, sozialstrukturelle und politische Ergebnisse der Wissenschafts- und Bildungspolitik der SED.4. Zielkultur ohne Ziele: Aspekte der politischen Kultur.Bibliographie.
InhaltsverzeichnisVorbemerkung.I: Deutsche Frage und deutsche Nation. Der begrenzte Blick: Ein Erfahrungsbericht zur Wahrnehmung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Offene deutsche Fragen: Schwierigkeiten der gegenseitigen Anerkennung. „Koexistenz auf deutsch“: Aspekte der deutsch-deutschen Beziehungen 1970-1987. Sozialistischer Neohistorismus? Identitätsdebatte in der DDR. Suche nach Madame L’Identité: Konzeption von Nation und Nationalgeschichte. Zwei Deutschlands – zwei Identitäten? Deutsche Identität in der Bundesrepublik und der DDR. II: Die DDR als sozialwissenschaftliches Forschungsfeld. Herausforderungen der DDR-Forschung in der Bundesrepublik. Totalitarismus-Debatte unter Hannah Arendt und Peter Christian Ludz. Kommunismus- und DDR-Forschung in den USA und Großbritannien. Politische Kultur und Stabilität in der DDR. III: Entwicklungstendenzen des politischen Systems. „Neues Denken“ in der Systemkonkurrenz. Eigenständigkeit im Dienste des Status quo. Machtverteilung und Partizipation in der DDR. Wandlungen im Selbstverständnis der SED unter Honecker. IV: Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die DDR-Wirtschaft in der Honecker-Ära. Soziale Sicherheit und sozialistische Sozialpolitik. V: Soziale Problemlagen. Jugendpolitik und kritische Bilanz. Frauen und Technik in der DDR. Zwischenmenschliche Entfremdung. VI: Bildung und Wissenschaft. Bildungswesen seit 1970. Hochschulbildung in der SED-Strategie. Pluralis