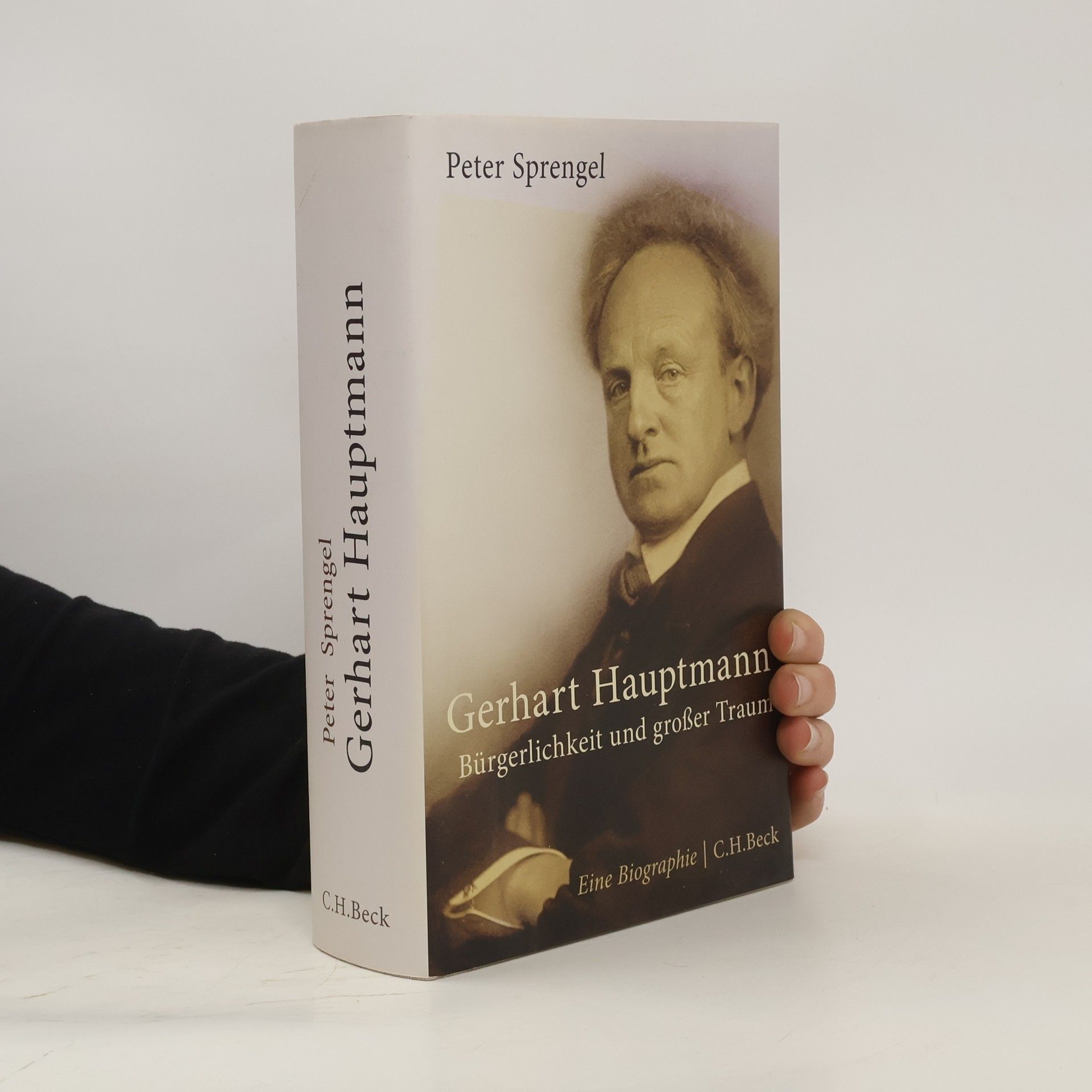Unbekannte Briefe zeigen einen Schweizer in Berlin um 1810, der als Gast bei Rahel Levin und Schüler Schleiermachers auf dem Weg in den Wahnsinn ist. Nikolaus Harscher aus Basel studierte Medizin in Halle und schloss sich dort den neuberufenen Romantikern Schleiermacher und Steffens an. 1806 lernte ihn Karl August Varnhagen kennen, der Harscher als brillanten Dialektiker beschreibt, aber auch auf sein körperliches Leiden und seine Neigung zur Melancholie und einem erdrückenden Schuldbewusstsein hinweist. Nach der Schließung der Universität Halle folgt Harscher seinem Freund nach Berlin, wo er eine komplizierte Beziehung zu Rahel Levin entwickelt und zeitweise mit Schleiermachers Halbschwester Nanny verbunden ist. Ein Höhepunkt sind die erstmals veröffentlichten Briefe Harschers, in denen die Ich-Krise des romantischen Subjektivismus einen eigenwilligen sprachlichen Ausdruck findet. Die Briefe über den Besuch der Dresdner Gemäldegalerie dokumentieren eine unmittelbar vor dem Zusammenbruch stehende romantische Kunstbegeisterung. Harscher, aus wohlhabender Basler Familie, studierte in Basel und Halle und nahm engen Kontakt zur romantischen Bewegung auf. Sein Rückgang nach Basel 1818 und die zunehmende Gemütsverdüsterung führten zu zahlreichen vergeblichen Kuraufenthalten in Baden/Aargau.
Peter Sprengel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)






Wer schrieb "Die wandernde Barrikade"?
Heinrich Loose - Edmund Märklin Ludwig Pfau - Johannes Scherr und die südwestdeutsche Revolution 1849. Mit Textedition und Dokumenten
- 362 Seiten
- 13 Lesestunden
Im Kontext der gescheiterten Märzrevolution thematisiert das anonym veröffentlichte Werk die radikalisierte demokratische Bewegung im deutschen Südwesten im Jahr 1849. In rund viertausend Versen wird satirisch das Scheitern der Revolution in der Pfalz, Württemberg und Baden beleuchtet. Die kommentierte Edition bietet nicht nur Einblicke in die politischen Verfolgungen und die Not des Exils, sondern diskutiert auch die unklare Autorschaft des Textes. Diese Aspekte machen das Buch zu einer wichtigen Quelle für das Verständnis der damaligen politischen Lage und der sozialen Forderungen.
Karl August Varnhagen und Charlotte Williams Wynn
Eine deutsch-englische Briefliebe um 1850
Anhand kürzlich entdeckter Manuskripte wird die langjährige Brief-Beziehung des Rahel-Witwers zu einer lesehungrigen jüngeren Engländerin dargestellt. Drei Jahre nach dem Tod seiner Frau Rahel Levin lernt der Schriftsteller, Kritiker, Sammler und ehemalige Diplomat Varnhagen von Ense eine 22 Jahre jüngere Engländerin kennen, mit der er bis zu seinem Lebensende in engem brieflichen Kontakt steht und die er fast geheiratet hätte. Hunderte von Briefen, die unlängst aus britischem Privatbesitz aufgetaucht sind, zeichnen das berührende Bild einer interkulturellen Begegnung und eines besonderen Deutschunterrichts. Denn die walisische Landadelige Charlotte Williams Wynn lernt von Varnhagen und um seinetwillen Deutsch. Sie trainiert ihre Sprachkompetenz, von zahlreichen Buchpaketen aus Berlin unterstützt, in exzessiver Lektüre, die auch vor Kant und Hegel nicht Halt macht. Die Tochter eines langjährigen Unterhausmitglieds zeigt gleichzeitig reges Interesse an politischen Fragen, auch als Augenzeugin des Pariser Staatsstreichs 1851. Schließlich gibt die Geschichte dieser brieflichen Liebesbeziehung Einblick in die Übergangsepoche zwischen Biedermeier und Nachmärz: in Briefkultur, in Bädermedizin, in eine halbherzige Revolution, den Fahrplan der Rheindampfer und die ersten Beschleunigungseffekte der Eisenbahn.
Die gescheiterte Revolution von 1848/49 bildet den zentralen Punkt dieser Literaturgeschichte, die die Spannungen zwischen Protest und Resignation in der deutschsprachigen Literatur zwischen der Juli-Revolution 1830 und der Gründung des Deutschen Reiches 1870/71 beleuchtet. Peter Sprengel analysiert den Übergang von der klassisch-romantischen Kunstperiode über das Junge Deutschland und die Krisenliteratur der 1840er Jahre bis hin zum Bürgerlichen Realismus. Die Darstellung zeigt die komplexen Entwicklungen und kulturellen Strömungen dieser prägnanten Epoche.
Rudolf Borchardt war nicht nur ein virtuoser Sprachkünstler, dem tiefsinnige Gedichte, brillante Essays, ironisch-satirische Erzählungen und Reden von sensationeller Wirkung gelangen. Er war auch ein zutiefst politisch empfindender Mensch, der aus dem „Untergang der deutschen Nation“ persönliche Konsequenzen zog und – mit der großen Ausnahme des Ersten Weltkriegs – schon früh aus dem Vaterland ausstieg. Als Mieter alter Toskana-Villen erprobte der Emigrant und Monarchist – bis zur gewaltsamen Rückführung in das Deutsche Reich 1944 – den Anschluss an althergebrachte aristokratische Lebensformen. Gleichzeitig war er als Übersetzer (vor allem Dantes) um die Rettung des kulturellen Erbes Alteuropas bemüht. Seine Beschreibungen italienischer Städte geben das Bild einer imaginären Geschichte, einer Geschichte der unrealisierten Möglichkeiten, in der die Verlierer zu Siegern werden. Die hier vorgelegte Biographie kann auf Hunderte von Briefen zurückgreifen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erstmals herausgegeben wurden, und nutzt darüber hinaus unveröffentlichte Materialien. Auf dieser Grundlage gelingen überraschende Entdeckungen wie die einer monströsen Fälschung Borchardts. Hier lernen wir nicht nur den Dichter und Publizisten gleichsam von innen, sondern auch den ‚verlorenen Sohn‘, Ehemann und Familienvater, vor allem aber und immer wieder den Liebhaber Borchardt kennen.
Der Streit um die Weber machte ihn zum bekanntesten Deutschen seiner Generation: Gerhart Hauptmanns (1862-1946) Ruhm überdauerte den Zweiten Weltkrieg und sicherte noch dem Verstorbenen eine Ausreise per Sonderzug aus dem inzwischen polnischen Schlesien sowie die Beteiligung führender SED-Politiker an seiner Bestattung auf Hiddensee. Die erste konsequent aus Originalquellen gespeiste Biographie Gerhart Hauptmanns erzählt die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Gastwirtssohns aus dem schlesischen Salzbrunn, der auszog, um Monumentalbildhauer zu werden, und als größter Dramatiker des Naturalismus in die Literaturgeschichte einging. Dem Ruf einer moralischen Autorität, ja des Gewissens der Nation ist der vor 150 Jahren geborene Nobelpreisträger weder 1914 noch 1933 vollauf gerecht geworden. Dennoch ist Hauptmanns Leben von früh an durch moralischen Idealismus und den utopischen Traum einer besseren Welt geprägt, den er in leidenschaftlichen Liebesaffären zu verwirklichen suchte und in zahlreichen lyrischen und epischen Werken gespiegelt hat. Deren lebensgeschichtlicher Ort kommt hier ebenso zur Sprache wie die biographischen Voraussetzungen eines dramatischen Å’uvres, das an Umfang und Vielgestaltigkeit seinesgleichen sucht.
Der Dichter stand auf hoher Küste
- 382 Seiten
- 14 Lesestunden
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, hatte Gerhart Hauptmann den Höhepunkt seiner Schriftstellerkarriere überschritten. Sein bekanntestes Werk, das naturalistische Drama »Die Weber«, erschien 1892, und 1912 wurde er mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Trotz seines abnehmenden Schaffens blieb sein Ruhm ungebrochen; Thomas Mann bezeichnete ihn als den ungekrönten »König der Weimarer Republik«. Zu seinem 70. Geburtstag 1932 erhielt er höchste Ehrungen, und im Ausland galt er als Repräsentant der deutschen Literatur. Der Propagandaapparat der Nazis bemühte sich, Hauptmann für ihre Zwecke zu gewinnen, obwohl einige seiner Werke von Aufführungs- oder Nachdruckverboten betroffen waren. Sein 80. Geburtstag wurde mit nationalsozialistischem Pomp gefeiert. Hauptmanns Verhältnis zu den Nazis war jedoch ambivalent und schwankte zwischen Distanz und Offenheit für deren Angebote, was seine Rolle im Dritten Reich umstritten macht. Der Literaturwissenschaftler Peter Sprengel hat erstmals Hauptmanns Briefnachlass, private Aufzeichnungen und die Tagebücher seiner Frau Margarete ausgewertet. Er beleuchtet Hauptmanns mystisch-mythisches Weltbild sowie sein Umfeld, Freundschaften, Gegner und Kontakte zum neuen Regime, um ein umfassendes Bild seiner letzten Lebensphase zu zeichnen, die 1946 mit seinem Tod in Schlesien endet.
Reclams Universal-Bibliothek: Die Berliner Moderne, 1885-1914
- 640 Seiten
- 23 Lesestunden
German