Klaus Herding Bücher
27. Dezember 1939 – 26. August 2018
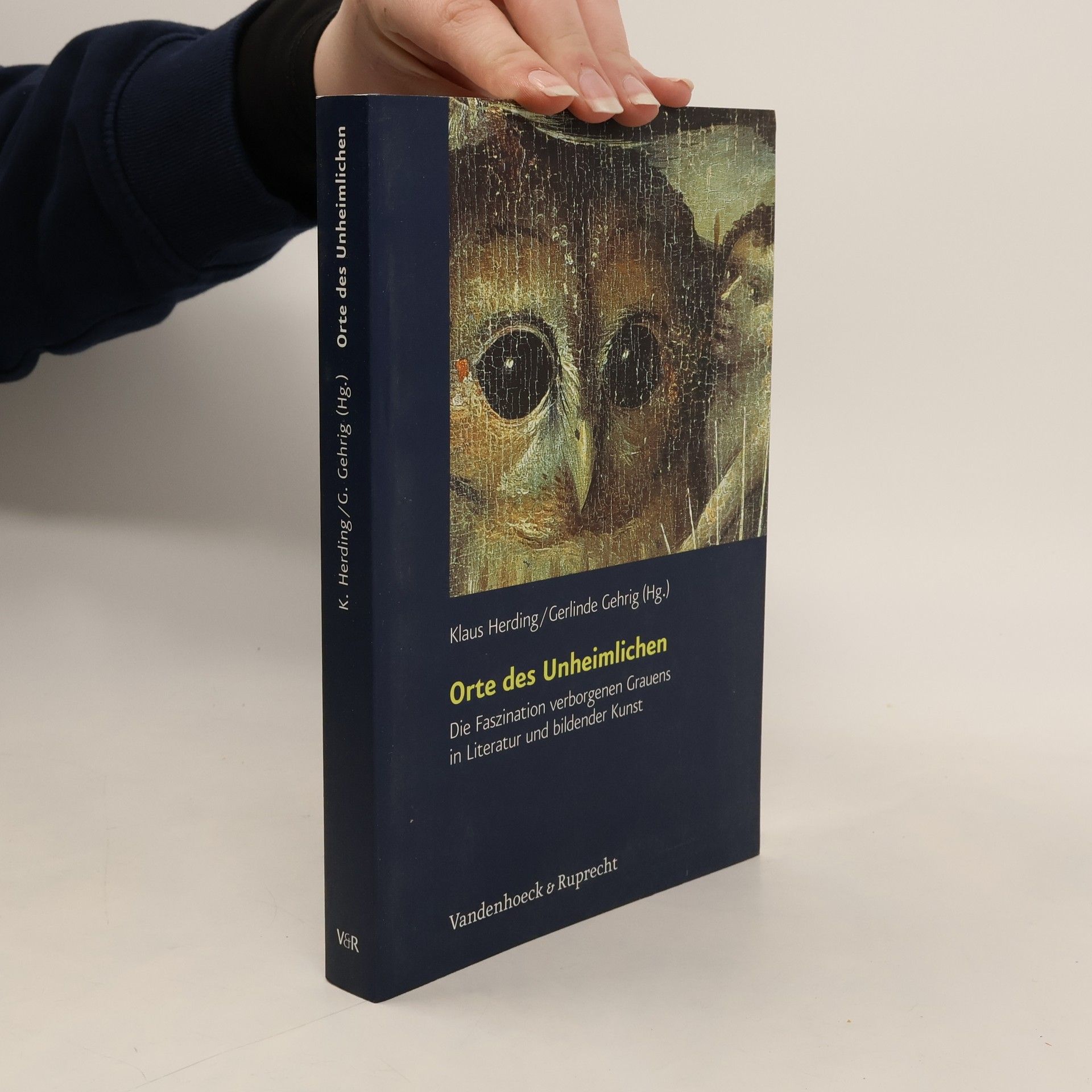
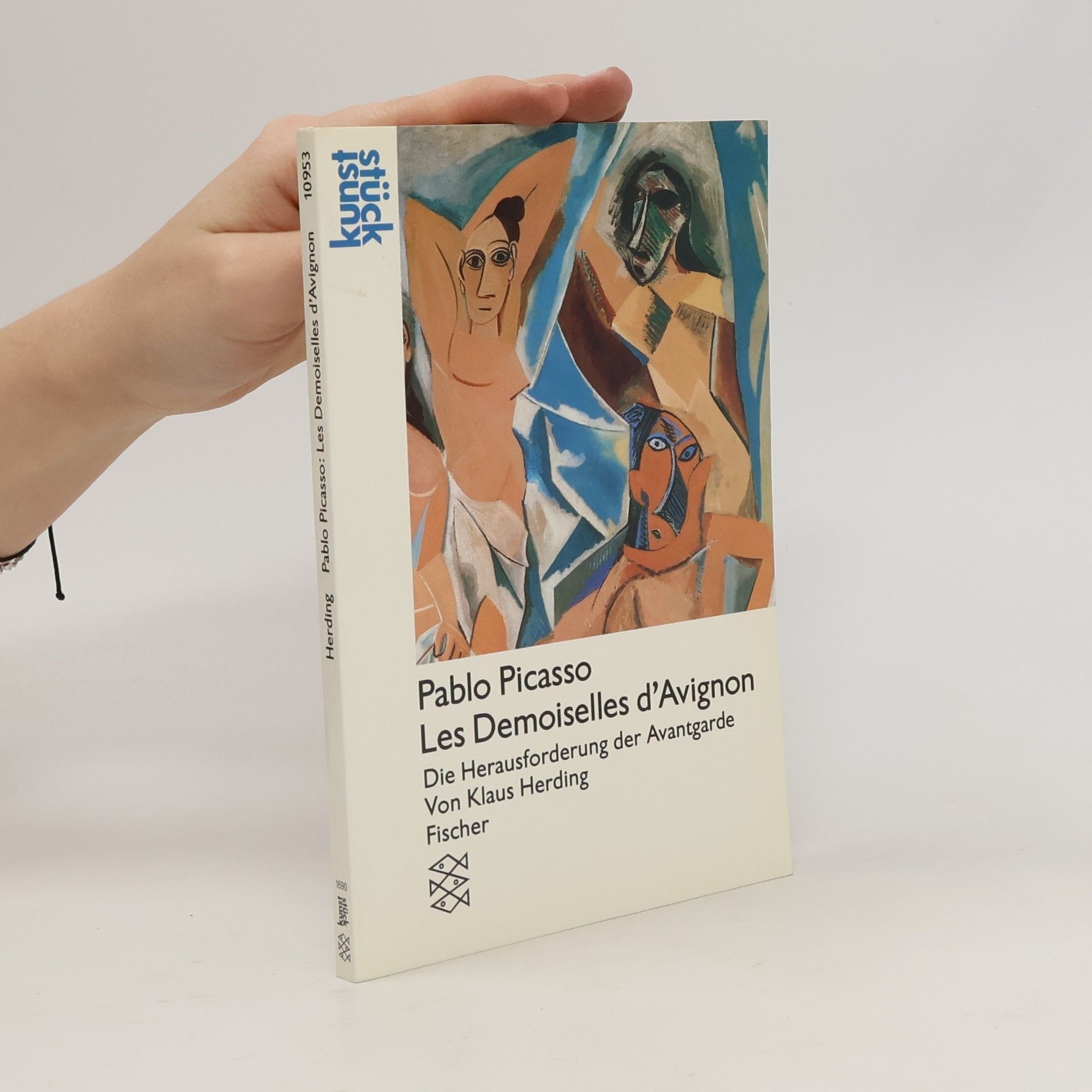
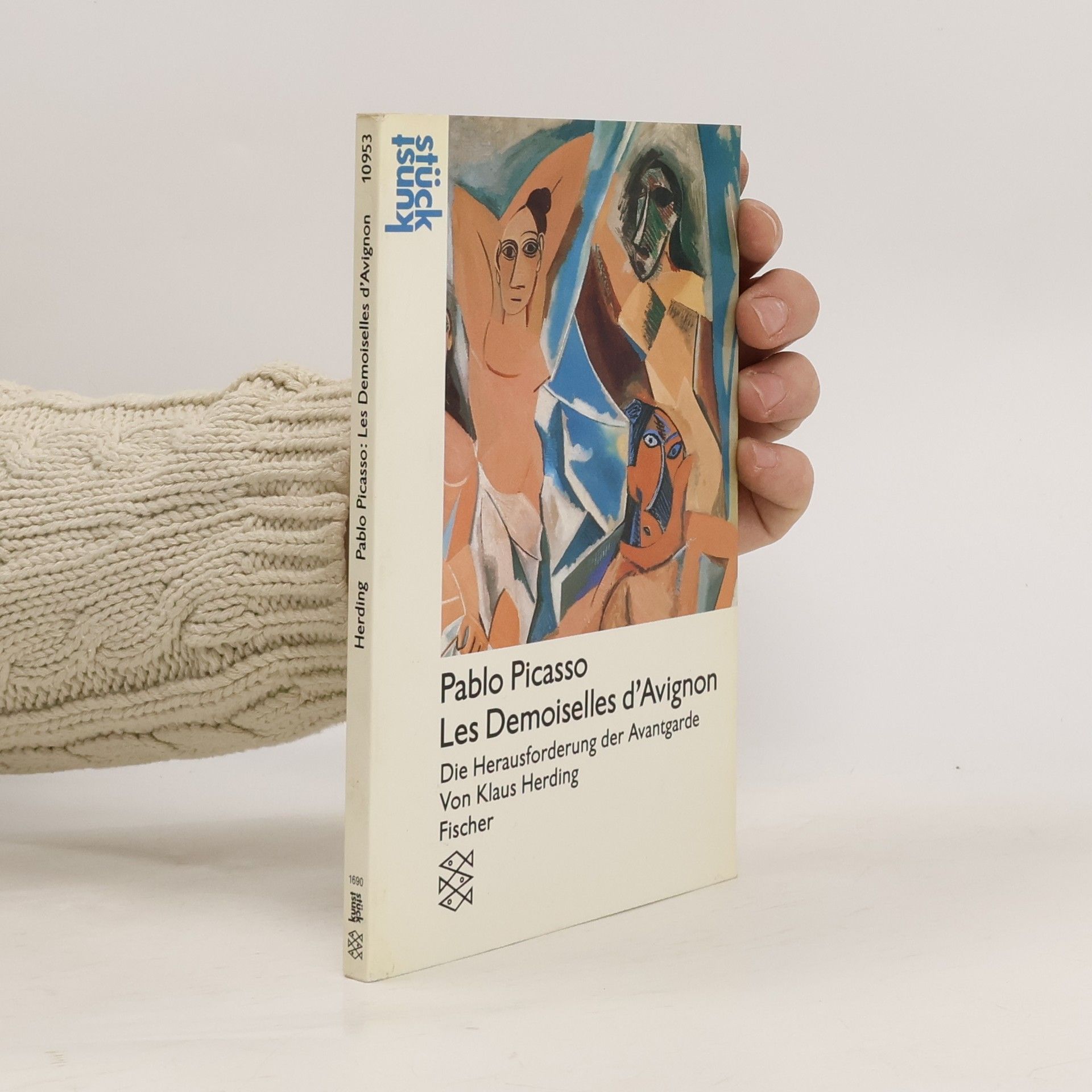

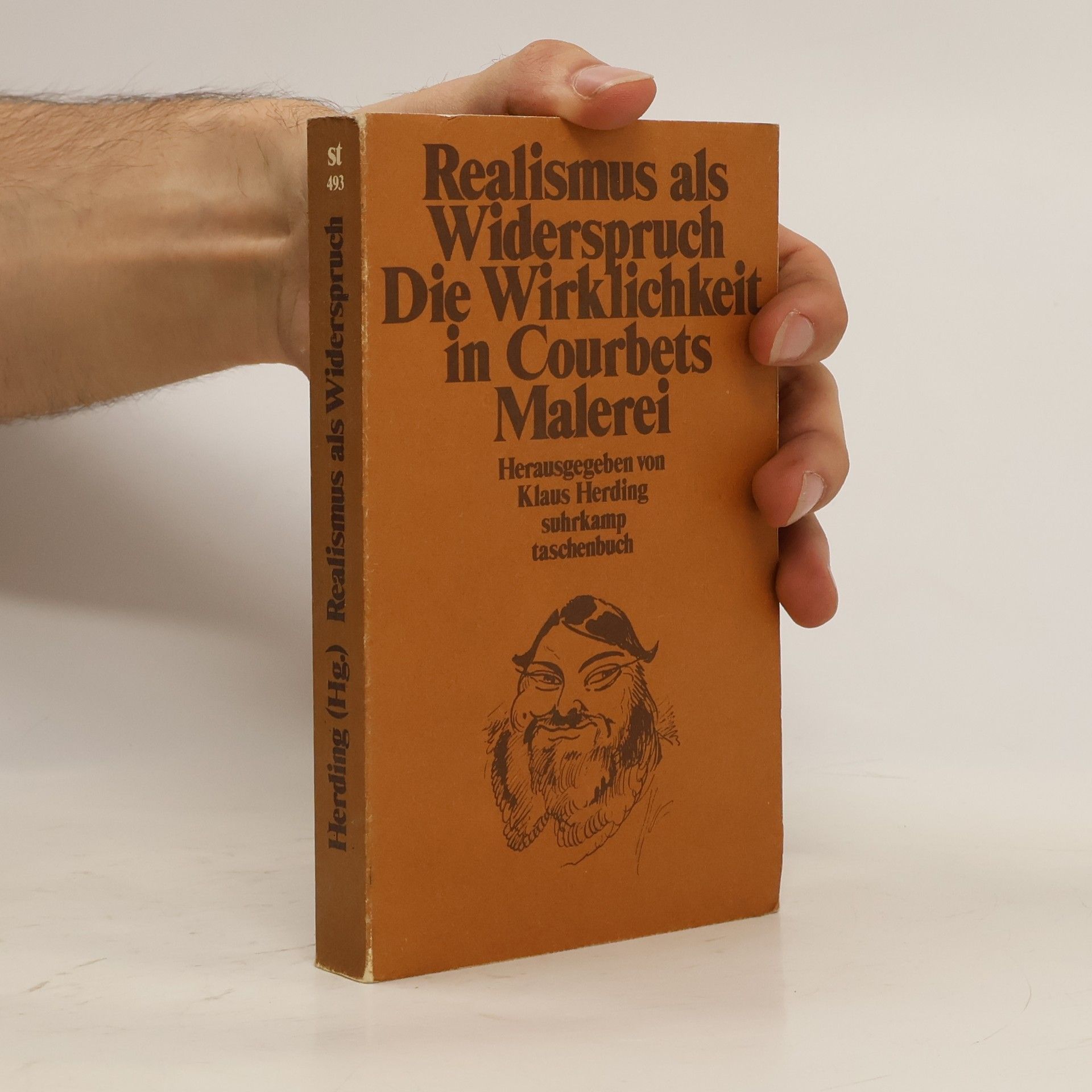
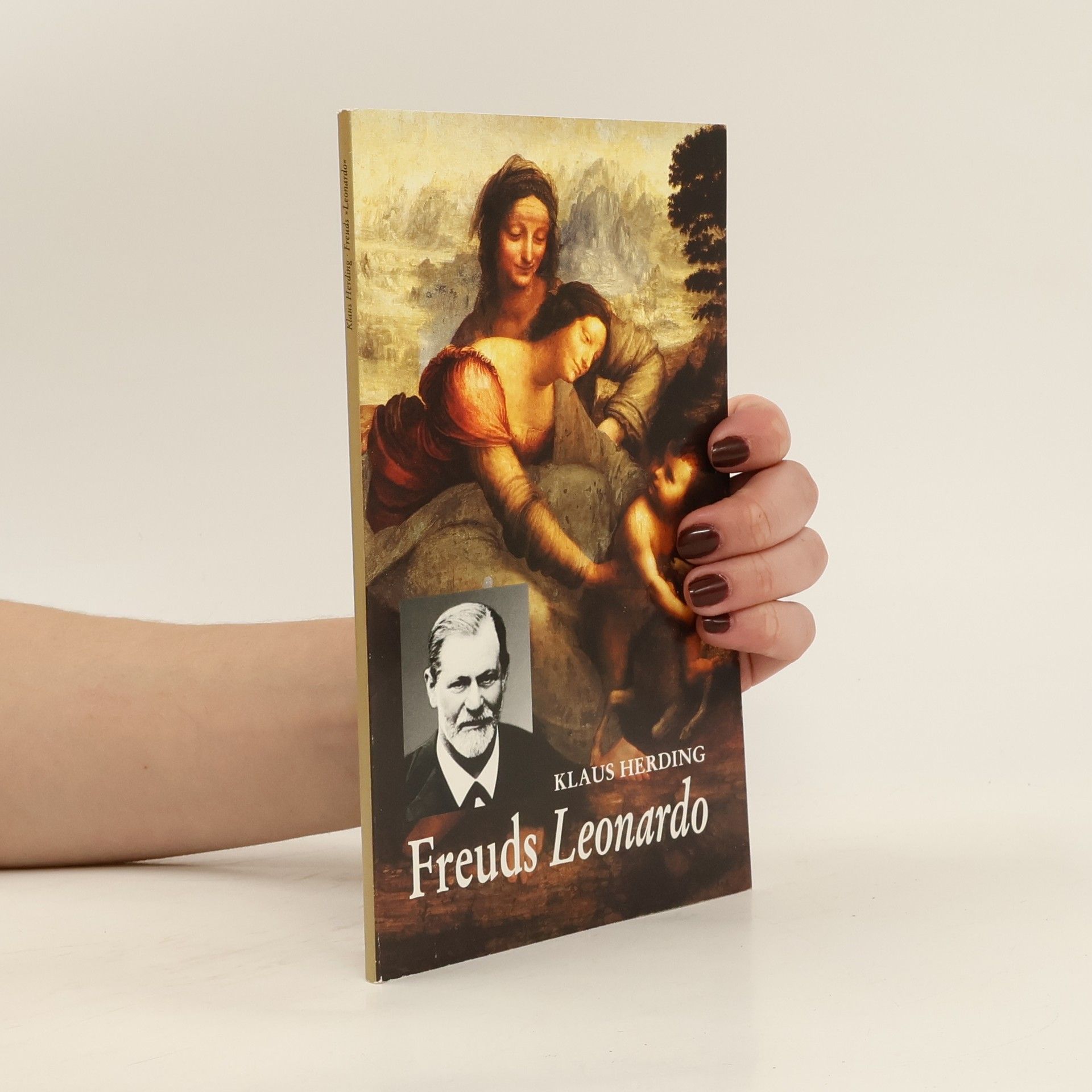
German
Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2 - 2: Orte des Unheimlichen
Die Faszination verborgenen Grauens in Literatur und bildender Kunst
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Book by
Landschaft
- 127 Seiten
- 5 Lesestunden

