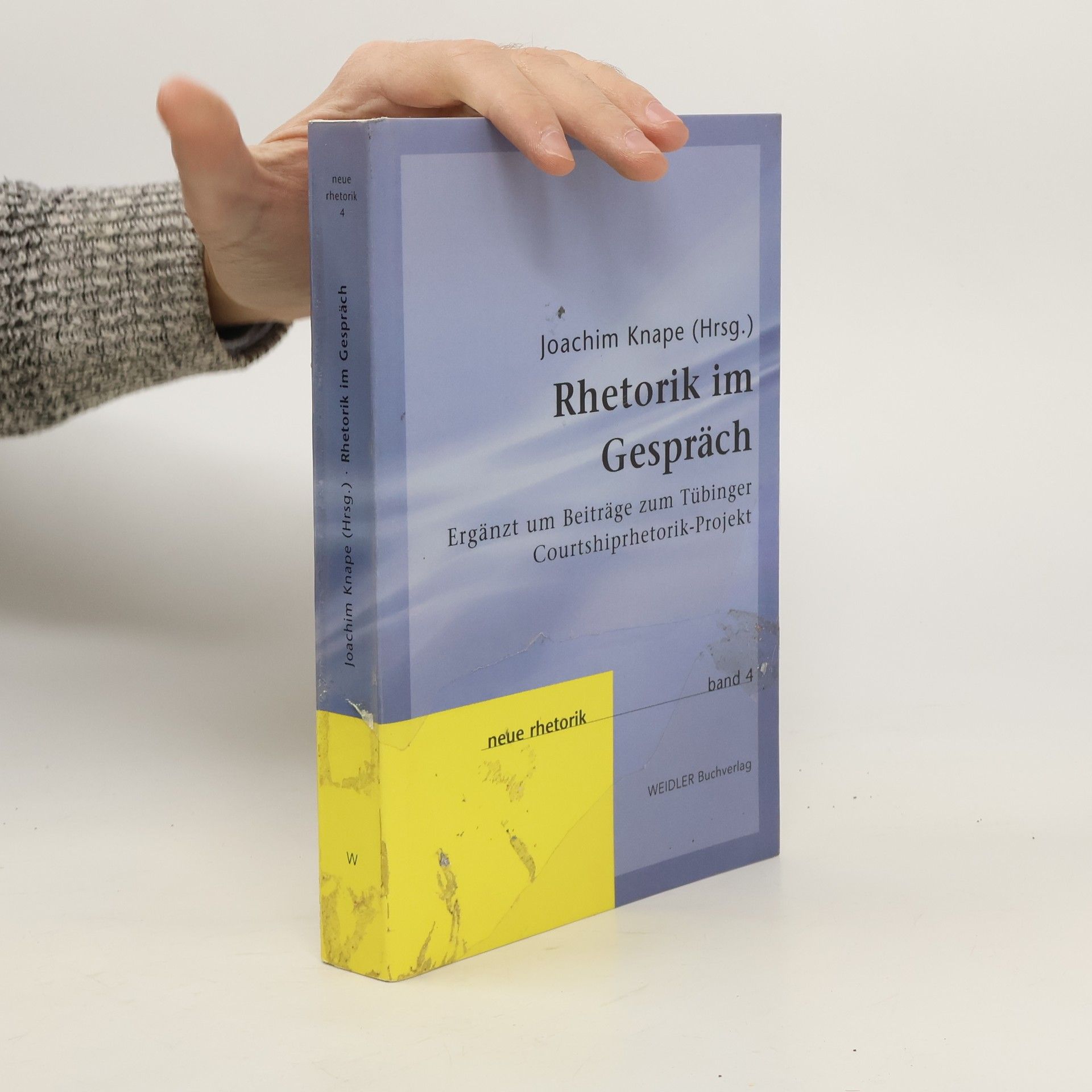Ästhetiken werden heute kaum noch veröffentlicht. Dieses Buch macht eine Ausnahme. Ausgehend von Martin Heidegger wird hier über das Kunstwerk im ästhetischen Ereignis und im ästhetischen Erleben der Menschen nachgedacht sowie, ausgehend von Immanuel Kant, über die ästhetische Idee im Werkprozess. Dieser ästhetische Prozess ist ein komplexes Geschehen mit den Aspekten Produktion, Werkerscheinen, Erlebnis des Menschen und Kommunikation. Dabei kommen Einflüsse in Begriffen und kulturellen Ideen, Kreativideen, andere mitgebrachte Ideen und die Erfahrung des Unbegrifflichen in der Werkbegegnung sowie Ahnungen des Seins im Werkerleben zusammen. All das erhebt das ästhetisierte Werk über bloßes Zeug und sorgt für die besondere Eigenständigkeit des Kunstwerks.
Joachim Knape Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



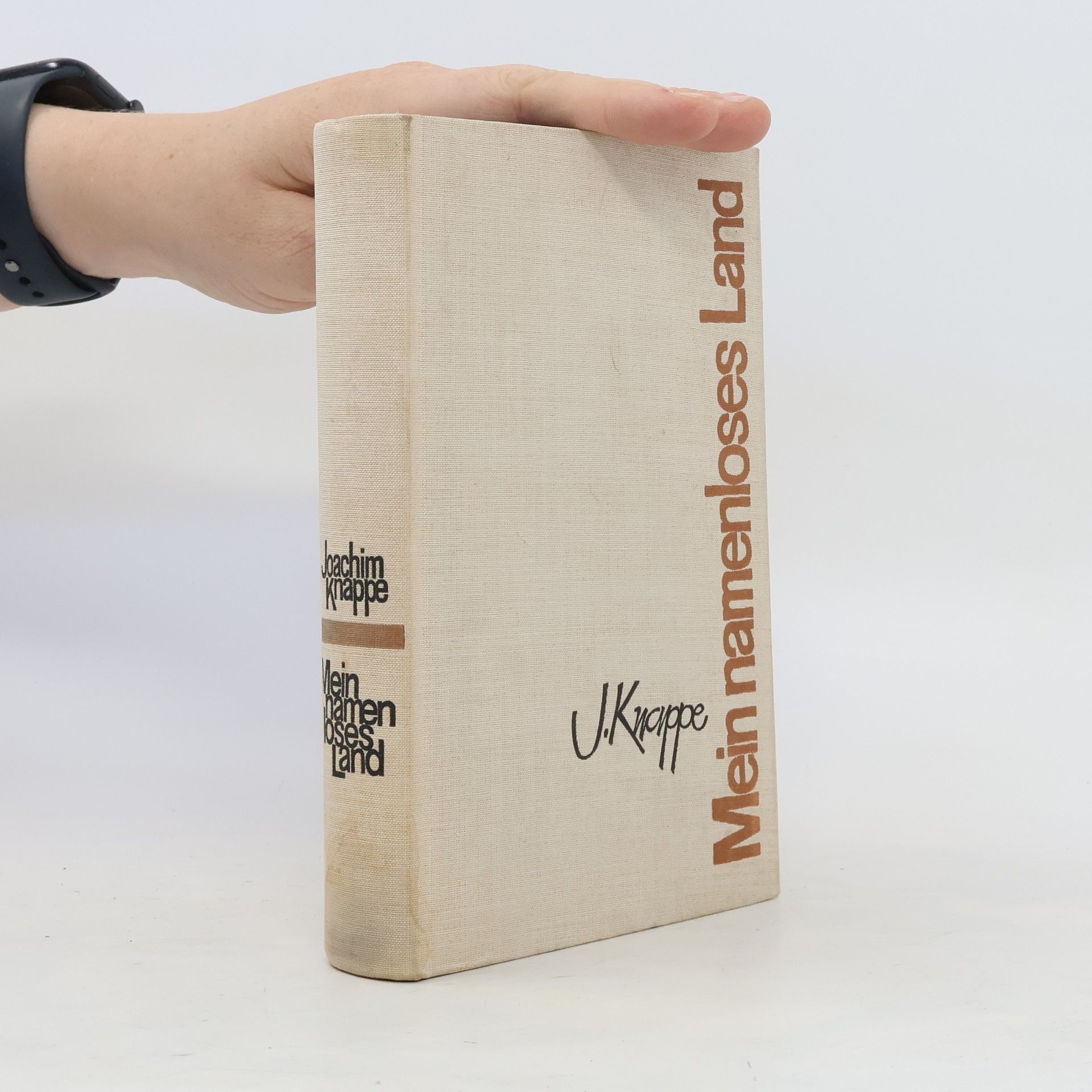


Freiheit
Zur Ideengeschichte und Ideenrhetorik der Renaissance als Aufbruch in die Moderne
- 457 Seiten
- 16 Lesestunden
Die Diskussion über Freiheit, ein zentrales Element des modernen westlichen Denkens, wird in diesem Buch umfassend analysiert. Es beleuchtet die Debatten großer europäischer Denker der Frühen Neuzeit, die sich mit Fragen des freien Willens und der politischen Freiheit auseinandersetzten. Besonders betont wird die Ideenrhetorik, die die rhetorischen Strategien und Vermittlungswege untersucht, die zur Formulierung und Verbreitung der Freiheitsidee genutzt wurden. Die Erörterungen reichen von der Renaissance bis zur Reformationszeit und sind bis heute von Bedeutung.
Was ist ein Bild?
Ein Kunstgespräch im Atelier Friedrich mit dem anwesenden Herrn Goethe
- 101 Seiten
- 4 Lesestunden
„Zu Friedrich. Dessen wunderbare Landschaften. Ein Nebelkirchhof, ein offenes Meer“, notiert Johann Wolfgang Goethe am 18. September 1810 nach seinem Besuch in Caspar David Friedrichs Atelier in Dresden. Mehr erfahren wir nicht von der Begegnung zwischen diesen beiden Meistern ihres Fachs. Wie sie sich zugetragen haben könnte, schildert Joachim Knape in Form eines Kunstgespräches über das Bild-Problem. Damit erweckt er eine im 19. Jahrhundert ausgestorbene literarische Gattung zum Leben, die in erzählerischer Dialogform leicht und eingängig bildtheoretische Fragen erörtert. Der Disput zwischen Goethe und Friedrich erleichtert so auch dem interessierten Laien den Zugang zu komplexen semiotischen und produktionstheoretischen Aspekten. An seinem Ende steht eine Minimaltheorie des Bildes.
Kunstgespräche
- 326 Seiten
- 12 Lesestunden
Was ist Kunst? Seit wann spricht man über Kunst? Wie kann man über Kunst sprechen? Lohnt es sich, über Kunst zu sprechen? Warum entsteht das Prädikat Kunst erst im Kunstgespräch? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich dieses Buch. Es dokumentiert zugleich ein Tübinger Kunstgesprächs-Experiment.
Rhetorik im Gespräch
- 340 Seiten
- 12 Lesestunden
In drei großen Abschnitten befasst sich der Sammelband mit dem Problemkreis Rhetorik und Gespräch. Leitfragen sind dabei: Was ist Gesprächsrhetorik und was sagen führende Gesprächsforscher dazu? Im ersten Teil entwirft der Direktor des Tübinger Seminars für Allgemeine Rhetorik Joachim Knape Grundzüge einer neuartigen und facettenreichen Theorie der Gesprächsrhetorik. Sie kreist um den Begriff des Gesprächsmanagements. Im zweiten Teil werden die Beiträge zu einer von der Volkswagenstiftung finanzierten Tagung publiziert, auf der u. a. führende deutsche Gesprächsforscher zur Frage des Überzeugungshandelns (Persuasion) im Gespräch Stellung nehmen. Sie kommen aus der Gesprächslinguistik, Psychologie, Rhetorik und Soziologie. Der dritte Teil fasst in mehreren Artikeln die Ergebnisse des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Tübinger Projekts zur Courtshiprhetorik, also zu rhetorischen Aspekten des Flirtens und der Partnerwerbung zusammen. Auch das Tübinger Gesprächskorpus wird hier dokumentiert.
Mit diesem Band schreibt Joachim Knape die Theoriegeschichte der Rhetorik, die weit über die in literarischen Formen geäußerten Rede-Elemente hinausgeht und die fragliche Wissenschaft als Kommunikation und Textproduktion umgreifende Lehre auffasst. In Einzeldarstellungen geht es um die neun wichtigsten Rhetoriken von der Antike bis heute, von Aristoteles bis zu Chaim Perelman. Knape erschließt so die wesentlichen Quellen und bietet einen weitgespannten rhetorikgeschichtlichen Überblick.
Was ist Rhetorik?
- 149 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Beherrschung der antiken Disziplin der Rhetorik und ihrer Regeln begründet noch immer unser Geschick als kulturell und gesellschaftlich Handelnde – wenn wir reden, um zu überzeugen, wenn wir Texte mit Absichten herstellen, hören, lesen, wenn wir Überzeugungen kennenlernen. Joachim Knape, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen, stellt eine moderne theoretische Grundlegung der Rhetorik vor, die auf der Definition basiert: »Rhetorik ist der Ausgang des Menschen aus gesellschaftlicher Sprachlosigkeit.«