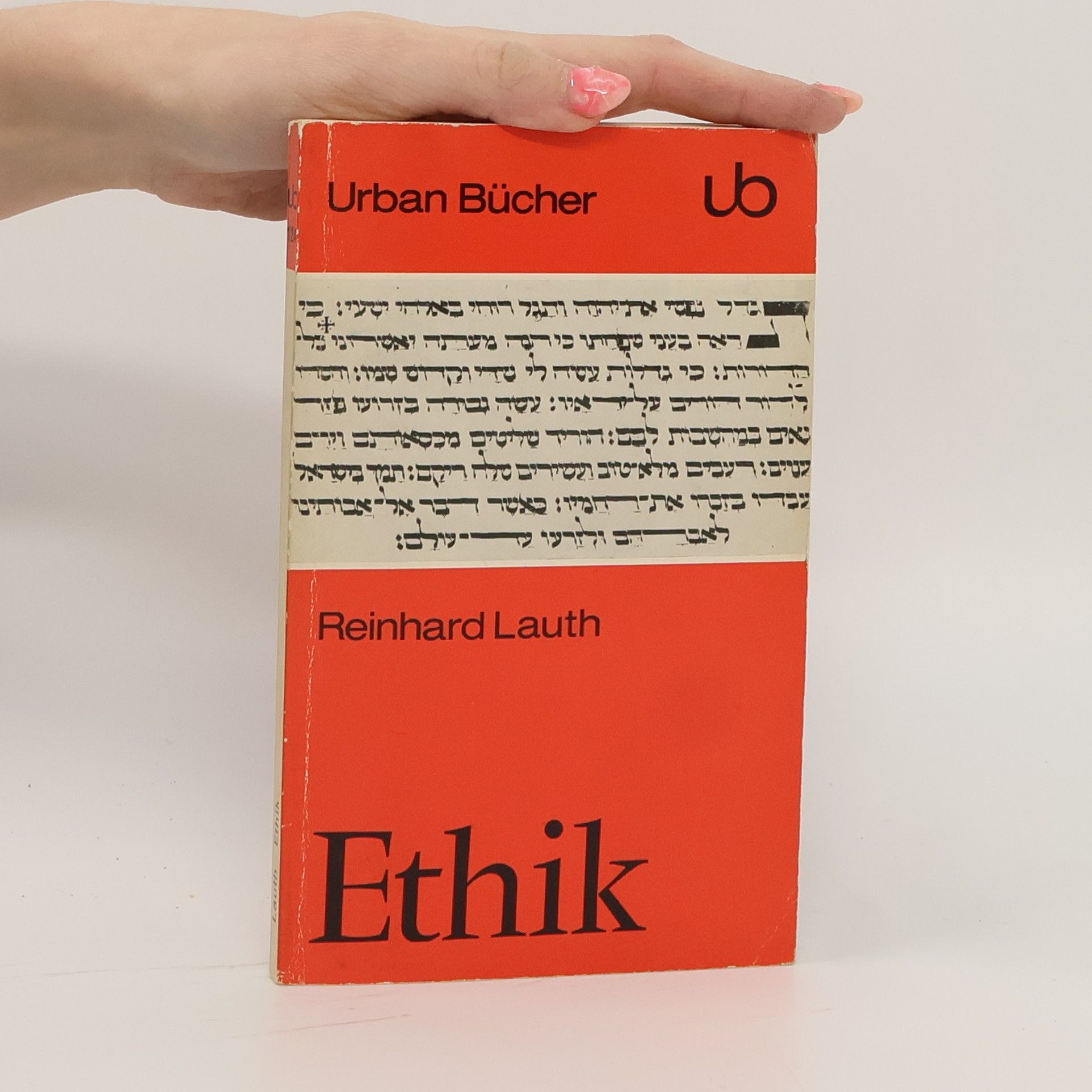Theorie des philosophischen Arguments I und II
Ergänzt durch Aufsätze zur systematischen Philosophie
Reinhard Lauth (1919–2007) ist einer der bedeutendsten systematischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. In der 1979 erschienenen „Theorie des philosophischen Arguments" fasste er in einer streng formalisierten Sprache die Grundlagen systematischen Philosophierens zusammen. In seinen letzten Lebensjahren hat er seinen transzendentalphilosophischen Ansatz weiter entwickelt, was in dem hier erstmals veröffentlichten zweiten Teil des Buchs ihren Niederschlag gefunden hat. Abgerundet wird das Ganze durch einige unveröffentlichte Aufsätze.