Was kann die Ideologiekritik heute leisten?Unhinterfragt herrschen die positiven Ingredienzen der "Moderne": Freiheit, Fortschritt, Vaterland, Marktwirtschaft. Zu ihnen liefert der zynisch verbrämte Charme der Sinnlosigkeit, die "Postmoderne", das Kontrastprogramm. Angesichts dieser Trends ist es dringend erforderlich, Maßstäbe vernünftiger Kritik an Institutionen und Ideen zu diskutieren.Hauck führt zunächst in die Geschichte dieser Diskussion ein, um sodann eine eigene Konzeption der rationalen Kritik zu entwickeln. Auf dieser Grundlage werden schließlich die zentralen Ideologeme des bürgerlichen Bewußtseins der Gegenwart analysiert.
Gerhard Hauck Bücher
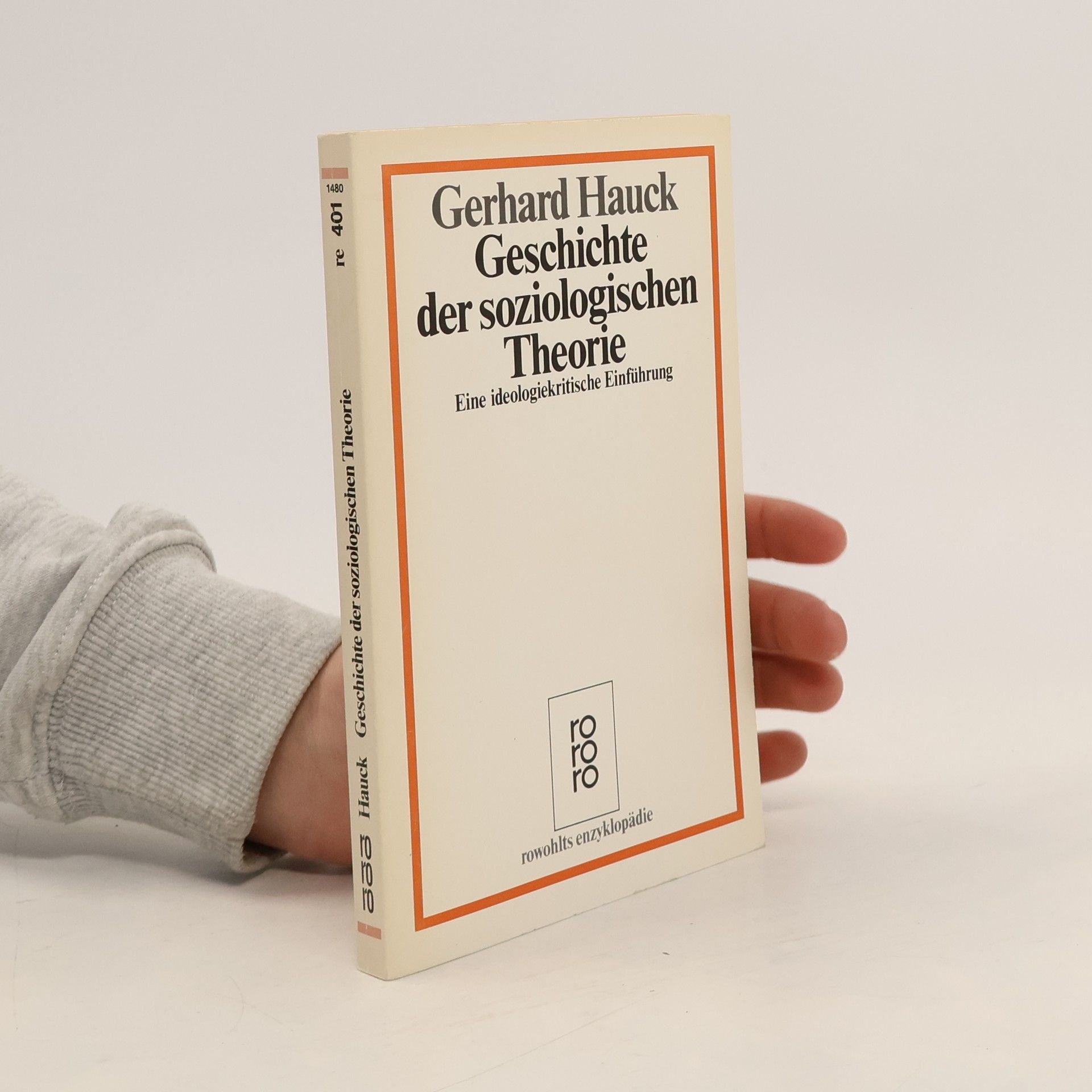


Kultur
- 226 Seiten
- 8 Lesestunden
Der Kulturbegriff hat den der Rasse als zentrales Instrument zur Rechtfertigung von Diskriminierung und Unterdrückung abgelöst. In offiziellen Diskursen spielen Rassenunterschiede kaum noch eine Rolle, während kulturelle Unterschiede zunehmend in den Vordergrund rücken. Ursprünglich wurde der Kulturbegriff in den US-amerikanischen Sozialwissenschaften als Gegenbegriff zur Rasse eingeführt, um zu betonen, dass nicht biologische Faktoren, sondern kulturelle Unterschiede das Verhalten verschiedener Menschengruppen prägen. Das Buch untersucht die Ursachen für diesen Bedeutungswandel und die Mechanismen, die ihn ermöglicht haben. Ein zentraler Aspekt ist der Substanzialismus im sozialwissenschaftlichen Kulturbegriff, der Kulturen als diskrete, unveränderliche Einheiten betrachtet, ähnlich wie biologische Spezies oder Himmelskörper. Diese Sichtweise führt dazu, dass zwischen Kulturen nur Konflikte oder Überlebenskämpfe möglich sind. Um die negativen Konsequenzen dieser Perspektive zu überwinden, ist ein Konzept erforderlich, das kulturelle Unterschiede als historisch kontingent und nicht als festgelegt erkennt. Dadurch wird der absolute und unveränderliche Charakter der Gegensätze zwischen Kulturen relativiert.
Geschichte der soziologischen Theorie
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden