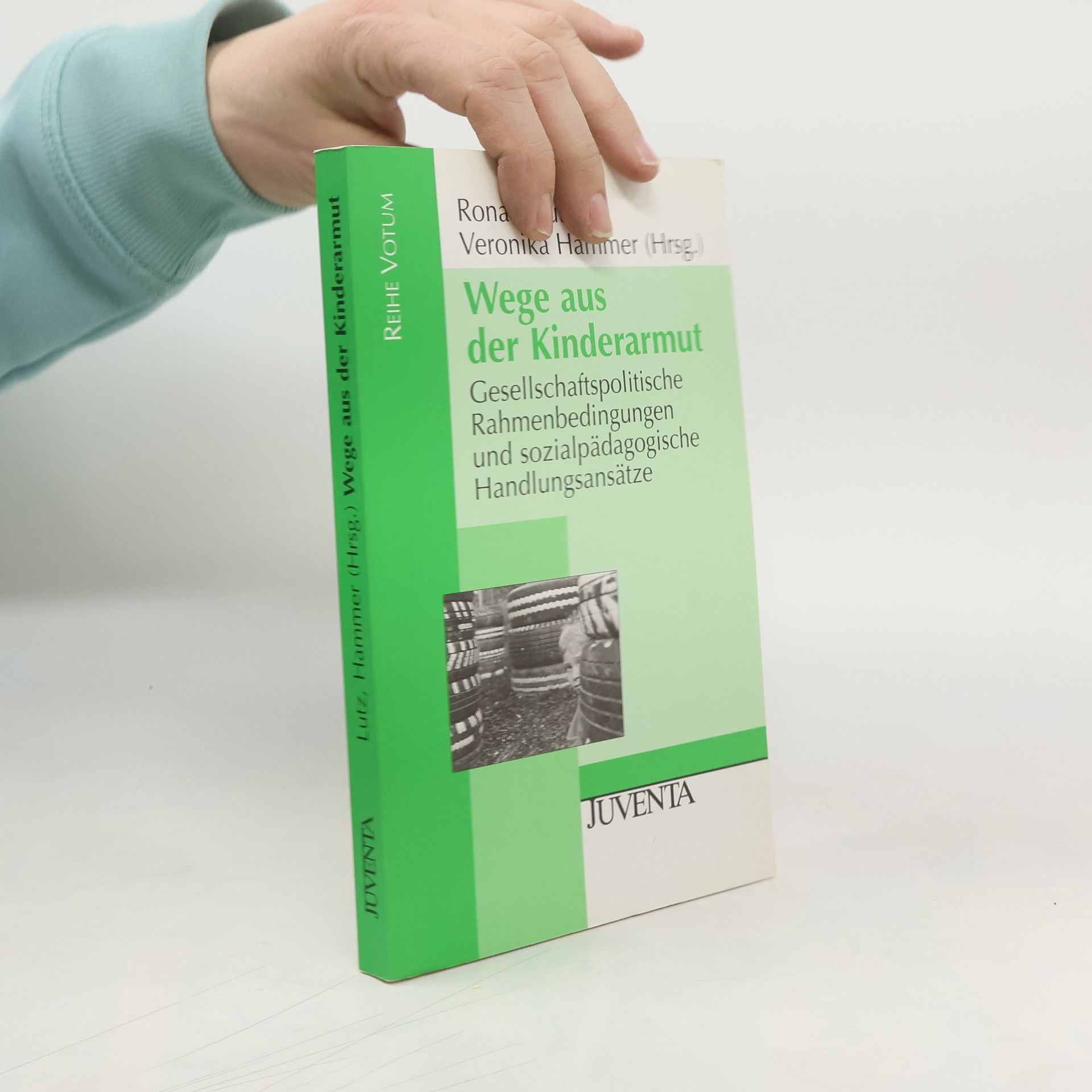Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe
Eine Einführung in Praxis, Positionen und Perspektiven
- 252 Seiten
- 9 Lesestunden
Die Wohnungslosenhilfe hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem eher traditionell und fürsorglich agierenden Hilfesystem zu einer modernen Dienstleistung gewandelt, die in sehr differenzierten Leistungstypen wohnungslosen Menschen Angebote zur Bewältigung ihrer Probleme und Konflikte macht. Wohnungslosigkeit wurde immer mehr in engem Zusammenhang mit Armut und Wohnungsnot diskutiert und somit als Ausdruck einer sozialen Lage interpretiert, die von struktureller Ausgrenzung, Stigmatisierung und Unterversorgung charakterisiert ist.In diesem Band, der vor allem für den Einsatz in der Lehre konzipiert ist, der aber auch ein Nachschlagewerk für Praktiker sein kann, wird die Vielfalt des Hilfesystems dargestellt. Ferner wird reflektiert, wie sich das Hilfesystem von seinen Anfängen bis heute entfaltete, welche Querbezüge es entwickeln konnte und welche Diskurse hierzu geführt wurden. Dies schließt auch einen intensiven Blick auf seine rechtlichen Grundlagen ein.